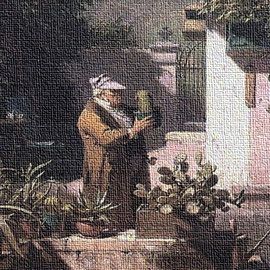Überblick MamM 601 bis 620
601 Das soll er mir büßen {i105} (*18.-19.11.2010)
602 Der Eispanzer {i106}
(*25.-26.11.2010)
603 Eigene Sühne {i107} (*2.+6.12.2010)
604 Welchen Wert {i108}
(*10.-11.12.2010)
605 Die unbequeme Fee {i109}
(*16.-17.12.2010)
606 Das Licht der Sterne {i110} (*31.12.2010+3.1.2011)
607 Die größte Sünde? {i111}
(*6.+7.+10.1.2011)
608 Auf den Spuren zurück {i112} (*13.-14.1.2011)
609 Der Glücksweg {i113}
(*20.-21.1.2011)
610 Und so jemand mit dir unrechten will {i114} (*27.-28.1.2011)
611 Sollen oder leben {i115} (*3.-4.2.2011)
612 Und verlor ihre einzige Liebe? {i116} (*10.-11.2.2011)
613 Warten - geschenkt {i117}
(*17.-18.2.2011)
614 Eheglück {i118}
(*24.-25.2.2011)
615 Die beiden Postkutschen {i119} (*4.3.2011)
616 Tor der Liebe {i120} (*11.3.2011)
617 Nachtmeister Stropp und der Fall Johannisius {s44} (*17.3.2011)
618 Die stinkende Stadt {i121}
(*24.+28.3.2011)
619 Feste fasten {i122}
(*31.3.2011)
620 Was ist Liebe? {i123}
(*7.-8.4.2011)
MamM 601 „Das soll er mir büßen!“
Dieser Ausspruch lag bei Don Legando ganz oben: auf seinem Herzen, in seinem Denken, auf seinen Lippen. Allein – los war er diese Last noch nicht, als er sie äußerte; denn Heftigkeit facht
eine Glut oft weiter an.
Das fast schon gewohnheitsmäßige „So?“ des Alten von der
Halbinsel war ebenfalls kein Löschmittel.
„Soll ich mir das etwa gefallen lassen?“ fragte der Besucher verneinend.
„Soll?“ hakte der Alte in sein Reizwort. „Nichts sollst
du; aber du darfst um deine Freude ringen –“
„Schöne Freude!“ schimpfte Don Legando und meinte das Gegenteil. „Wenn einem so etwas angetan wird!“
„Was angetan wurde“, übte sich der Alte altklug in fragwürdigem Wortspiel, „kann auch wieder abgetan werden –“
„Eben!“ wähnte der Besucher Bestätigung. „Deshalb soll
er mir zu Kreuze kriechen und büßen –“
„Zu wessen Kreuz?“ hüllte sich der Alte in Dummheit.
„Ach, das ist so eine Redensart“, ärgerte Don Legando sich selber. „Meinetwegen zum Kreuze Christi –“
„Ach“, blieb der Alte naiv, „du willst das Christentum fördern? Hab’ ich da in der Sonntagsschule nicht
richtig aufgepaßt? Ich dachte, das Christentum habe etwas mit Gnade –“
„– und Buße!“ ergänzte der Besucher. „Und die vorher:
erst die Buße, dann meinetwegen Gnade!“
„Und wie diese Buße auszusehen hat, das bestimmt –“, der Alte hielt inne. „Sagtest du nicht eben, daß jener
dir zu büßen –?“
„Selbstverständlich!“ bestätigte Don Legando. „Er steht
doch in meiner Schuld!“
„Und kann sie nicht bezahlen“, ergänzte der Alte. „Aber durch die Buße ist dann alles ausgeglichen und
–?“
„Na ja“, konnte der Besucher nicht ganz zustimmen, „etwas Schuld bleibt immer noch nach. Denkt nur an die
Mörder –“
– „Von denen ich bis heute nicht weiß, wer das ist“, zeigte der Alte einen Mangel. „Völlige Wiedergutmachung
schließt du also aus?“
„Ja“, antwortete Don Legando. „Wer wollte einen Mord aufwiegen!“
„Wozu dann aber Buße?“ fragte der Alte.
„Erstens als Entschädigung“, brauchte der Besucher nicht lange zu überlegen, „zweitens zur Besserung des Täters und drittens zur Abschreckung für andere.“
„Und verhängt vom Geschädigten?“ begriff der Alte noch immer nicht. „Der Ankläger als Richter?“
„Was sollte dagegen sprechen?“ wehrte sich Don Legando mit einer Gegenfrage. „Es ist seine
Angelegenheit!“
„Und wenn der Angeklagte das gleiche Recht beansprucht? Es ist auch seine Angelegenheit.“
„Das wäre ja noch schöner!“ meinte der Besucher das Gegenteil. „Dann wären ja der Ungerechtigkeit Tür und –“
„Ist denn das, was du tun willst, gerecht?“ zweifelte der Alte stark. „Hast du denn die Rechte studiert?“
„Wozu?“ sah Don Legando dazu keinen Anlaß. „Haben’s etwa
die Schöffen getan? Nein, dazu genügt der gesunde Menschenverstand.“
„Darauf könnte sich auch der Angeklagte berufen“, überlegte der Alte hörbar.
„Ich sagte: der g e s u n d e Menschenverstand!“ betonte der Besucher. „Den hat der Schuldige offensichtlich nicht –“
„Beschuldigte“, verbesserte der Alte; „der, dem die Schuld aufgeladen wird und durch Strafverbüßen
erleichtert, aber nicht getilgt wird? Nein, ich begreife nicht, wie Menschen glücklich sein können, die zu richten –“
„Ihr werdet richten die 12 Geschlechter Israels“, zeigte sich Don Legando bibelkundig.
„Na, zu mir ist das nicht gesagt worden“, schloß sich der Alte bereitwillig aus. „Ich halt’s lieber mit der
Bergpredigt, der Gnade und dem Leben“, und er begann zu erzählen:
Die Stadt des Friedens hatte ihr Tor noch geöffnet, und Menschen eilten herbei, rechtzeitig eintreten zu dürfen. Von ungefähr kam auch Fangoso an das Stadttor. Er wollte aber nicht voreilig sein und erst einmal abwarten, wie sich das alles entwickelte. Und es war schon Sonderbares, was er da beobachtete.
Längst nicht jeder, der zum Stadttor eilte, durfte eintreten. Denn im Tor saß ein Schreiber hinter einem Tisch, auf welchen jeder seine Taschen leeren mußte. Fanden sich nun bestimmte Zettel
unter dem Hab und Gut auf dem Tisch, wurde der Eigentümer wieder fortgeschickt. Fanden sich solche Zettel nicht, schlug der Schreiber
ein dickes Buch auf, blätterte, riß eine bestimmte Seite heraus und warf sie in ein Feuerchen. Hatte sich die Seite in Rauch aufgelöst,
durfte sich der Wartende noch einmal mit Brot und Wein stärken, ehe er in die Stadt eingelassen wurde.
Was mochten das für Zettel sein, nach denen gefahndet wurde? Von seinem Beobachtungsposten aus konnte es
Fangoso nicht erkennen. Aber nun trat einer an den Tisch des Schreibers, der einen großen Packen dieser Zettel mitgebracht
hatte. Als er aber merkte, daß ihn diese Zettel daran hinderten, eingehen zu dürfen, warf er sie alle einfach hinter sich.
Wie ihn nun der Schreiber einließ, bekam Fangoso gar nicht mehr mit, denn neugierig hatte er einen der weggeworfenen Zettel aufgehoben. Das – das war ja ein Schuldschein! Und auf welch hohe Summe der lautete! Fangoso witterte das Geschäft seines Lebens! Schnell sammelte er auch die übrigen
Zettel auf. Alles Schuldscheine! Nun brauchte er nur noch die Schuldner
aufzusuchen und das Geld einzutreiben, dann war er ein gemachter Mann!
Allein – wen Fangoso auch suchte, immer wieder hieß es, der Betreffende habe sich zu jener Stadt aufgemacht und sei nicht mehr zurückgekehrt.
„Na wartet“, sprach Fangoso zu sich, „ihr Schurken sollt mir nicht ungeschoren davonkommen! Ihr sollt mir bis
auf den letzten Heller alles bezahlen!“ Und er eilte zurück zu jener Stadt; und da er den Schreiber noch immer am Tore sitzen sah, knallte er ihm sämtliche Schuldscheine auf den Tisch.
„Damit darf ich Euch nicht einlassen“, verstand der Schreiber die Geste falsch.
„Das will ich auch gar nicht“, belehrte Fangoso. „Ich will mein Geld! Schau Er nach, ob die Schuldner in Seiner Stadt wohnen.“
Der Schreiber holte unter dem Tisch ein weiteres Buch hervor, das war voller Namen. Er blätterte, verglich,
nickte, bis – er alle Schuldscheine durchgesehen hatte. Dann wandte er sich wieder an Fangoso: „Ja, Ihr habt recht, alle wohnen in
meiner Stadt. Aber – sie schulden nichts mehr. Hier, seht selbst: Alles getilgt!“
„Aber das kann nicht sein!“ glaubte Fangoso schlecht zu träumen. „Hier sind doch die Schuldscheine!“
„Die sind wertlos“, entgegnete der Schreiber und griff nach dem 1. Buch. „Entscheidend ist, was in diesem
Schuldbuch steht. Da, vergleicht nur die Nummern. Keine dieser Schulden
steht mehr in diesem Buch. Aber nun muß ich einpacken, denn es ist Zeit.“
Und während der Schreiber dies in die Tat umsetzte, wehte aus der Stadt eine wunderschöne Musik herüber, daß sie Fangoso ans Herz ging, er alle Schuldscheine ergriff und
–
„– zum bettelarmen Dummkopf wurde“, ergänzte Don Legando.
„Nein“, verbesserte der Alte, „zum Kinde“, und geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *18.-19.11.2010, freigegeben am 19.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 602 Der Eispanzer
„Was hab’ ich mich geärgert!“ gestand Don Freddano unbewußt eine Torheit
ein.
„So?“ mochte ihn der Alte von der Halbinsel nicht voreilig verurteilen.
„Wohl 20 Minuten hab' ich am Freitag auf ihn gewartet, –“
„Wartezeit – geschenkte Zeit“, goß der Alte Öl hinein.
Nicht in Wasser, denn der Besucher brauste sogleich auf und verbesserte: „V e r schenkte Zeit. Und das bei diesen Temperaturen!“
„Noch sind sie über null –“
„Und wären sie unter null gewesen“, schimpfte Don Freddano, „hätte er mich dennoch versetzt –“
„– in die nächste Klasse“, ergänzte der Alte. „Gratuliere –“
„Spottet nur!“ meinte der Besucher das Gegenteil. „Wenn
Ihr so gefroren hättet wie ich, wäre Euch das Lachen schon vergangen.“
„Was geht, kann wiederkommen –“
„Da wäre ich nicht so sicher“, dämpfte Don Freddano. „Da hättet Ihr mal seine letzte Predigt hören
sollen! Fast 20% überzogen!“
„Mit was?“ stellte sich der Alte mal wieder zu den Einfältigen.
„Die Zeit überzogen!“ wurde der Besucher deutlicher. „Am
liebsten wäre ich aufgestanden und gegangen!“
„Was du wohl auch getan hast, sonst wärst du –“
„Aber erst, als alles fertig war“, stellte Don Freddano richtig. „Sonst wirst du noch als Unruhestifter
angesehen –“
„Das bin ich doch auch“, ging der Alte nach Calau voran.
„Aber ich nicht“, folgte der Besucher nicht. „Schließlich ist er der Neffe des Bischofs. Wer will es
sich mit solchen schon verderben –“
„– solange der Bischof im Amt ist“, ergänzte der Alte.
„Herbstlich trübt die Sonn’ dann her,
dicht der Nebelflor,
unser Antlitz glänzt nicht mehr
freundlich wie zuvor.“
„Oder der Neffe ist der neue Bischof“, sah Don Freddano einen andere Möglichkeit. „So etwas bleibt doch meist
in der Familie.“
„Kann vorkommen“, gab der Alte zu, „aber was bekümmert das uns?“
„Viel!“ sah sich der Besucher weniger leichtfertig.
„Vielversprechend predigen, aber im Alltag nichts davon halten –“
„Einiges!“ verbesserte der Alte. „So schlimm sind sie ja
meistens nicht –“
„Aber wohin soll das noch führen?“
„Soll?“ hatte der Alte wieder sein Reizwort gefunden.
„Nichts soll! Allein – ist es denn nicht eine treffliche Arbeitsteilung: Die einen predigen, und die andern bemühen sich, danach zu
handeln? Ein jeder tut eben, was er am besten –“
„Schönen Dank!“ meinte es Don Freddano anders. „Ich hab’
lieber glaubwürdige Prediger. Wenn ich doch wenigstens wüßte, wie ich mich nicht mehr darüber ärgern –“
„Aha“, freute sich der Alte. „Du hast es also selbst bemerkt. Na, dann tu es eben nicht mehr: Ärgere dich einfach nicht mehr selber!“
„Einen Panzer müßte ich haben“, dachte der Besucher laut. „Ich sollte mir einen Panzer wachsen lassen, an dem
alles abprallt.“
„Soll?“ konnte es der Alte nicht lassen. „Allein – solch
ein Rat ist nicht selten“, und er begann zu erzählen:
Tenerino hätte gewiß mit dir mitfühlen können. Gebaut
wie ein Kleiderschrank, kantiges Gesicht, buschige Augenbrauen, flößte er nicht nur jedermann Achtung ein, sondern leider auch vielerfrau und vielermann Furcht.
Dabei konnte er noch nicht einmal einer Fliege etwas zuleide tun, sondern öffnete ihr Fenster und Türen ins Freie, statt sie zu erschlagen. Auch hätte er gerne mit Gutem sein täglich’ Brot verdient, doch niemand gab ihm solche
Arbeit. Es war schon ein Jammer: Ihm, dem Gutmütigen und Menschenfreund, mißtrauten die Menschen, während sie den Betrügern und
Menschenverführern blindes Vertrauen schenkten. Da hätte Tenerino schon verbittern und verzweifeln können, wie es vor und neben ihm
mancher gelernt hatte. Doch Tenerino wollte nicht verzweifeln.
Deshalb machte er sich auf den Weg zur Eiskönigin, die ja bekanntlich jetzt um diese Jahreszeit besser zu erreichen ist denn in
Frühling und Sommer. Die war bereitwillig mit Rat und Tat zur Stelle und schenkte Tenerino einen Eispanzer, ja, sie legte ihn Tenerino
auch gleich an.
Nun war Tenerino eigentlich gut gewappnet gegen Mißtrauen und Ungerechtigkeit; nichts konnte mehr sein Herz
erreichen. Jedoch – was die Menschen Übles sagten, konnte er noch hören;
und ihre finsteren, argwöhnischen Blicke konnte er noch sehen.
Doch auch da fand er Abhilfe. Er begegnete nämlich einem Trödler, und der verkaufte ihm ein Paar Ohrenpfropfen
und eine rosarote Brille. Nun konnten die Menschen kränken, wie sie wollten, Tenerino hörte es nicht; und nichts erschien ihm mehr grau und düster. War er nun glücklich?
Nein, denn unter dem Eispanzer wurde sein Herz nicht mehr warm, sondern kälter und kälter. Kein
Spatzenkonzert, kein Gesang von Meise oder Rotkehlchen, kein Kinderlachen drangen mehr zu seinen Ohren herein. Und was seine Augen
sahen, hatte nur noch einerlei Farbe.
Da führte ihn eines Abends sein Weg auf einen Berg. Und da es dort sehr einsam war, glaubte Tenerino, Brille
und Ohrenpfropfen nicht nötig zu haben. Endlich war er oben und blickte sich um. Welch eine wunderbare Stille! Keine tote Stille, die ihm zuvor noch seine
Ohrenpfropfen verschafft hatten, sondern eine lebendige Stille. Der Wind rauschte nämlich durch die Zweige und trug noch manchen Laut
von Menschenhand herüber; doch nicht störend, sondern gedämpft. In der
Ferne läuteten Glocken den Winterabend ein, und zu Tenerinos Füßen lagen die Häuser und Hütten der Menschen. Nach und nach wurden dort Lichter angezündet, manche heller, manche schwächer und kaum zu erkennen.
Was mochte unter den Dächern dort unten vorgehen? Sicherlich waren in manchen Häusern ungebetene Gäste
eingekehrt: Sorge, Krankheit, Streit, Trauer, Kränkung, Schuld; ja, vielleicht traf jener Spruch sogar zu: Unter jedem Dach ein Ach.
Und Tenerino wurde es wärmer und wärmer ums Herz; die Menschen dort unten taten ihm nicht mehr weh, sondern
leid. Und mit einem Mal sprang der Eispanzer von ihm ab. Brauchte Tenerino
ihn überhaupt noch? Nein, sagte er zu sich, als er nun seine Augen aufhob und den Sternenhimmel gewahrte. Welch eine Pracht! Welch ein Reichtum! Und eine stille Freude hielt Einzug, als Tenerino wieder hinabstieg. Es mußte doch
möglich sein, mit dieser Freude anzustecken und –
„– wieder und wieder enttäuscht zu werden“, bitterte Don Freddano hinein.
„– und die Glut im Herzen nicht mehr verlöschen zu lassen“, würzte der Alte Bitterkeit und Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *25.-26.11.2010, freigegeben am 19.7.2024
Qouz-Note: 2
***
MamM 603 Eigene Sühne {i107}
„Ich bin richtig entsetzt!“ tat es Don Birrone. „Das hätte ich von dem nie
gedacht!“
„So?“ machte auch der Alte von der Halbinsel Raum für neue Gedanken.
„Eine weiße Weste tragen“, fuhr der Besucher fort, „und darunter Schmutz und Unrat!“
„Solange der Träger nicht zu stark schwitzt“, teilte der Alte Erfahrungsschätze, „und es nicht regnet, bleibt’s eben unentdeckt.“
„Aber es ist dennoch einen schwere Enttäuschung –“
„– die eine Täuschung beendet“, ergänzte der Alte. „Über was ärgerst du dich überhaupt? Über sein Täuschen oder darüber, daß du darauf reingefallen bist?“
„Das eine ist wohl von dem andern nicht zu trennen –“
„Und doch ärgerst du dich selber“, blieb der Alte an der Wunde, „verbitterst dir sogar deine Erinnerungen. Ist
das nicht närrisch?“
„Ich werde jedenfalls keinem mehr vertrauen, der im Rampenlicht steht“, blieb Don Birrone die Antwort schuldig. „Nach außen ritterlich und redlich, tatsächlich verlogen und verdorben!“
„Tscha“, der Alte zuckte mit den Achseln, „weiße Westen fördern die Verwesung. Wenn sich niemand mehr durch
sie blenden läßt, wird sie auch niemand mehr tragen. Zumal sie nicht von harter Arbeit –“
„Bildlich stimmt das schon, aber“, schränkte der Besucher ein, „da begeistert uns jemand, Gutes zu tun; setzt
neue Maßstäbe, ist selber ein Maßstab –“
„– erscheint als Maßstab“, verbesserte der Alte.
„– und macht dann alles zunichte“, fuhr Don Birrone fort.
„– wenn wir ihn es zunichte machen lassen“, ergänzte der Alte. „Da hat uns die Sonnenseite eines Berges lange
Zeit erfreut, und plötzlich entdecken wir, daß derselbe Berg auch eine schroffe Schattenseite hat. Bei den Bergen gelingt es, uns
weiterhin zu freuen; warum nicht bei den Menschen?“
„Bilder, Bilder!“ tat es der Besucher ab. „Ein fauler Baum trägt keine guten Früchte, so steht es sogar in Eurer Bibel –“
„Geschrieben habe ich sie selber nicht“, stellte der Alte richtig. „Doch um diesen Einwand zu entbildern:
Welcher Mensch ist kein fauler Baum? Allein – welcher Baum könnte nicht verwandelt werden?“ Und er begann zu erzählen:
Germar war jung und hatte keine reichen Eltern, die ihm hätten seine Weg durchs Leben bahnen können. Das mußte er schon selber tun, auch wenn’s ihm nicht leichtgemacht wurde. Armer Leute
Kinder müssen halt manchen an sich vorbeiziehen lassen, der’s ihnen schlecht dankt: Höhnisch schüttet er Sand hinter sich auf den Weg, und seine reichen Eltern geben Verachtung dazu. Ob solcher Ungerechtigkeit hat schon mancher verzweifelt oder ist unter die Räuber gegangen.
Für Germar tat sich eine andere Tür auf: der Krieg. Hier wurde nicht gefragt, wo einer herkam, sondern: wie
gut einer das Kriegshandwerk beherrschte. Germar witterte seine Chance, meldete sich freiwillig und arbeitete sich unaufhaltsam nach
oben. Schnell lernte er, worauf es ankam: Gewissenlosigkeit, List und – immer auf der Seite des Siegers zu sein.
„Der Zweck heiligt die Mittel“, wurde ihm eingeimpft, und im stillen fügte er hinzu: „Nur wenn du siegst!“ Dann war alles erlaubt! Dann war die eigene Macht grenzenlos!
Und der junge Germar berauschte sich an seiner Macht und – tat manches, was zu Friedenszeiten als Verbrechen gegolten hätte.
Aber schließlich neigte sich das Kriegslos für Germar auf die Verliererseite. Da hieß es plötzlich: schnell
untertauchen und sich nicht erwischen lassen. Anderenfalls drohten viele Jahre Gefangenschaft oder gar der Tod.
Während Germar nun als vermißt und verschollen galt, machte bald ein gewisser Friedrich von sich reden. Nicht daß er überall beliebt war! Nein, er machte sich manchen zum Feinde. Wer seine Arbeiter um deren Verdienst betrog, bekam es mit Friedrich zu tun. Wer
seinen Kunden schlechte Ware lieferte, bekam es mit Friedrich zu tun. Wer mit Zinsen, Miete und Pacht wucherte, bekam es mit Friedrich
zu tun. Kurz: Wo immer im Königreich eine schreiende Ungerechtigkeit begangen wurde, war Friedrich zur Stelle, um den Bedrängten zu
helfen.
Bei den Armen war sein Gerechtigkeitsgefühl bald sprichwörtlich, und mancher hätte ihm gerne bereits zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Bei den Hütern des Unrechts war Friedrich jedoch verhaßt, und sie hätten ihn gerne aus dem Wege geräumt.
Die Gelegenheit dazu ließ lange auf sich warten, aber sie kam. Ein junger
Richter wollte sich einen Namen machen und war in das historische Fach gewechselt. Eifrig studierte er seine Quellen, darunter
alte Pfarrbücher, lud Zeitzeugen zu sich ein, verglich Bilder und – machte eine sensationelle Entdeckung: Jener Germar war nicht gefallen, auch nicht in Feindeshand geraten; jener Germar war identisch mit Friedrich, dem Anwalt der Armen!
Die Nachricht hiervon verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Königreich. Nur zu Friedrich gelangte sie
nicht mehr so rechtzeitig, daß er erneut hätte untertauchen können. Er wurde verhaftet! Und der junge Richter beschloß, auf seinen Richtstuhl zurückzukehren.
Als am Tage der Verhandlung Friedrich in den Gerichtssaal geführt wurde, war es wie ein Spießrutenlaufen.
Niemand schien mehr einen Friedrich zu sehen, sondern jeder einen Germar. Und so wurde er auch von dem jungen Richter
angeredet.
Ein Jugendverbrechen nach dem andern wurde hervorgezerrt und den gaffenden Zuschauern zu Kenntnis und Futter gegeben. Friedrichs Anwalt wurde immer kleiner, so ungeheuerlich waren die Anklagepunkte.
Schließlich versuchte er, Friedrichs Einsatz für die Armen und für die Gerechtigkeit ins Feld zu führen, doch vergeblich.
Das sei alles zur Tarnung und Täuschung geschehen, hielt der Richter dagegen. Friedrich sei nur seine Maske
gewesen, Germar dagegen das wahre Gesicht. Und so dachten anscheinend auch alle Zuschauer.
Das Urteil stand somit fest und mußte nur noch verkündet werden. Zuvor wollte der junge Richter jedoch dem
Angeklagten noch Gelegenheit geben, Reue zu zeigen.
„Herr Richter“, sagte Friedrich müde, „könnt Ihr mich überhaupt verstehen? Wißt Ihr, was Armut ist? Wißt Ihr, was es heißt, verachtet zu werden? Wißt Ihr, was Krieg heißt?“
Der junge Richter gab als Antwort nur ein abschätziges Lächeln, wollte eben das Urteil sprechen, da öffnete sich hinter ihm eine Türe, und der König trat herein. Entgegen des Richters und des Volkes Meinung entschied er auf Gnade: „Als freien Menschen
lade ich dich, Friedrich, in meine Residenz ein. Ihr aber, Herr Richter –“
„Das ist doch schreiende Ungerechtigkeit!“ unterbrach Don Birrone.
„So?“ entgegnete der Alte. „Der König hatte Friedrich
begnadigt; das Gericht aber wollte Germar verurteilen, und in diese Sache hat sich der König gar nicht eingemischt.“ Und er begleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *2.+6.12.2010, freigegeben am
10.7.2024
Qouz-Note: 2-
***
MamM 604 Welchen Wert {i108}
„Bei denen da drüben ist ein Menschenleben kaum noch was wert“, beschwerte sich Don Nevoso, anstatt sich zu erleichtern.
„So?“ bemühte sich der Alte von der Halbinsel, Interesse zu zeigen.
„Das könnt Ihr vor allem im Winter sehen“, leitete der Besucher seine Beweisführung ein. „Ich war kürzlich für 14 Tage drüben. Nach außen tun die ja immer so arrogant, als
könnten wir ihnen nicht das Wasser reichen. Ordnung, Pünktlichkeit – Ha, von wegen Pünktlichkeit! Kaum fällt bei denen ein bißchen Schnee, schon bricht alles zusammen. Als ob die gar
nicht wissen, daß Winter ist und es im Winter –“
„Bei uns schneit es ja auch nur in den –“
„Aber wir sind hier im Süden“, wandte Don Nevoso ein, „doch bei denen im Norden ist Schnee etwas Selbstverständliches. Was sollen denn die in Schweden oder Norwegen sagen?“
„Nichts“, antwortete der Alte. „Niemand soll etwas –“
„Doch!“ war der Besucher anderer Meinung. „Im Winter den
Schnee zu räumen, das ist wohl das mindeste, was verlangt werden kann. Jaha, die Chausseen werden auch geräumt, obwohl die Fuhrleute
und Kutscher doch mit Schlitten fahren könnten. Aber die Gehwege! Ja,
geräumt werden die schon! So ein bißchen. Untertanengehorsam ist in ihnen
schon drin –“
„In den Gehwegen?“ wollte der Alte seine Torheit nicht verbergen.
„Mittags werden auch die Gehwege geräumt“, ließ sich Don Nevoso nicht aufhalten. „Aber wie! Die Gehwege haben nämlich bei denen ein Gefälle, so daß das Regenwasser in die Gosse fließen kann. Aber wo wird der Schnee geräumt? – Ich will es Euch sagen: an der unteren Kante! So kann tagsüber das Schmelzwasser den Weg bedecken und abends und nachts zu Glatteis gefrieren. Ich geh’ ahnungslos daher, und auf einmal reißt es mir fast die Füße weg. Ich aber
sag’ mir: Nein, du willst nicht hinfallen! Du willst nicht! und fange an zu
laufen und zu springen. Und ich bin dann auch nicht hingeschlagen.
„Na, also“ zeigte der Alte wenig Verständnis. „Was regst du dich dann auf? Es ist doch –“
„Soll sich da einer nicht aufregen?“ hatte der Besucher eine andere Perspektive. „Ich hätte mir meine Knochen brechen, ja, sogar sterben können. Zumindest ist das
versuchte Körperverletzung –“
„Versuchte?“ griff der Alte auf. „Lagen sie im
Hinterhalt?“
„So weit kommt es noch!“ spielte Don Nevoso den Propheten. „Auch noch Schadenfreude empfinden! Aber so etwas ist im Menschen drin –“
„Ach“, staunte der Alte, „im Menschen? Also nicht nur bei bestimmten Völkern? Auch hier am Jardinisee?“
„Wahrscheinlich“, wollte sich Don Nevoso nicht festlegen. „Aber bei uns hier hat das Leben eines Menschen
wenigstens noch einen Wert. Aber bei denen: keinen Pfifferling! –“
„Weil du beinahe auf Glatteis hingeschlagen wärest?“ unterbrach der Alte. „Daraus schließt du das? Aus einem Einzelfall? Wirst du denn nicht künftig besser aufpassen?“
„Selbstverständlich werde ich besser aufpassen!“
„Vielleicht tun das die Einheimischen ohnehin“, ging der Alte weiter, „so daß sich die zum Schneeräumen Verpflichteten darauf verlassen –“
„So weit kommt es noch!“ bitterte der Besucher.
„Wer den Schaden hat, muß auch noch die Schuld tragen; und der Verursacher lacht sich
eins ins Fäustchen! Damit leistet auch Ihr der Entwertung der Menschen Vorschub!“
„So?“ war der Alte anderer Ansicht. „Allein – wer
entwertet wird, muß zuvor einen Wert gehabt haben. Wer ihm den wohl gegeben hat?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ aber eine Prinzessin, die suchte einen Mann, was ja nicht so selten ist. Juwelen, Schönheit, Macht,
von alledem hatte Welja genug; nur ein Mann, ein Ehemann, fehlte ihr noch in
ihrer Sammlung.
Nicht daß sie in einem Amazonenreich lebte. Auch an Verehrern mangelte es ihr nicht; allein – was konnte sie mit ihnen anfangen? Bevorzugte sie einen von ihnen, so waren
ihr die andern böse; und außerdem – so groß waren die Unterschiede zwischen den Männern nicht. Und konnte der eine was, so konnte der andere etwas anderes besser. Und wie schnell
so ein Mann allen Glanz verlor und – langweilte!
Nein, so etwas suchte Prinzessin Welja nicht. Sie wollte einen Mann haben, bei dem sie ihre Wahl niemals reuen
täte. Gegen den die andern nichts waren. Kurz: den Wertvollsten! Und damit es jeder lesen konnte, ließ sie ihren Wunsch in allen Landen ausrufen und anschlagen.
Da meldete sich alles, was Rang und Namen hatte? Nein, sondern nur, wer so viel von sich hielt, daß er sich
sicher war, nicht abgewiesen zu werden.
Zum Beispiel Krösorios Krösowski, der damals als der reichste Mann der Welt galt. Zwar war er noch ein wenig verheiratet, aber das ließe sich ändern, denn für ein kleines „Geschenk“ gebe es auf der Welt Beamte und Geistliche
genug, welche die nötigen Papiere absiegelten und absegneten. Allein – besonders wertvoll kam Krösorios Krösowski der Prinzessin nicht
vor, denn der ganze Reichtum erschien ihr als etwas Äußerliches.
Da war Professor Dr. mult. Dotto Dottissimo aus anderem Holze. Er galt als der gelehrteste Mann der Welt, obwohl – er seine Titel nicht mehr zählen konnte; denn jedes Jahr kam mindestens eine Ehrendoktorwürde hinzu.
„Mh“, überlegte die Prinzessin, als sich der berühmte Gelehrte dazu herabließ, sich ihr vorzustellen, „was habe ich eigentlich davon, wenn ich seine Frau wäre? Viel Licht oder viel Schatten?“
Und weil ihr auf diese Frage nicht gleich die richtige Antwort einfiel, ließ sie sich noch einen 3. Kandidaten vorstellen: Manuel! Oh weh, was roch dieser Mann nach seinem Beruf! Und dieser Beruf galt schon damals
nicht mehr als besonders angesehen. Manuel war nämlich Schäfer, aber deshalb nicht von einem Mangel an Selbstvertrauen
heimgesucht.
„Gnädige Prinzessin“, kam er gleich zur Sache, „ich bin dem lieben Gott wertvoller denn alle Schätze dieser Welt. Genau wie auch Ihr –“
„Und was machen die Atheisten?“ konnte Don Nevoso nicht mehr an sich halten.
„Die müssen eben ihren Wert von der Menschen Meinung abhängig machen“, antwortete der Alte und geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *10.-11.12.2010, freigegeben am 12.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 605 Die unbequeme Fee {i109}
„Wenn ich so was sehe, dann – dann“, Don Ribellino suchte nach dem passenden Ausdruck, „dann könnte ich aus der Haut fahren!“
„So?“ begriff der Alte von der Halbinsel nicht. „Bist du eine Schlange?“
„Nein“, antwortete der Besucher prompt. „Doch weiß ich manchmal selber nicht, ob mein Zorn göttlich oder –
oder –“
„Das ist ganz einfach“, bot der Alte Hilfe an. „Bist du Gott, so ist dein
Zorn göttlich; bist du ein Mensch, so –“
„Aber es verträgt sich nicht mit mir“, wollte sich Don Ribellino lieber selber beistehen. „Dieser – dieser
Opportunismus! Und das in der Kirche! Ihr könntet ihnen eine schwarze Messe
lesen, und sie täten auch dazu ihr Amen sagen.“
„Na ja“, versuchte der Alte die Wogen zu glätten, „solch einen Versuch will ich lieber nicht wagen. Sie nennen
es gewiß Nachfolge –“
„Von wegen Nachfolge!“ war der Besucher anderer Ansicht.
„Doch“, schien der Alte den Verteidiger spielen zu wollen, griff nach seinem alten Buch, blätterte und reichte es Don Ribellino. „Hier, wie liesest du?“
„Und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht.“ Der Besucher schaute den Alten fragend an: „Wollt Ihr sie etwa in Schutz
nehmen?“
„Gerne“, überraschte der Alte, „denn sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie wähnen, dem Lamme nachzufolgen, und trotten doch nur Menschensatzungen hinterher.
Heute in diese Richtung, weil dieser geehrt sein möchte; morgen in jene Richtung, weil jener geehrt sein –“
„Also gebt auch Ihr zu“, fühlte sich Don Ribellino bestätigt, „daß sie alle Opportunisten sind.“
„Alle?“ ging der Alte nicht mit. „Das klingt zu
hoffnungslos.“
„Sie fühlen sich aber als alle“, bitterte der Besucher.
„Bist du keiner?“ fragte der Alte.
„Ach“, bekümmerte sich Don Ribellino, „manchmal denk’ ich es –“
„– in der Kummerhöhle“, ergänzte der Alte, „und hast es dort genauso dunkel wie alle –“
„Wie das ändern?“
„Hier, wie liesest du?“
„Mache dich auf, werde licht! – Ein altes und bekanntes Wort; was soll es mir helfen?“
„Soll?“ blieb der Alte wieder hängen. „Nichts sollen es
und du! Du darfst aus deiner Kummerhöhle treten und –“ Ja, und nun begann der Alte wieder zu erzählen:
Es wandelten die Menschen in tiefer Finsternis; denn es war gerade die Jahreszeit, da die Sonne kaum noch über
die Berge klettern konnte und dicke Wolken das Licht verschluckten.
Und die Menschen irrten ziellos umher und stießen sich und froren. Da traten unter ihnen gewaltige Herrscher
auf, die befahlen, die Menschen sollten sich an der Hand nehmen und lange Ketten bilden und ihrem Herrscher folgen, wo er hinginge;
anderenfalls müßten sie als Einzelgänger sich verirren und verschmachten.
Und die meisten Menschen sprachen: „Das ist ein guter und kluger Befehl, denn nun müssen wir nicht mehr selber den Weg suchen.“ Und sie gehorchten und freuten sich der großen Bequemlichkeit. Und weil jeder eine
Hand dem Vorangehenden und eine Hand dem Nachfolgenden gab, konnten sie keine Waffe führen und waren friedlich.
Zwar konnten sie immer noch nicht sehen, wo es hinging, aber es war ihnen, als gehe es immer weiter vorwärts.
Und sie merkten nicht, daß sie im Kreise geführt wurden, und ihre Herzen erstarrten vor Kälte.
Es traten zwar hin und wieder Menschen auf, die hatten ein kleines Licht. Und diese erkannten, daß es nicht
nach Hause ging. Und sie warnten ihre Mitmenschen.
Aber die Herrscher hatten größere Macht und nannten die Warnenden Aufwiegler, Unruhestifter und Irrlichter.
Und die meisten Menschen glaubten ihren Herrschern; denn wie hätten diese sonst Herrscher werden können, wenn sie nicht die höchste
Erkenntnis gehabt hätten? Außerdem konnte eine so große Mehrheit unmöglich irren. Und Wärme ging von den Warnern auch nicht aus. Und weil diese keinen Erfolg sahen und
keine Anhänger fanden, verbitterten sie, löschten ihre Lichter und verschwanden in der Finsternis, oder sie schlossen sich der Mehrheit an.
Nun war aber in dem Lande zu der Zeit eine Fee, die hieß Hildegard. Eine gute Fee? Na, der Name klingt bereits sehr kriegerisch; und ob alles richtig war, was sie tat,
will ich nicht beurteilen. Ist es etwa richtig, sich dort hinzustellen, wo die Menschen vorbeimüssen, und ihnen dann ungesunden Rauch
ins Gesicht zu – Nun, ich will es nicht vertiefen. Oder grußlos an – Schweigen wir darüber. Oder Katzen und Hunde auf den Weg – Nein, ich hab’ es nicht gesehen. Aber eines
weiß ich, die Fee hat ein gutes Herz. Und es jammerte sie der Menschen in deren Finsternis und Kälte.
Da ließ sie über ihnen ihr Herz aufgehen, leuchten und wärmen. Und wer von den Menschen seine Augen aufhob und
das Herz gewahrte, der freute sich in seinem Herzen und wurde selber zu einem wärmenden –“
„Aber bestimmt nur eine kleine, sehr kleine Minderheit“, unterbrach Don Ribellino, „wie ich die Menschen kenne. Mag’s in Eurem Mährchen zu einem guten Ende führen, in Wahrheit ist doch alles für die –“
„Vergiß nicht die Wärme“, erinnerte der Alte und geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *16.-17.12.2010, freigegeben am 12.7.2024
Qouz-Note: 3+
***
MamM 606 Das Licht der Sterne {i110}
„Das ist doch ein Skandal!“ empörte sich Don Probolino. „Daß da niemand
einschreitet!“
„So?“ bezeugte der Alte von der Halbinsel mal wieder seinen Mangel an Erkenntnis.
„Über die Friedhofsmauer sind sie geklettert, Grabschmuck haben sie niedergetreten, Grabsteine umgeworfen –“
„Sie?“ war der Alte nicht wesentlich klüger geworden.
„Die Journalisten!“ wurde der Besucher deutlicher.
„Und wozu?“
„Habt Ihr denn gar nichts davon gehört?“ wunderte sich Don Probolino. „Aber wie solltet Ihr auch? Eine Krähe hackt der
anderen kein Auge aus. Über ihre eigenen Fehler berichten die nicht –“
„Sie sind eben Menschen“, unterbrach der Alte.
„Und was für welche!“ bitterte der Besucher. „Es sollte
eine Beisetzung im engsten Familienkreis sein, aber da nehmen die doch keine Rücksicht. Die haben daraus – ja, die haben aus der
Beisetzung ein Schauspiel gemacht! Ganz genau wollten sie darüber berichten: ob ihr die Tränen kamen; ob sie einen schwarzen Schleier getragen; ob sie gezittert; ob und wann sie ein Taschentuch gebraucht hat; ob sie sich ins Grab stürzen
wollte; wer ihr den Arm geboten hat; ob –“
„Sie?“ konnte der Alte kaum folgen. „Wer ist
SIE?“
„Eine berühmte – eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Gegenwart“, antwortete Don Probolino. „Fast jeden
Monat haben die Zeitungen über sie berichtet –“
„– sie also berühmt gemacht“, dachte der Alte weiter.
„Das seht Ihr nicht falsch“, pflichtete der Besucher bei. „Gewiß hat sie viele Jahre von dieser Aufmerksamkeit
profitiert. Wer bekannt und berühmt ist, kann auch höhere Gagen –“
„Es hat auf Erden alles seinen Preis“, dachte der Alte laut.
„Und manchmal kommt es noch zu einer unerwarteten Nachforderung“, ergänzte Don Probolino. „Das hat sie bestimmt vorher nicht geahnt –“
„Zauberlehrling!“ kam es dem Alten spontan über die Lippen.
„– und sich selbst verkauft“, ergänzte der Besucher.
„Ja, sie tut mir leid“, bekannte der Alte. „Sie hat wohl gedacht, nur ihre Auftritte, allenfalls noch ihre
Interviews zu verkaufen, aber in Wahrheit – Wie in einer Zelle, die an allen Seiten Gucklöcher hat und Tag und Nacht erleuchtet ist. Ein zu hoher Preis! Ob sie die rote Farbe nicht gesehen hat?“ Und er begann zu erzählen:
Wohl jeder Mensch gelangt in seinem Leben zu Wegverzweigungen, an denen er sich entscheiden muß. Zuweilen
stehen dort Wegweiser; aber wer weiß, ob sie richtig aufgestellt sind?
Zuweilen gibt es Führer; aber wer weiß, ob sie den richtigen Weg kennen und das rechte Geleit geben wollen? Mancher folgt aber auch einem Stern; doch auch da weiß kein Mensch, ob dieser Stern
zum rechten Ziel führt und der Weg dorthin auch gangbar ist.
So auch Miranda. Sie hatte sogar die Wahl zwischen 2 Sternen. Der eine war sehr hell und gefiel ihr auf Anhieb. Sie war nämlich ein sehr schönes
Mädchen und legte auf ihre Schönheit großen Wert. Deshalb hatte sie auch stets einen Spiegel zur Hand, um sich darin zu mustern und zu
bewundern. Und dazu kam ihr der 1. Stern gerade recht!
Denn als Miranda sich in seinem Licht betrachtete, war es ihr, als sähe sie noch vorteilhafter aus. Gut,
Geschmäcker sind verschieden und verändern sich mit der Zeit. Allein – damals war anscheinend keine blendend weiße Haut in Mode,
sondern eine gebräunte. Und da das Licht des Sterns in das Rötliche spielte, empfand Miranda, daß dadurch ihre Reize deutlich verstärkt
wurden.
Doch damit nicht genug: Der Stern hatte noch weitere treffliche Eigenschaften. Diese erkannte sie, als sie
sich auf den Weg machte. Denn der Stern stand nicht fest, sondern sie konnte hingehen, wohin sie wollte, stets folgte ihr der Stern und
zeigte sie in vorteilhaftem Licht. Zumindest wenn sie sich in ihrem Spiegel betrachtete und bewunderte!
Und das konnte kein Trugbild sein; denn wenn sie unter die Menschen ging, waren auch diese der Bewunderung
voll. Wie viele Männer sie ob ihrer Schönheit vergötterten, konnte sie bald nicht mehr zählen. Und in manchem weiblichen Blick gewahrte sie Neid und Eifersucht.
„Die schlechtesten Früchte sind es nicht, woran die Wespen nagen“, sprach sie dann zu
sich und setzte ein siegesgewisses Lächeln auf.
Und wie häßlich ihre Rivalinnen waren! Das mußte auch eine besondere Eigenschaft dieses Sternes
sein. Denn an allen, die Miranda bewunderten und lobten, fielen ihr die guten Seiten auf; an allen, die sie tadelten, die schlechten. Sonderbar!
Und noch etwas war sonderbar: Miranda schien nicht zu altern. Obwohl sie längst zu zählen aufgehört hatte, wie
oft sie wieder an ihrem Ausgangspunkt vorübergekommen war. Die Zeit war ihr wie im Fluge vergangen und hatte ihr vermutlich doch nichts
anhaben können.
Wieder einmal gelangte sie zu ihrem Ausgangspunkt. Eigentlich konnte sie mit ihrem Stern ja zufrieden
sein. Allein – hatte sie denn vergleichen können? Und aus einer spontanen
Eingebung heraus – gewiß nicht frei von Neugierde, eh, Wissensdurst – vertraute sie sich plötzlich dem andern Stern an.
Auf den 1. Blick eine sehr dumme Entscheidung, denn an Helligkeit blieb der Stern des Lebens weit hinter dem 1. Stern zurück. Auch ordnete er sich keineswegs Mirandas Wünschen und Schritten unter, sondern ging vor ihr her, anstatt ihr zu folgen. Und dabei wählte er gewiß nicht den bequemsten Weg. Er war schon
anstrengend; und wenn sich Miranda in ihrem Spiegel betrachtete, sah sie sich in einem weniger vorteilhaften Licht.
Und doch – je mehr sich Miranda auf den Stern des Lebens einließ, desto lieber ward er ihr. Sein Licht war
freundlicher, und das nicht nur bei ihr. Denn wenn sie auf die Menschen blickte, die mit ihr dem Stern folgten, so gewahrte sie an
ihnen auch Flecken und dunkle Seiten. Aber alles das erschien ihr in einem versöhnlichen Licht.
Und – der Stern des Lebens hatte noch eine besondere Eigenschaft: Er wärmte! Er wärmte das Herz – nicht nur
das Mirandas, sondern auch das der Mitwandernden. Und Schnee und Eis zerschmolzen zu klarem Wasser.
Und ein Sehnen ergriff die Herzen der Wandernden, und schneller ging ihr Fuß. Und ward der Weg zu schwer oder
die Kraft zu klein, dann faßten sie sich an der Hand und halfen einander. Und endlich waren sie zu –
„Märchen! Unlogische Hirngespinste!“ unterbrach Don
Probolino. „So etwas führt uns nicht weiter –“
„Weiter?“ griff der Alte auf. „Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen.“ Und er geleitete den
Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *31.12.2010+3.1.2011,
freigegeben am 12.7.2024
Qouz-Note: 2
***
MamM 607 Die größte Sünde?
„Welche ist die größte Sünde?“ fragte Don Notarino den Alten von der Halbinsel. Da dieser aber – unwissend wie
immer – mit seinen Schultern zuckte, mußte der Besucher selber seiner Meinung den Weg bahnen: „Wenn Ihr mich fragt, ist es sicherlich der Mord.“
„So?“ blieb der Alte in seiner bekannten Deckung.
„Sicherlich? Bist du dir da sicherer als sicher oder unsicherer?“
Was macht jemand, der eine Frage nicht recht zu deuten weiß und argwöhnt, auf den Arm genommen zu werden?
– Don Notarino fragte diesenfalls zurück: „Oder welche Sünde haltet Ihr für die größte?“
„Keine“, antwortete der Alte, „weil ich meine Hände lieber zu anderem gebrauche. Ich achte, es ist besser,
Sünden loszulassen, denn zu halten. Bei den Christen gebe es allerdings eine Sünde, die nicht vergeben werden könne, aber die begreife
ich nicht, und deshalb möchte ich auch sie nicht –“
„Es soll eine Sünde geben, die noch schlimmer ist als Mord?“ zweifelte der Besucher sehr.
„Soll?“ entdeckte der Alte mal wieder sein Reizwort. „Im
Sollen bin ich kein Fachmann. Dazu frag besser Richter und Staatsanwälte.
Für mich sind das keine erstrebenswerten –“
„Aber was sollten die Menschen ohne sie machen?“
„Sollten?“ brummte der Alte. „Mag ja sein, daß sie am
Ende ihres Lebens eine Antwort auf die Frage wissen: Wem hast du seine Bürde leichter gemacht? Ich täte mir jedenfalls sehr schwer damit. Vielleicht bin ich für solche Berufe zu
sündig. Ich halte mich lieber an die Bergpredigt: Richtet –“
„Aber Richten hat auch mit Ausrichten zu tun“, unterbrach der Besucher. „Ihr müßt Euch doch nach etwas
ausrichten –“
„Freilich“, gab der Alte sogleich zu. „Aber nicht an einer Hierarchie von Sünden, sondern – Hier, wie
liesest du?“
Damit schlug er sein abgegriffenes Buch auf, reichte es Don Notarino und deutete auf die Stelle: Ihr sind viele Sünden vergeben, denn
sie hat viel geliebt. – Dir sind deine Sünden vergeben.
„Das ist meine Ein-Richtung und Ent-Scheidung.“
„Aber das wäre –“, wandte der Besucher ein, „das wäre sehr ungerecht! Nein, das kann nicht christlich
sein. Da kann also eine ihr ganzes Leben lang drauflossündigen, sogar den Namen Sünderin bekommen, und steht dann über einem, der sein
ganzes Leben lang rechtschaffen war? Nein, das kann ich nicht glauben –“
„Hier, wie liesest du?“ Der Alte hatte indessen eine andere Stelle aufgeschlagen: – und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und
ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.
„Dann sollten also alle guten Werke, ein Leben frei von Lastern“, zweifelte Don Notarino, „vergeblich sein?“
„Schon wieder sollen?“ seufzte der Alte; dann blickte er
den Besucher mitleidig an: „Welches Werk eines Menschen ist frei von Eitelkeit, Eigenliebe, Götzendienst?“ Und er begann zu
erzählen:
Es hätte aber eine Königin 3 Töchter. Doch alle 3 hatten sie schwer
enttäuscht; und hätte sie nicht am Gesicht ihrer Töchter die Ähnlichkeit mit Vater und Mutter gewahrt, so hätte sie zweifeln müssen, ob
das Wesen von ihrem Wesen sei.
Dennoch wollte die Königin, daß Krone, Thron und Zepter in der Familie blieben. Wem aber konnte sie das Reich
anvertrauen?
Lange sann sie darüber nach. Der Klügsten? Der
Begabtesten? Der Schönsten? Oder derjenigen, deren Sündenregister am
wenigsten wog? Da stolperte sie eines Tages über jene Begebenheit, die ich dir eben gezeigt habe. Sei es, daß sie der Hofprediger erwähnt hatte; sei es, daß sie’s selber in der
Bibel gelesen hatte. Und es sank ihr ins Herz, faßte Fuß und gedieh.
Lieben! Viel lieben! Wen? Mich? Das Volk? Wie aber
das herausfinden? Wie in jenem Märchen von der Gänsehirtin? Nein, das waren nur Wörter; und Wörtern ist schwer anzusehen, ob sie gedeckte Versprechungen
oder ungedeckte Versprecher sind.
Also einen Versuch anstellen? Versuch – versuchen – Versuchung? Nein, das war immer künstlich und mit Täuschung verbunden, deren Frucht Enttäuschung war. Also?
Diese Gedanken bewegend, blickte sie eines Tages aus dem Fenster ihres Kabinetts. Colposino! Bettelte, statt zu arbeiten! Da hatte sie endlich die
Gelegenheit!
Sogleich ging sie in das Musikzimmer, wo gerade ihre älteste Tochter sich im Geigenspiel übte. Nein,
Violina hatte nichts gegen eine Unterbrechung einzuwenden und machte sich auf den Weg zum Markt, um dort noch ein Brot zu kaufen.
Gespannt verbarg sich die Königin am Fenster ihres Kabinetts. Violina erblickte den Bettler, zuckte mit den
Schultern, wandte sich ab und eilte weiter.
„Was wollte denn Colposino von dir?“ fragte die Königin ihre Tochter nach deren Rückkehr.
„Ach, ich hab’ gar nicht richtig hingehört“, gestand Violina. „Bestimmt wollte er Geld. Aber das fördert
doch nur das Nichtstun.“
Die Königin ging nun in das Malzimmer und erteilte ihrer 2. Tochter den gleichen Auftrag. Auch
Colorina sah den Bettler, schien jedoch von dem Anblick sehr angewidert zu sein.
Das bestätigte sie nach ihrer Rückkehr: „Stell dir vor, Mutter, wen ich getroffen habe! Colposino, diesen –
diesen Säufer! Eine Schande für die ganze Residenz! Und wie seine Lumpen
stanken! Igittigittigitt! Den tät’ ich noch nicht mal mit der Zange
anfassen! Solch ein Geschmeiß müßte auf dem –“
Mehr hörte die Königin nicht, denn sie ging nun in die Bibliothek, wo sie ihre jüngste Tochter vorfand.
„Ach, Mutti“, begehrte Sonjarina auf, ohne von ihrem Buch aufzublicken, „es ist gerade so spannend! Kann nicht eine Magd für mich zum Markt laufen?“
Die Königin mußte am Fenster lange warten. Endlich sah sie Sonjarina. Mit Buch! Den Bettler schien sie gar nicht zu bemerken. Erst als sie mit dem Brot zurückkam. Aber – aber was tat sie da? Gab das Brot einfach dem Bettler! Freute sich sogar, wie es ihm schmeckte! Und dann – dann half sie ihm auf! Und – und führte ihn – führte ihn in das
Schloß! –
„Na, das wär’ mir aber eine wunderliche Königin“, unterbrach Don Notarino, „welche die Bettelei auch noch belohnt –“
„– und das mit Gaben, die ihr gar nicht gehören“, ergänzte der Alte. „Ja, es ist schon eine wunderliche
Königin, die ihrem Volk die Nächste ist! Bei den Menschen scheint so etwas
unmöglich, aber –“, und er geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *6.+7.+10.1.2011, freigegeben am 13.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 608 Auf den Spuren zurück
„Habt Ihr schon gelesen?“ mußte sich Don Notarino erst einmal sammeln. „Einfach abgeknallt! Hat die Pistole gezogen und einfach abgedrückt –“
„Wozu werden Pistolen eigentlich hergestellt und verkauft?“ bremste der Alte von der Halbinsel den Redeschwall.
„Zum – zum Schießen“, antwortete der Besucher zögernd. „Was Hersteller und Verkäufer aber selten offen
zugeben. Sie zeigen lieber Bilder oder führen die Waffen vor –“
„– und überlassen es dem Käufer“, ergänzte der Alte, „von dieser Frucht zu essen. Das alte Lied: Schlange,
Mensch und – der Wahn, wie Gott zu sein. Und nach der Tat die Ohnmacht, doch kein –“
„Und die Schuld!“ war es Don Notarino wichtiger, zu reden, statt zuzuhören. „Also, wenn Ihr mich fragt: Dieser Mann hat sein Leben verwirkt –“
„– verpfuscht“, verbesserte der Alte.
„Nicht nur das, sondern verwirkt!“ beharrte der Besucher. „Ihr wißt, ich bin kein Freund der Todesstrafe, aber
hier ist alles offensichtlich. Daß dieser junge Mann der Täter war, ist unbestritten. Daß er schuldig ist, –“
„Allein schuldig?“ zweifelte der Alte. „Eben sprachen wir noch von der Schlange –“
„Na und?“ sah Don Notarino keinen Einwand. „Wie war es
denn bei dem 1. Sündenfall? Die Folge: Die Menschen mußten sterben.
Gott selbst –“
„Gott!“ griff der Alte auf. „Das Todesurteil war eine
Sache Gottes, nicht eines Menschen. Verhängt aber ein Mensch die Todesstrafe, – ist das nicht ein
neuer Sündenfall?“
Hat nicht Pinehas, ja, hat nicht sogar Petrus –“
„Vielleicht haben sie es hinterher bereut“, ließ sich der Alte nicht überzeugen. „Sie waren beide sehr
hitzig. Und ob Petrus wirklich strafen wollte –“
„Und in beiden Fällen lag noch nicht einmal ein Mord vor“, unterbrach der Besucher.
„Baust du dir wieder eine Sündenhierarchie?“ seufzte der Alte. „Übrigens ist mir noch eine Antwort auf deine zur größten Sünde Frage eingefallen: Meine größte Sünde ist diejenige, die ich für die kleinste
halte.“
„Das seh’ ich anders“, erwiderte Don Notarino. „Die größte Sünde ist der Mord –“
„– weil du wähnst, noch keinen begangen zu haben“, ergänzte der Alte, „oder keinen kennst, der dir lieb und wert ist und Schuld auf sich geladen hat.“ Und er begann zu erzählen:
Cattivino hatte getötet. Leben getötet. Menschen getötet. Er hatte die Waffe geführt, den Tod somit verursacht, und er hatte
den Tod gewollt. Zumindest kurz vor der Tat.
Und nach der Tat? Den Richtern kam dieser – dieser Unmensch völlig verstockt vor. Kein Zeichen von Reue! Keine Tränen! Versteinertes Gesicht – bis auf die Augen! Die flackerten hin und wieder
wild; und hefteten sich die Blicke dieser Bestie auf Richter, Staatsanwalt oder Publikum, so schienen sie zu sagen: Ihr seid auch nicht
besser als ich.
Die Richter taten zwar entsetzt über soviel Brutalität, aber innerlich waren sie’s zufrieden. Denn so fiel
ihnen das Urteil leicht: schuldig – und als Strafe die Hinrichtung. Keine Gewissensbisse. Und wer unter den Richtern an Gott glaubte, fühlte sich von diesem berufen und dessen rechtes Werkzeug zu
sein.
Damit die Strafe vollzogen werden konnte, mußte das Urteil damals dem König vorgelegt und von diesem unterschrieben werden. Dieser König war jedoch kein Freund der Todesstrafe und suchte in jedem Fall nach Argumenten, die Strafe zu
mildern oder den Verurteilten sogar begnadigen zu können.
So auch dieses Mal. Aufmerksam las der König die Gerichtsprotokolle. Er befrage Augenzeugen, er wälzte sich nachts stundenlang hin und her und grübelte und grübelte.
Endlich ließ er sich den Schlüssel zur Todeszelle geben, schloß auf, sah Cattivino in die Augen, und –
Cattivino erhob sich. Er wußte selbst nicht, warum er dies tat. Er verließ die Zelle, folgte dem Fremden, und niemand gebot Einhalt. Ob der Fremde
die Wächter bestochen hatte? Sehr wohlhabend sah er nicht aus. Nein, zu
holen war bei dem bestimmt nichts. Aber er hatte etwas Gebieterisches an sich. Wo er das nur hernahm? Ob er auch einmal –?
„Du führst mich jetzt den Weg zurück, den du gegangen bist!“ Wieder dieses Gebieterische.
„Da, da war diese“, stammelte der Todeskandidat, „dieses Hexenhaus. Aber – aber schau IHR bloß nicht in die
Augen! Sonst wirst du ganz klein und willenlos. Und – und tust alles, was
SIE dir sagt. Ja, sogar das, von dem du nur vermutest, daß sie es so will.“
Aber als die beiden Wanderer das Hexenhaus betraten, da hielt sich der Fremde nicht an diesen Rat, sondern sah der Hexe in die Augen und sah –
„Aber – aber von dieser Seite“, war die Hexe ganz entsetzt, „kommt niemand wieder! Wer seid
Ihr? Was seht Ihr mich so an? Wie – wie wird mir mit einem Mal?“ Und die Hexe mußte die beiden bewirten und ihnen ein Obdach geben und hatte keine Gewalt über sie. Ja, sie hatte sogar alle ihre Hexenkünste vergessen.
„Und dann“, erzählte Cattivino am nächsten Morgen, „war ich im wilden Wirtshaus. Also bevor ich zu dieser Hexe kam! Aber – aber du darfst dort nichts trinken, sonst
verlierst du jede Gewalt über dich.“
Aber als die beiden Wanderer das wilde Wirtshaus betraten, da hielt sich der Fremde nicht an diesen Rat, sondern sah dem Wirt in die Augen und sah –
„Aber – aber von dieser Seite“, entsetzte dich der Wirt, „ist noch niemand zurückgekommen!“ Und er lief zum
Brunnen und schöpfte frisches Wasser und gab es seinen beiden Gästen. Und die Gläser mit den Giften und berauschenden Getränken
zersprangen, und ein starker Wind nahm alles, was schaden konnte, auf und trug es fort.
„Und davor“, erzählte Cattivino, „bin ich in der Spielhölle gewesen. Aber – aber du darfst kein Geld setzen,
sonst verlierst du alles!“
Und als die beiden Wanderer die Spielhölle betraten, da verschloß der Fremde seine Geldkatze und gab den Schlüssel dazu
Cattivino. Und der Fremde sah dem Bankhalter in die Augen und sah –
„Aber – aber von dieser Seite“, war der Bankhalter bestürzt, „ist noch niemand zurückgekommen!“ Und er gab
Cattivino alles wieder, was er diesem einst abgenommen hatte.
„Und – und ausgezogen bin ich“, brachte Cattivino zögernd hervor, „ach, es ist zu beschämend!“ Und er führte
den Fremden auf ein großes Schloß.
„Hier – hier war ich einmal zu Hause“, betrübte sich Cattivino. „Ich war der jüngere Sohn und wäre nur König
geworden, wenn – Also ließ ich mir mein Erbe auszahlen; und den Weg, den ich dann gegangen bin, kennt Ihr –“
„Bruder!“ Und der Fremde schloß den Todeskandidaten in seine Arme. „Hab’ ich dich endlich wie–“
„Ach“, seufzte Cattivino, „wenn ich das gewußt hätte, wie lieb –“
„Was soll’s?“ fuhr Don Notarino dazwischen. „Was
geschehen ist, das ist geschehen! Er hat sein Leben verwirkt!“
„Sagt der Richter“, ergänzte der Alte. „Aber ein König und Gott
gestatten, zu leben.“ Und er geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *13.-14.1.2011, freigegeben am 13.7.2024
Qouz-Note: 2-
***
MamM 609 Der Glücksweg
„Ach“, schaute Don Abbassino zu Boden, „es ist immer das gleiche –“
„So?“ zweifelte der Alte von der Halbinsel.
„Erst kommen die guten Vorsätze“, fuhr der Besucher fort, „wir glauben, Bäume ausreißen zu können; und dann
kommen auch schon die trüben Tage des Januar, und die Sorgen haben uns wieder.“
„Tscha“, kalauerte der Alte, „das kommt von der Vielweiberei! Was läßt du dich auch –“
„Bei dem Wetter?“ rechtfertigte sich Don Abbassino.
„Keine Sonne zu sehen –“
„Das liegt am Standpunkt“, ließ es der Alte nicht gelten. „Ein Fuß über der
dicksten Wolke scheint –“
„Kann ich etwa fliegen?“
„Hast du keine Phantasie?“
„Phantasie – phantasieren – Phantasten“, verband der Besucher.
„Dann bekümmere dich weiter selber“, widersetzte sich der Alte seinem eigenen Rat.
„Das möchte ich natürlich auch nicht“, gab Don Abbassino zu. „Aber was soll ich bei solch einem Wetter
tun? Das treibt einem die schönsten Träume –“
„Soll?“ rieb sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort. „Nichts sollst du. Als ob ich dir Vorschriften –“
„Und was tut Ihr bei solchem Wetter?“
„Ganz einfach“, antwortete der Alte. „Melodien, die mir nicht gefallen, pfeife ich nicht nach –“
„Und wenn es keine anderen Melodien gibt?“
„Wenn eine Bedingung oder Annahme nicht zutrifft“, blieb der Alte gelassen, „dann ist es müßig, weiter darüber nachzudenken. Natürlich gibt es andere Melodien! Hör nur die Meisen, das Rotkehlchen, die
Spatzen! Bald wird Herr Amsel singen! Und dann die vielen schönen
Lieder in unserer Erinnerung: ein Schatz, den du nur zu heben –“
„Den Vogel, der zu früh singt“, blieb der Besucher in seiner Kummerhöhle, „holt am Abend
die Katze –“
„– wenn er sich in Gefahr begibt“, ergänzte der Alte. „Schwingt er sich aber in die Lüfte, so wird er erleben:
Katzen können nicht fliegen. Katzen fangen nur, was trübsinnig oder unvorsichtig an der Erde bleibt.“ Und er begann zu erzählen:
Auch so ein altes Lied, was ich schon in unzähligen Variationen erzählt habe: Ein junger Mensch steht am Scheidepunkt und fragt sich: Was und wer werde
ich?
Hier war’s Antonio, der sich diese Frage stellte. Eine
Fee hatte ihm 3 Wege geöffnet, doch welcher von ihnen war der beste? Welcher der
richtige?
Da kam Antonio ein guter Gedanke! Kurzerhand bat er die Fee, ihm doch Menschen zu zeigen, die den einen oder
anderen Weg gegangen waren.
Die Fee war’s zufrieden, packte Antonio an dessen Kragen, und hast du nicht gesehen, setzte sie ihn auf dem 1. Weg ab – eine große Strecke vom Ausgangspunkt
entfernt.
„Warum bringst du mich nicht bis ans Ziel?“ fragte Antonio. Die Antwort konnte er sich bald selber geben, denn er war auf dem Weg zum Reichtum abgesetzt worden, und dieser hat kein Ziel.
Sicher – die auf diesem Wege vorwärts hasten, setzen sich Etappenziele. Aber kaum haben sie diese erreicht,
müssen sie erkennen, daß der Weg weitergeht und andere bereits ansetzen, sie zu überholen.
Da bleibt keine Zeit für fröhliche Lieder. Zwar kommen solchen Reisenden Melodien über die Lippen, aber nicht
aus dem Herzen. Die Töne wollen nur ablenken und in Sicherheit wiegen, während diese Reisenden ihre Hände in die Taschen ihrer
Mitmenschen stecken.
Und oft ist es so, daß einer einem andern etwas aus der Tasche nimmt, während er selbst von einem 3. bestohlen wird.
Nein, mußte Antonio gewahren, glücklich sehen die nicht aus, die diesen Weg wählen; höchstens zuweilen
stolz. Stolz wie ein Pfau, der nicht bemerkt, wie ihm die schönsten Federn bereits gerupft werden.
Und der 2. Weg? Auch der hatte kein Ziel, obwohl diejenigen, die auf ihm wandeln, wähnen, große Fortschritte
gemacht zu haben. Es ist der Weg der Erkenntnis und Unwissenheit, auf dem Antonio wiederum viel stolzes Getue antreffen
konnte.
Allein – es gab auch manche Besonderheit. So trug jeder, der hier vorwärtskommen wollte, Scheuklappen, die
sein Gesichtsfeld einengten.
„Wozu tun die das?“ fragte sich Antonio und hörte sich um.
„Um besser sehen zu können“, bekam er zur Antwort. „Das schärft den Blick.“
Aber Antonio hielt bald einen anderen Zweck für entscheidender: Was die Gelehrten nicht begreifen konnten, das wollten sie nicht mehr sehen; und was sie nicht mehr sahen, das gab es für sie gar nicht.
„Das ist ja Selbstbetrug!“ urteilte Antonio und weigerte sich künftig, den Respektzoll zu entrichten.
Und glücklich – glücklich schauen diejenigen, die auf dem Weg der Erkenntnis und Unwissenheit wandeln, auch nicht aus. Eher wie solche, denen immer etwas mangelt. Und zu diesem Etwas gehören gewiß das
Lachen und Fröhlichsein, denn das ist bei ihnen verpönt und gilt als töricht. Nein, auch dieser Weg gefiel Antonio nicht; hoffentlich war der 3. Weg anders! Und den wollte er von Anfang an gehen.
Die Fee war’s zufrieden. Doch bevor Antonio von ihr auf die Wanderung geschickt wurde, mußte er sich richtig
rüsten: derber schwarzer Anzug, derbes Schuhwerk, Schultereisen, Sack, Besen und auf dem Kopf ein Zylinder.
War das wunderlich! Einerseits in Sack und Asche, andererseits
herrschaftlich! Zum Schluß erhielt Antonio noch eine Leiter und einen besonderen Besen; und die Fee murmelte noch dazu: Nun trage Antonio auch eine Sonne. Und los ging die
Wanderung.
Die lustige Wanderung! Denn du ahnst es schon: Antonio ging nun den Weg der Schornsteinfeger und
Glücksbringer. Glücksbringer? – Tscha, zunächst mußte Antonio viel
lernen. Schwindel zu bannen, das Gleichgewicht zu halten, die Besen zu gebrauchen und es zu vermeiden, schädlichen Rauch
einzuatmen.
Und bald brachte er den Menschen wirklich Glück. Der Rauch zog wieder durch den Schornstein, die Feuergefahr
wurde gebannt, und die Menschen konnten wieder heizen, braten und kochen. Und wer’s noch nicht recht zu tun wußte, dem brachte es
Antonio bei. Ei, war das eine Freude!
„Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?“ riefen ihm die Kinder nach.
„Niemand! Niemand!“ antwortete er und lachte, daß selbst der Kleinste seine Angst
verlor und jubelnd krähte. Und –
„– wenn alle Schornsteinfeger wären?“ unterbrach Don Abbassino.
„Dann könnten sich wohl alle wärmen“, antwortete der Alte, „und hätten weniger Angst vor Kälte und dunklen Tagen.“ Und er geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *20.-21.1.2011, freigegeben am 13.7.2024
Qouz-Note: 2-
***
MamM 610 Und so jemand mit dir unrechten will
„Das ist einfach nicht zu fassen!“ rechtfertigte Don Litigando sein
Mitteilungsbedürfnis.
„So?“ wollte der Alte von der Halbinsel erst einmal abwarten, welche Teile ihm zugedacht waren.
„Es ist jeden Samstag dasselbe“, suchte der Besucher nach dem richtigen Anfang. „Mein Nachbar! Ja, er kehrt Weg und Straße. Jaha! Aber dann schiebt er den ganzen Kehricht zu mir rüber. So eine
Unverschämtheit! So eine –“
„– Menschlichkeit“, ergänze der Alte hilfsbereit.
„Frechheit!“ berichtigte Don Litigando. „Was? Wie? Wenn alle Menschen so –“
„Einer trage des andern Last“, zitierte der Alte, „so werdet ihr das Gesetz
Christi –“
„Wie bitte?“ meinte der Besucher sich verhört zu haben.
„Das soll auch noch christlich sein? Das ist bestimmt falsch über–“
„Hier, wie liesest du?“ Damit schlug der Alte sein abgegriffenes Buch auf, blätterte darin und reichte es dem
Besucher.
Und dieser las mit wachsender Entrüstung: „Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Übel; sondern
so dir jemand – Nein, das kann nicht richtig sein! Das öffnet ja dem Übel Tür und Tor!“
„– wenn es keinen Gott gäbe!“ ergänzte der Alte. „Da es aber unsern Gott gibt, kannst du sogar lesen: Du brauchst dem Übel nicht zu widerstreben, denn selbst
die Haare auf deinem Haupt sind alle –“
„Nein, nein!“ ereiferte sich Don Litigando. „Das erzieht
ja zu Duckmäusern! Zu Opferlämmern, die sich alles gefallen lassen! Wer
sich so verhält, macht sich geradezu mitschuldig!“
„Und wenn er so Frieden findet?“ gab der Alten zu bedenken. „Hast du denn Frieden?“
„Nein“, mußte der Besucher zugeben. „Laßt Ihr Euch denn alles gefallen?“
„Danke, danke“, lachte der Alte, „daß du mich nicht auf meinen Backen schlägst
und prüfst, ob ich dir auch den andern darbiete. Bei der Bergpredigt stoß ich sowieso immer wieder an meine Grenzen. Darf ich aber das Meer der Güte
Gottes leugnen, nur weil ich es mit dem Becher meiner Logik nicht ausschöpfen kann? Deshalb bleibt
jeder Rat der Bergpredigt als Aufgabe für mich bestehen; auch wenn ich noch nicht alles
gleichzeitig befolgen kann.“
„Dann müßtet Ihr ständig ein schlechtes Gewissen haben“, folgerte Don Litigando. „Macht d a
s denn glücklich?“
„Nein“, ließ der Alte den Bezug zunächst offen. „Es sei denn, daß ihr euch
umkehrt und werdet –“ Und er begann zu erzählen:
Es hatte aber Paolino eine Mutter, die wollte ihn nicht wie eine Pflanze im
Treibhaus großziehen. Deshalb übergab sie ihn einer Fee, auf daß er bei dieser lerne, was er für
sein Leben brauche.
Die Fee nahm Paolino jedoch nicht in ihr Schloß auf, sondern zog mit ihm in eine ferne Stadt, wo die beiden niemand kannte. Dort hausten sie in einer kleinen Hütte, und jedermann hielt sie bald für eine arme Witwe mit ihrem Sohn.
Zunächst war von Erziehung nicht viel zu erkennen. Doch sobald Paolino auf das Gymnasium geschickt wurde,
änderte sich manches; zumal er entdeckte, daß vor den Lehrern nicht alle Schüler gleich sind.
Paolino hatte nämlich Geld gefunden und es bei der Gendarmerie abgeliefert. Die Gendarmen waren aber
angewiesen, ehrliche Finder öffentlich zu loben und als leuchtendes Vorbild hinzustellen. Und so erschien auch bald ein Gendarm im Gymnasium, rief Paolino vor die Klasse und waltete seiner Anweisung.
Zurück blieben Scherben; denn welche Klasse verzeiht es, wenn einer aus ihren Reihen als Musterschüler
hingestellt wird? Der Lehrer dachte nicht anders, und schon bald kam Paolino mit großem Kummer zur
Fee.
Er war mit seinem Stuhl umgekippt – worden und hatte dafür eine Strafarbeit erhalten.
„Das ist eine große Ungerechtigkeit!“ beklagte er sich.
„Der dicke Dieter hat die Stuhlbeine unter mir weggetreten, aber ich werde dafür bestraft.“
„Wie das?“ wunderte sich die Fee. „Hast du denn mit dem
Stuhl gewippt?“
„Na ja“, mußte Paolino zugeben. „Aber hätte er nicht dagegengetreten, –“
„Hättest du nicht mit dem Stuhl gewippt“, blieb die Fee hartnäckig.
„Aber seit der Gendarm bei uns war“, blieb Paolino in seiner Kummerhöhle, „schikaniert mich der Lehrer, sooft er –“
„– dir noch weh tut“, ergänzte die Fee, „und nicht leid. Laß das doch gar nicht mehr an dich heran. Bau dir einen Deich, an dem die wütenden Wellen sich totlaufen.“
Und als der Lehrer wieder einmal eine Gelegenheit nutzen wollte, da befolgte Paolino den Rat. Freilich –
zunächst wurden die Wellen heftiger; aber als der Lehrer einsehen mußte, nichts mehr ausrichten zu können, wandte er sich anderen
Opfern zu.
Doch auch andere Lehrer hatten ihre schwache Seite. Da gab es einen, der die Schüler nach dem Wohlstand ihrer
Eltern einschätzte und die Armen nicht für ebenbürtig hielt. Als sich Paolino über ihn beschwerte, fragte die Fee: „Gibt es nicht auch
Lehrer, welche die Armen bevorzugen?“
„Ja“, mußte Paolino zugeben.
„Und darüber beklagst du dich nicht?“ weitete die Fee den Blick.
Und dann schimpfte Paolino über einen Lehrer, der die Mädchen bevorzugte.
„Und deine Lehrerin?“ fragte die Fee. „Bevorzugt die
auch die Mädchen?“
„Nein“, mußte Paolino zugeben. „Sie scheint mich sogar zu mögen. Aber – ungerecht ist es doch! Warum muß es so etwas überhaupt geben?“
„Muß? Warum?“ griff die Fee auf. „Ich kann dir allenfalls auf ein Wozu antworten: auf daß wir lernen, zu verzeihen und unsere Deiche zu bauen.“
„Und wenn andere ungerecht behandelt werden?“ fragte Paolino. „Ich wollte gestern mit Poverina eine Tafel Schokolade teilen; aber obwohl sie sehnsüchtig auf meine Hand geblickt hat, mußte sie ablehnen. Sie
dürfe keine Geschenke annehmen, denn die müßten im Armenhaus angegeben werden, und dann erhielte die ganze Familie weniger zu essen.
Das ist doch nicht gerecht! Oder?“
„Kannst du jemandem wirklich eine Bürde abnehmen“, antwortete die Fee, „dann tu’s. Ansonsten hilf ihm tr–“
„Soll ich meinem Nachbarn etwa noch kehren helfen?“ fuhr Don Litigando dazwischen.
„Soll?“ rieb sich der Alte. „Nichts sollst
du. Doch wer Frieden bringen will, muß selber Frieden haben.“ Und er
geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *27.-28.1.2011, freigegeben am 15.7.2024
Qouz-Note: 2
***
MamM 611 Sollen oder leben
„Wir sollen uns mehr in die Gemeinde einbringen“, berichtete Don Dietro von der letzten Predigt.
„Sollen?“ stolperte der Alte von der Halbinsel mal wieder über sein Reizwort. „Wer redet von Sollen?“
„Na, wie heißt er noch schnell?“ zeugte der Besucher von seinem Interesse. „So einer, der mehrere Pfarreien beaufsichtigen soll –“
„Schon wieder soll!“ seufzte der Alte.
„Ist ja auch egal“, brach Don Dietro seine Suche ab. „Jedenfalls der hat es vom Bischof, und der hat gesagt,
wir –“
„– dürfen“, half der Alte.
„– sollen“, verbesserte der Besucher, „in diesem Jahr viel Gutes tun.“
„Na, dann wird es auch danach sein und werden“, folgerte der Alte. „Und du hast dazu noch amen –“
„Selbstverständlich!“ bestätigte Don Dietro. „Nicht nur
ich, sondern –“
„Ja, ja“, seufzte der Alte, „der Opportunismus unter Christen ist so sicher wie das Amen in der –“
„Sollte ich etwa stille –“
„Soll?“ grollte der Alte. „Nichts sollst du –“
„Aber ohne das geht doch nichts mehr“, hielt der Besucher dagegen.
„Nein, alle fahren“, schweifte der Alte ab, „und wundern sich, wenn sie sich nicht mehr bewegen können und keine Luft mehr –“
„Ich seh’s doch bei meinen Lehrlingen“, hatte Don Dietro gar nicht zugehört. „Alles muß ich denen
vorschreiben! Von alleine tun die nichts! Gar –“
„Das Dynamoprinzip“, kommentierte der Alte. „Was selber keine Energie hat, muß getreten werden. Eine Dampfmaschine dagegen –“
„Ja, Dampf möchte ich denen manchmal wirklich machen“, flüchtete der Besucher zum Wünschen. „Früher –“
„– wo das Wünschen noch geholfen hat“, zitierte der Alte und begann zu erzählen:
Da lebte ein König, allein – von Tag zu Tag freudloser. Es lief fast gar
nichts mehr in der königlichen Verwaltung. Einer bremste den andern, jeder fühlte sich eingezwängt, und kein Auge glänzte
mehr. Wie das ändern?
Dazu bot sich endlich eine Gelegenheit, als der bisherige Kanzler in den Ruhestand verabschiedet wurde.
„Neue Besen kehren gut“, dachte der König und setzte Oberst Stockfisch
zum neuen Kanzler; zumal das Militär dem König bisher noch keine Sorgen bereitet hatte. Gut – der König hatte noch keinen Krieg führen müssen, aber er war sich sicher, daß er sich auf seinen Soldaten verlassen konnte.
Und mährsächlich: Oberst Stockfisch begann auch gleich damit, viel Staub aufzuwirbeln. Er ließ alle
Amtsvorsteher in seiner Kanzlei antreten und eröffnete ihnen seine Richtlinien.
„Meine Herren!“ schnarrte er, während er vor den Stehenden auf und ab ging. „Ärmel aufgekrempelt! In die Hände gespuckt! Jetzt weht hier ein anderer Wind! Fordere unbedingten Gehorsam! Habt ihr mich verstanden? – Was? Wie? Ich frage noch einmal: Habt ihr mich verstanden? – Jawoll, Herr Kommandeur, heißt das! Werd’ es euch noch lehren!“
Und die Beamten lernten viel und schnell. Jeder hatte einen Vorgesetzten. Jeder hatte zu gehorchen. Und jeder konnte in der Hierarchie aufsteigen, denn die
Leiter nach oben erhielt unter Oberst Stockfisch zahlreiche zusätzliche Sprossen. Und so hatte bald jeder einen Posten erklommen, auf
dem seine Unfähigkeit eigentlich hätte offenkundig sein müssen.
Doch wem ein breites Gesäß gewachsen ist, der täuscht geschickt vor, er könne seinen Platz voll ausfüllen. Und so entging
dem Oberst, daß die Geschäftigkeit nur dazu diente, Hamsterräder in Bewegung zu halten. Hauptsache, Oberst Stockfisch hörte auf sein
„Hat Er mich verstanden?“ ein „Jawoll, Herr Kommandeur!“ als Echo.
Dem König blieb diese Verwicklung jedoch nicht verborgen, und deshalb beförderte er den Oberst kurzerhand zum General mit besonderem Geschäftsbereich und versetzte ihn
zurück zum Militär. Neuer Kanzler wurde Dr. Fantasino.
Nun ja, der war aus einem ganz anderen Holze geschnitzt denn sein Vorgänger. Tagelang konnte er sich in sein
stilles Kabinett zurückziehen und angestrengt darüber nachdenken, wer was zu tun haben sollte. War er endlich zu einem Ergebnis,
besser: Zwischenergebnis, gekommen, dann lud er alle Bediensteten der betreffenden Behörde zu sich ein, nahm sich viel Zeit für sie und eröffnete ihnen mit großen Gesten, was er sich für sie
ausgedacht hatte.
Die Zuhörer kamen aus dem Staunen kaum heraus, zumal Dr. Fantasino derart viele Neuerungen ausheckte, daß in seinem Kopf kein Platz mehr war, ein großes
Erinnerungsvermögen anzuhäufen. Was er kurz zuvor noch mit „absoluter Priorität“ ausgezeichnet hatte, war bald überholt von einer
anderen Neuerung mit „absoluter Priorität“. Kurz – er behandelte seine Verwaltung wie ein Spielzeug, wie s e i
n Spielzeug, das nur für i h n dazusein hatte.
Der König jedoch mußte mehr an seine Bürger denken, die mit ihrem Unmut immer lauter wurden. Deshalb ernannte er Dr.
Fantasino zum obersten Spieleausdenker und berief ihn zum Berater aller Heime, in denen Menschen über Langeweile klagen. Neuer Kanzler
wurde – Tscherkano.
Na, das war vielleicht ein Chaot! Die meiste Zeit war er – nicht in seinem Kabinett, sondern in den Amtsstuben
der königlichen Bediensteten. Von diesen ließ er sich erklären, was ihre Aufgaben waren, was sie gerne machten und was sie gut
machten. Ja, er ließ sich sogar von ihnen anleiten und sie beweisen, was sie alles besser konnten denn er. Und bald kannte er die Stärken und Interessen eines jeden.
Freilich – mancher hatte den Mund etwas zu voll genommen oder sich in einem Vexierspiegel betrachtet; aber
dennoch hatte jeder besondere Begabungen. Und Tscherkano begann, die behördliche Organisation und Hierarchie in einen lebendigen
Organismus zu verwandeln, in dem jeder sich zu den Aufgaben entwickelte, die er gut und gerne ausfüllen konnte.
Trotzdem blieben etliche Arbeiten übrig, die sich keiner großen Beliebtheit erfreuten. Übrig für
wen? Für Tscherkano! Denn er sagte sich: „Solange ich selber nicht weiß,
wie ich bei diesen Arbeiten zur Freude kommen kann, ist es mir nicht möglich, andere für sie zu begeistern. Wer aber andern Arbeiten
aufhalst, die er selber nicht –“
„Haha“, konnte Don Dietro nicht mehr an sich halten, „unser Bischof den Gehsteig vor der Kirche fegen!
Köstlich! Köstlich!“
„Bist du kein Bischof?“ fragte der Alte.
„Was?“ empörte sich Don Dietro. „Soll ich etwa meinen
Lehrlingen –“
„Soll?“ tat der Alte verwundert. „Du darfst! Und wenn du es nicht darfst, dann tust du mir leid.“ Und er geleitete den Besucher
hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *3.-4.2.2011, freigegeben am 15.7.2024
Qouz-Note: 2
***
MamM 612 Und verlor ihre einzige Liebe?
„Und dann noch Tag für Tag dieser graue Himmel!“ beklagte sich Herr Graumann. „Selbst das Wasser –“
„– spiegelt den Himmel“, ergänzte der Alte von der Halbinsel.
„Eben!“ fühlte sich der Besucher bestätigt, aber noch nicht verstanden. „Selbst der Himmel bietet keinen Trost –“
„– dem, der dem Himmel fern bleibt“, ergänzte der Alte. „Du brauchst nur mit deinem Kopf über den Wolken
aufzutauchen –“
„Nur?“ spottete Herr Graumann bitter.
„Oder zu warten“, ging der Alte weiter, „denn dann scheint hier an den meisten Tagen –“
„– bis wieder der Winter kommt“, hielt der Besucher dagegen.
„– und wir lernen“, gab der Alte sich nicht geschlagen, „uns auf den Frühling zu freuen.“
„Aber ist es nicht trostlos, daß nichts Schönes bleibt?“ erwartete Herr Graumann Zustimmung.
„Ist es nicht tröstlich“, fragte der Alte, „daß Trübes und Finsternis nicht bleiben?“
„Ach, Ihr versteht mich nicht“, resignierte der Besucher. „Ihr teilt nicht meinen Standpunkt –“
„– weil ich lieber gehe, statt stehenzubleiben?“ dachte der Alte hörbar. „Oder weil ich in eine andere Richtung schaue? Als Elia in jener Höhle war, hat er vermutlich auch keine Sterne gesehen, sondern nur Dunkelheit. Aber hier – wie
liesest du?“ Damit schlug der Alte sein abgegriffenes Buch auf, blätterte und reichte es dem Besucher.
Und dieser las: „Gehe heraus, und tritt auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber – Ja,
aber das war Elia!“
„Ja, sogar Elia war des Lebens müde“, pflichtete der Alte bei, „und das nach seinem triumphalen Sieg auf dem Karmel! Und auch ihm half nur, sich umzudrehen und aus seiner Kummerhöhle hinauszutreten.“
Und er begann zu erzählen:
Mancher Mensch wähnt, er sei bereits vor seiner Geburt verflucht worden; sieht er dagegen auf seine
Mitmenschen, so glaubt er von manchem, dieser sei bereits vor der Geburt gesegnet worden. Tatsächlich gibt es wohl keinen Menschen, der
nur Fluch oder nur Segen empfangen hat.
So auch Prinzessin Sonjetta. Ihrer Mutter hatte eine Frau den Mann
geneidet und war deshalb plötzlich als böse Fee auf der Hochzeit erschienen.
„Euer 1. Kind“, verhängte die böse Fee als Strafe, „soll aus Herzeleid Hand an sich selber legen –“
„– und nur in eine kurze Ohnmacht fallen“, ergänzte unerwartet eine alte, gütige Frau, die als Gast geladen war.
„Das ist kein gutes Omen!“ munkelten die anderen Hochzeitsgäste. Doch als Sonjetta geboren wurde und sich zu einem warmen Sonnenschein entwickelte, gerieten die beiden Prophezeiungen mehr und mehr in
Vergessenheit.
2 aber behielten das Geschehen jener Hochzeit in Erinnerung: Sonjettas Eltern. War es richtig, daß sie sich
alle erdenkliche Mühe gaben, jegliches Herzeleid von ihrer Tochter fernzuhalten?
Wie können der Kräfte wachsen, wirst du wohl denken, die keine Lasten zu tragen hat? Allein – auch Mitleid
führt zu Lasten und übt im Tragen. Und so blieb es Sonjetta nicht verborgen, daß es längst nicht allen Kindern so gutging wir
ihr.
Da traf es sich gut, daß Sonjetta besondere Begabungen empfangen hatte: eine leichte, unverkrampfte Hand und einen klaren Blick für das Wesentliche. Und da sie von guten Lehrerinnen angeleitet wurde, blieben ihre Gaben nicht im Schweißtuch
verborgen.
Ach, hättest du sehen können, mit welcher Leichtigkeit sie lustige Gesichter zeichnete. Oder Bilder malte, die
den Bekümmerten in ein Traumland führen und ihn Gutes und Schönes ahnen lassen. Da verschwinden die trostlosen Mauern der Kummerhöhle
und das Starren der Augen, und Kinder können wieder staunen.
Ja, Kinder! Mancher Geheime Rat flüsterte dem König zu, die Prinzessin habe sich wohl zu lange ein kindliches
Herz bewahrt. Andere in ihrem Alter hätten schon längst daran gedacht, ihren Besitz und ihr Vermögen zu mehren; dagegen setze die Prinzessin ihre Gaben nur dazu ein, mit vollen Händen zu verschenken.
Der König reichte diese Gedanken und Einflüsterungen an seine Tochter weiter, aber die war sich keiner Schuld bewußt. Doch wollte sie ihren Vater nicht betrüben und lenkte deshalb ein: „Gut, mein Vater, so mögen Eure Beamten fortan meine Bilder so teuer wie
möglich verkaufen und den Erlös dem Armenhause zugute kommen lassen.“
Der König war’s zufrieden und wies seine Beamten entsprechend an. Kämmerer Hadebar hätte sich dieser Regelung gerne widersetzt, denn ihm tat es leid um das viele Geld, das nun den Armen zufloß. Allein – wie konnte er’s verhindern?
Zu diesem Leid kam noch ein großer Kummer hinzu. Ein Herzenskummer! Denn obwohl Hadebar mehr als ein Auge auf die Prinzessin geworfen hatte, waren seine Blicke nicht auf Zunder getroffen. Die Prinzessin hatte sich nämlich in den Prinzen Valentin verguckt und der in
sie.
Doch bevor die Hochzeitsglocken läuten konnten, wurden sie für andere Zwecke gebraucht. Zunächst für den Tod
und das Begräbnis der Königin; und nach der Trauerzeit für die Hochzeit der Stiefmutter und des
Königs.
Und nun wurde manches anders, denn die Stiefmutter brachte eine Tochter mit in die neue Ehe und setzte deshalb alles daran, Sonjetta
von der Thronfolge auszuschließen und im Vaterhause zu einer Fremden zu machen.
In Kämmerer Hadebar wurde ihr ein nützlicher Helfer, denn Eifersucht ist ein fürchterliches Gift. Hatte die
Prinzessin nicht mit ihren Bildern hohe Einkünfte erzielt? Ja! Hatte sie
diese aber versteuert? Nein! Also?
Die Prinzessin hielt dagegen, sie habe die Erlöse gleich an das Armenhaus weiterleiten lassen; doch Belege
konnte sie nicht vorweisen. Und wer mit vollen Händen verschenkt, hat keine Ersparnisse, seine Steuerschulden bezahlen zu
können. Aber statt sich in ihrer Not an den Kämmerer um Hilfe zu wenden (wie dieser insgeheim gehofft
hatte), floh Prinzessin Sonjetta bei Nacht und Nebel aus Schloß und Hauptstadt.
Zu Prinz Valentin? Nein, denn „Ich bring’ ihm doch nur Schulden!“ sprach sie zu sich und versuchte, ihr Dasein künftig als Bettlerin zu fristen. Aber
erstorben war ihre Liebe zum Prinzen nicht.
So etwas meinte sie erst zu fühlen, als der Prinz eines Tages an ihrem Bettlerplatz vorüberging, ohne sie eines Blickes zu würdigen.
„Er liebt mich nicht mehr!“ stach es ihr ins Herz.
„Sonst hätte er meine Nähe spüren müssen!“ Mit einem Mal sah sie nur noch finstere Mauern vor ihren Augen, kein Fenster, keine
Türe. Und in ihrer Verzweiflung machte sie allem ein Ende.
„Du Dummerchen“, wurde sie von einer vertrauten Stimme ins Leben zurückgerufen, „wie konntest du nur an meiner Liebe zweifeln! Schau, alle deine Schulden sind bezahlt. Nun ist alles –“
„– ein Märchen“, fuhr Herr Graumann dazwischen.
„– mit viel Wahrheit“, ergänzte der Alte. „Wie viele Verzweiflungstaten waren grundlos, weil die Hilfe bereits
unterwegs war!“ Und er geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *10.-11.2.2011, freigegeben am 16.7.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 613 Warten – geschenkt
„Das ist manchmal wirklich zum Aus-der-Haut-fahren“, schimpfte Don Alemann.
„Ob das ein appetitlicher Anblick wäre –“, dachte der Alte von der Halbinsel
laut.
„Zum Beispiel jetzt am Sonntag“, blieb der Besucher auf seinem Gedankengang. „Was meint Ihr, wie gern ich mit
der Eisenbahn fahre? –“
„Vermutlich –“
„Immer dieses Warten! Der Vorzug war schon ausgefallen“, fand Don Alemann seinen Faden wieder. „Das ist denen aber erst nach 25 Minuten aufgefallen. Egal – mein Zug war auch nicht
pünktlich. Da stehst du nun und wartest und wartest! Kommt er noch oder
nicht? Wenn ja, mit wieviel Verspätung? Denn unter 10 Minuten Verspätung
rufen sie gar nicht mehr aus. – Na ja, er kam endlich. Aber glaubt
mir, ich hab' mich noch eine ganze Zeit nachher mit der –“
„Ganze Zeit?“ blieb der Alte hängen.
„Und dann wißt Ihr ja nie“, eilte der Besucher weiter, „ob der Anschlußzug wartet –“
„– oder ebenfalls Verspätung hat“, gab der Alte zu bedenken.
„Jedenfalls nichts als Ärger –“, beklagte sich Don Alemann.
„Das ist freilich arm und bitter!“ pflichtete der Alte bei. „Und sonst ist dir nichts geblieben? Ich dachte immer, die Freude –“
„– und vergeudete Zeit!“ ergänzte der Besucher.
„Mit was?“ fragte der Alte. „Mit was
vergeudet?“
„Mit Warten –“
„Warten ist vergeudete Zeit?“ zweifelte der Alte.
„Gewiß!“ war sich Don Alemann sicher. „Es lähmt. Es bremst. Es bindet Kräfte. Ständig der Gedanke: Ob ich mein Ziel noch rechtzeitig erreiche? Und selbst wenn ich
es doch noch schaffe, bin ich hinterher richtig fertig –“
„Na bitte“, konnte es der Alte nicht lassen, „wenigstens eine Vollendung!“
„– und verärgert“, nahm Don Alemann den Spott nicht an.
„Weil du dein Geschenk nicht ausgepackt hast“, folgerte der Alte.
„Geschenk?“
„Ja“, bestätigte der Alte. „Wartezeit ist geschenkte Zeit.“ Und er begann zu erzählen:
Es war einmal ein reicher Bauer, von dem hieß es, er habe keine Kinder.
Aber ihm dienten 2 tüchtige Knechte, von denen vielleicht einer einmal das Erbe erhalten konnte. Einer – nicht beide; denn der reiche Bauer wollte sein Erbe nicht aufteilen.
Nun begab es sich, daß über mehrere Jahre eine Mißernte der andern folgte, so daß es für die Knechte nicht mehr genug zu tun gab.
Deshalb sprach der Bauer eines Tages zu Terrano und Floritzel: „Es ist euch besser, wenn ich euch in die weite Welt entlasse. Bestimmt
werdet ihr bald bessere Arbeit und euer Auskommen finden. Hier habt ihr noch ein wenig Zehrgeld und euren Rucksack. Zieht hin in Frieden!“
So nahmen denn die beiden Knechte Zehrgeld, Rucksack und Abschied und wanderten davon. Doch als sie an ein
breites Wasser kamen, war weit und breit keine Fähre zu sehen.
„Soll ich etwa meine Zeit mit Warten vergeuden?“ fragte sich Terrano. „Nein, ich will dort drüben in die Fährhausschenke gehen und mir die Zeit auf angenehme Weise vertreiben.“ Den Worten ließ er sogleich Taten folgen, ging in die Schenke, warf seinen Rucksack in die Ecke und ließ sein Zehrgeld und die Puppen
tanzen. Und bald hatte er seinen Bauern, seinen Mitknecht und seine Weiterreise vergessen.
Floritzel hatte sich nicht angeschlossen, sondern am Ufer hingesetzt und blickte über das Wasser. Mit einem
Mal fiel ihm sein Rucksack ein.
„Sonderbar!“ sprach er zu sich. „Da schleppe ich schon
eine lange Zeit den Rucksack auf dem Rücken und weiß noch nicht einmal, was er enthält.“
Er nahm ihn also vom Rücken, öffnete und fand – 3 kleine Geschenke. Neugierig wickelte er das 1.
aus. Ein Märchenbuch! Er schlug es auf, begann zu lesen, las und las, und
bald war es ihm, als wäre er selber hinüber in das Märchenland gezogen. Eine schöne Prinzessin ließ sich durch ihn erlösen, holde Feen
beschützten ihn, und in seinem Herzen fühlte er Tapferkeit statt Angst, Güte statt Rachsucht und Liebe statt Haß. Welch ein
Reichtum!
Und als Floritzel wie von ungefähr seinen Blick erhob, da gewahrte er die Fähre, die gerade am Ufer anlegte.
Wo war die Zeit geblieben? Auf jeden Fall hatte sie den Wanderer Floritzel reicher gemacht.
Mit der Fähre mußte Floritzel alleine weiterreisen, denn Terrano wollte sich nicht vom Wirtshaus trennen.
Dennoch wurde es Floritzel nicht langweilig an Bord. Immer wieder schweifte er in Gedanken ab in – das Märchenland.
Vom andern Ufer wanderte er hurtig weiter, obwohl in seinem Sinn noch lange allerlei Märchen herumspukten.
Doch gerade diese Gedanken vertrieben Müdigkeit und Verzagtheit. Und wieder versperrte ein breites Wasser den Weg, und Floritzel mußte
lange Zeit auf die Fähre warten.
Lange Zeit? Floritzel kam es überhaupt nicht lang vor. Denn anstatt in der Fährhausschenke einzukehren, setzte er sich am Ufer nieder und packte das 2. Geschenk aus. Ein Bilderbuch! Und was für Bilder! Mancher Maler mußte wohl vorher im Märchenbuch gelesen haben, ehe er sein Bild vollendet hatte. Diese Farben! Dieser Zauber! Diese Ahnungen im Dämmerlicht! Und wie die Meister zu sehen gewußt hatten! Ach, jedes Bild war wie eine Schatztruhe, deren Kostbarkeiten nicht auszuzählen waren. Jeder Blick ließ Neues entdecken.
Endlich kam die Fähre, und auch diese Überfahrt ward Floritzel wie ein Flug, denn er bemühte sich, das anzuwenden und zu vertiefen, was er in der Schule des Sehens
gelernt hatte.
Vom andern Ufer wanderte er hurtig weiter – wie ein Entdecker in einem unbekannten Land. Und zum 3. Mal querte
ein breites Wasser den Weg, und keine Fähre war in Sicht. Wieder kehrte Floritzel nicht in der Schenke ein, sondern setzte sich hin und
packte das 3. Geschenk aus. Ein Liederbuch!
Und Floritzel begann zu singen und – sang sich das ganze Herz frei; frei von allen Sorgen, welche sich bisher
gegen Märchen und Bilder noch mochten behauptet haben. Es war ihm, als hätte seine Seele
Flügel erhalten.
„Was?“ sprach Floritzel zu sich. „Mein Herr wäre arm
geworden? Und hat mir solche Geschenke gemacht? Und ich könnte in der Welt
noch etwas Besseres finden? Nein – und nimmermehr! Ich will wieder zurück
zu meinem Herrn!“
Und er erhob sich und eilte zurück. Doch immer wieder mußte er kurz stehenbleiben, um sich Notizen zu
machen. Denn die 3 Bücher waren ansteckend, und mal fiel ihm selber ein neues Märchen ein, mal ein neues Bild, mal ein neues
Lied.
Sein Mitknecht saß noch immer in der Schenke und wollte dort auch bleiben. Also kehrte Floritzel alleine
zurück.
Der Bauer empfing Floritzel mit offenen Armen: „Willkommen, mein –“
„Ciao!“ unterbrach Don Alemann. „Ich muß los! Ich hab’ hier schon genug Zeit –“
„Mit Gott!“ rief der Alte hinterher und holte dann einen alten Rucksack hervor.
© Stiftung Stückwerken, *17.-18.2.2011, freigegeben am 16.7.2024
Qouz-Note: 2
***
MamM 614 Eheglück
„Und was ratet Ihr“, fragte Don Barbono, „worauf in einer glücklichen Ehe geachtet werden soll?“
„Soll?“ stieß sich der Alte von der Halbinsel mal wieder. „Niemand soll was. Und wenn
die Ehe bereits glücklich ist, –“
„Ich meine“, wurde der Besucher deutlicher, „wie wird eine glückliche Ehe erreicht? Wie bleibt sie
glücklich?“
„Das fragst du einen gelernten Junggesellen?“ wunderte sich der Alte.
„Beratet Ihr denn keine Ehepaare oder Brautpaare?“
„Beraten?“ griff der Alte auf. „Das klingt danach, ich
wüßte etwas besser als die andern – Nein, das trifft es wohl nicht. Ich bemühe mich, zu helfen, ja, das trifft es wohl besser:
schlummernde Schätze zu wecken oder freizulegen; also was im Menschen bereits –“
„Somit könnt Ihr auch mir raten –?“
„Vermitteln, erinnern“, verbesserte der Alte. „Nun, eine glückliche Ehe ist sicherlich auf den Geboten
gegründet –“
„Aha“, wollte Don Barbono Zeugnis von seinem Wissen ablegen, „vor allem das 6.: Du sollst –“
„Schon wieder sollst!“ brummte der Alte. „Nichts sollst
du. Du darfst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst.“
„Eben!“ fühlte sich der Besucher bestätigt. „Du sollst
keusch –“
„Wenn es um Keuschheit geht“, unterbrach der Alte, „frag die Kirche; die gefällt sich gerne darin, aus weiten
Verboten enge Gebote zu machen. Für mich dagegen legen die beiden göttlichen Ratschläge lediglich Grenzen fest, innerhalb derer es sich
besser leben läßt denn außerhalb. Und sie gewährleisten Freiheit –“
„Es führen eben viele Wege nach Rom“, fühlte sich Don Barbono um seinen Senf
gebeten.
„Aber nicht jeder“, schränkte der Alte ein. „Und wer will schon nach Rom? Allein – innerhalb der göttlichen Ratschläge ist mir noch einer wichtig: Es geht euch besser, wenn du niemanden täuschest –“
„Ja, ja, sag immer die Wahrheit“, zitierte der Besucher eitel, „doch sag sie
nicht –“
„Denn wie kann auf Täuschung Vertrauen gedeihen?“ ließ sich der Alte nicht aufhalten. „Auch geht es euch besser, wenn ihr die Sonne nicht über euren Zorn untergehen lasset, sondern
immer wieder und immer unverzüglich vergebet –“
„Wie kann sich da der andere bessern?“ zweifelte Don Barbono.
„Indem er unbeschwert einen neuen Anfang macht“, antwortete der Alte. „Und dann ist es gut und glücklich, wenn
eine Ehe reicher macht –“
„Das sagt Ihr?“ wunderte sich der Besucher.
„– an Schätzen, die da bleiben“, ergänzte der Alte.
„Aber – aber Ihr sagt ja gar nichts von Liebe“, vermißte Don Barbono Wichtiges.
„Liebe – eine vielfältige und gute Kraft“, dachte der Alte hörbar, „über die sich schlecht reden läßt. –
Aber ich hatte dich so verstanden, daß du etwas über die Ehe, eine glückliche Ehe, wissen wolltest“, und er begann zu erzählen:
Wer wollte nicht eine glückliche Ehe führen! Drüben hat einer der Kirchenväter sogar empfohlen, die Jugend
dazu anzuhalten, Lust zur Ehe zu bekommen.
Nun, dieses Anhalten war bei Filino anscheinend nicht vergeblich gewesen. Heiraten wollte er schon; aber wen? Und weil er nichts verkehrt machen wollte, ging er schließlich zu seiner Fee.
Die fragte ihn, ob er denn schon auf eine bestimmte Jungfrau ein Auge geworfen habe.
„Ja“, gestand Filino, „auf Elena.“
„Und was gefällt dir so an ihr?“
„Na“, brauchte Filino nicht lange zu überlegen, „sie ist weit und breit die Schönste von allen.“
„Dann komm mal mit“, forderte die Fee den jungen Mann auf, und gemeinsam wanderten sie zu einer großen Stadt.
Unterwegs führte der Weg über eine bunte Blumenwiese.
„Schau, eine Blume schöner als die andere“, deutete die Fee auf die bunte Pracht. „Und was machen die
Schmetterlinge? – Sie fliegen von einer Blume zur andern.“
In der großen Stadt wurde Filino bald an die Schmetterlinge erinnert. Wie viele schöne Frauen und Mädchen es
dort gab! Und jede wußte die Blicke der Männer auf sich zu lenken. Und
keine wußte einen Mann festzuhalten.
Aber da war noch Richilde. Die war nicht nur eine Schönheit, sondern auch sehr reich. Diese prächtige Kutsche! Dieser kostbare Schmuck! Dieser einzigartige Duft! Das konnte unseren Filino schon in den Bann
schlagen.
Doch eines Nachts nahm die Fee den jungen Mann bei der Hand und zeigte ihm, wie sich Richildes Geld gespeist hatte. Einiges war den Kunden aus der
Tasche gezogen worden, einiges den Schuldnern, einiges den Pächtern; anderes war dem Gesinde vorenthalten worden, anderes den
Lieferanten, anderes den Steuereinnehmern. Und mit so etwas hätte sich Filino beinahe gemein gemacht? Nein! Niemals! Doch was
nun?
„Dann wandre nach Hause“, riet die Fee und verschwand.
So verließ Filino die große Stadt und wanderte und wanderte. Eines Tages gewahrte er ein Mädchen, das auf
einem Weg einherschritt, der in Filinos Weg einmündete. Und als sich die beiden an dieser Einmündung begegneten, sahen sie sich in die
Augen, und es sank ihnen etwas ins Herz, das beide die gleiche Frage stellen ließ: „Wohin des Weges?“ Und beide gaben die gleiche
Antwort: „Wohin du gehst, da will auch ich hingehen.“
Das waren keine leeren Wörter, sondern aus den Worten wurden Taten. Beim nächsten Schuster kaufte Filino der
Ruth festes Schuhwerk; und die Ruth sorgte dafür, daß sie beide wetterfeste
Kleidung bekamen. An Regenwetter hatte nämlich Filino gar nicht gedacht.
Und als das Geld zur Neige ging, da stellten sich die beiden auf den Marktplatz und sangen, was ihnen bereits unterwegs –“
„Und die Liebe?“ nahm Don Barbono einen neuen Anlauf.
„Dazu braucht’s nur einen Funken“, antwortete der Alte, „zum warmen Herd aber ein ganzes Leben“, und er geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *24.-25.2.2011, freigegeben am 17.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 615 Die beiden Postkutschen
„Seid froh, daß Ihr Junggeselle geblieben seid!“ liebäugelte Don Ruvido mit einer der 7
Hauptsünden.
„Das bin ich sogar unbefohlen“, ergänzte der Alte von der Halbinsel. „Doch gönne ich von Herzen –“
„Wie gerne täte ich mit Euch tauschen!“ seufzte der Besucher.
„Hattest du denn nie die freie Wahl?“
„Doch“, gab Don Ruvido zu. „Aber frisch verliebt, da denkt jeder, er sei im 7. Himmel und bleibe für immer
–“
„Du bist nicht dort geblieben?“ stellte der Alte sich zu den Unwissenden. „Ging’s noch weiter hinauf? Bis in den 8. –“
„Nein“, beklagte sich der Besucher. „Alles Lug und
Trug. Und von Jahr zu Jahr häufen sich die Augenblicke, in denen du dich in der Hölle –“
„Liebe und Hölle haben wohl zumindest die Hitze gemein“, schweifte der Alte nach Calau.
„Und wie!“ bestätigte Don Ruvido. „Bis zum Siedepunkt,
daß einem der Kragen platzt und –“
„– die Eheliebste ihn gerne wieder annäht“, ergänzte der Alte, frei von würzendem Spott.
„Von wegen!“ widersprach der Besucher. „So mag’s früher
gewesen sein. Heut’ gibt’s für alles eine Rechnung. Und wehe dem Mann, der
diese Rechnung nicht –“
„Sprachst du nicht eben von der Ehe?“ wunderte sich der Alte. „Was hat die denn mit einem Handelsgeschäft –“
„Hört Euch nur mal um!“ bitterte Don Ruvido.
„Gleichberechtigung nennen sie das –“
„– wenn die Frau immer gleich recht bekommt“, ergänzte der Alte kundig. „Na ja, wenn sie recht hat; allein – sagtest du nicht was von Liebe?“
„Verlieben!“ stellte der Besucher richtig.
„Ver-lieben“, ließ der Alte auf der Zunge zergehen. Ver-geben, ver-trauen –“
„– verkehrt, Verderben, verkommen“, schickte Don Ruvido hinterher. „Versprechen, Versprecher –“
„Ach, so ist das in der Ehe“, schien dem Alten ein Licht aufzugehen. „Versprochen ist versprochen –“
„Das ist bestimmt nicht übertrieben“, seufzte der Besucher.
„Du hast dich selbstverständlich immer bemüht, –“
„Nein“, mußte Don Ruvido zugeben. „Und am Anfang bemühen sich wohl auch beide –“
„Vor der Ehe oder –“
„Vor der Ehe“, antwortete der Besucher. „Haben die Hochzeitsglocken erst einmal geläutet, dann geht’s nur noch
um die Macht –“
„Dann laßt die Hochzeitsglocken doch schweigen –“
„Da kennt Ihr die Frauen schlecht“, konnte sich Don Ruvido über seinen Wissensvorsprung nicht so recht freuen.
„Der Schatz ist ohne den Acker nicht zu haben“, zitierte der Alte ohne Mitleid.
„Schatz!“ griff der Besucher auf. „Eines der häufigsten
Kosewörter zwischen Frau und Mann.“
„Wörter? Nicht Worte?“ klügelte der Alte. „Solange beide noch miteinander reden, –“
„Mit der Betonung auf miteinander“, seufzte Don Ruvido. „Bei uns ist es längst gegeneinander, – wenn
überhaupt! Es ist alles durchgiftet: das Reden, das Schweigen – Ihr spracht eben von Hitze; bei uns ist es Eiseskälte.“
„Hast du denn keinen Ofen?“
„Ach, es ist besser“, hatte der Besucher gar nicht zugehört, „wir lassen uns scheiden –“
„– die wir uns einmal geliebt?“ ergänzte der Alte und begann zu erzählen:
Das hatten Maddalena und Markward wohl auch vor; und so bestieg jeder seine Postkutsche: SIE in die eine Richtung, ER in die Gegenrichtung.
Und los ging die Reise, größer und größer wurde der Abstand – äußerlich; doch in Gedanken? Da waren sie sich so nah wie schon seit langem nicht mehr. Sicher – anfangs schickten
SIE IHM und ER IHR Groll über Groll hinterher. Es rannen sogar Tränen des Zorns und der Bitterkeit, aber nach und nach versiegte ihre
Quelle.
ER hätte doch wenigstens – Wenn SIE wenigstens – Ich hab’ es IHM 1000mal gesagt – Das konnt’ ich IHR 100mal sagen – Und doch
– Und dennoch –
„Ich hatte mir doch gar nichts dabei gedacht!“
„Das kannst du erzählen, wem du willst, das war Absicht!“
„Und wenn, so etwas müssen sich Eheleute doch verzeihen können.“
„Soll ich etwa so etwas auch noch belohnen? Nein, irgendwann ist Schluß!“
„Du bist immer so streng! Ja, gib’s doch zu: Du liebst deine verdammten Prinzipien viel mehr als
mich!“
„Es muß Grenzen geben! Aber ihr Frauen könnt euch wohl an keine Regeln halten. Das war schon so im Paradies.“
„Eine Frau stellt ihre Liebe über alles. Warum könnt ihr Männer das nicht? Das ist doch nicht christlich!“
„Wer alles durchgehen läßt, macht sich mitschuldig. Nein, das war richtig so! 490mal hab’ ich dir vergeben; ich hab’ genau Buch – Was ist das
denn? Warum geht es nicht weiter? – Heda, Postillion!“
So etwas hatte es noch nie gegeben! Daß ein Postillion nicht auf den Weg achtet, kann vorkommen; aber gleich 2? Empört schaut Markward aus dem Fenster – hüben; empört schaut Maddalena aus dem Fenster – drüben. Beide Postkutschen sind anscheinend
um einen Berg gefahren und stehen sich in einem Hohlweg gegenüber. Die gute Fee der beiden
Eheleute könnte nun frohlocken, aber die beiden – Nein, die beiden fliehen, als hätten sie das Böse gesehen: Sie eilt zu Tale, er den Berg hinauf.
Wo Markward nur hinwill? Höher und höher klettert er. Nur weg von der da, der da unten. Allein – er hat die Rechnung ohne seine gute Fee
gemacht. Sein Fuß rutscht ab, er kommt zu Fall, und schon geht es hinab.
Maddalena blickt sich entsetzt um. Das darf doch nicht – Und schon reißt er sie mit, als er in ihr einen
Halt suchen will. In einem Sumpf finden sich die beiden wieder – lebend.
Tiefer und tiefer sinken die beiden, denn wie könnte einer der anderen helfen, da sie doch beide im Sumpf stecken? – Da findet ihr Fuß doch noch Halt, und mühsam schleppen sie sich auf das feste Land: über und über mit Schmutz bedeckt, naß und
frierend.
Gut, daß in der Nähe eine Hütte wartet. Sie hat sogar einen Ofen. Brennholz. Zündhölzer.
Und die beiden heizen –
„Märchen! Märchen!“ tut’s Don Ruvido ab.
„Kindern werden Märchen wahr“, murmelt der Alte und begleitet den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *4.3.2011, freigegeben am 17.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 616 Tor der Liebe
„Ach“, beklagte sich Don Bardoletto, „es ist eben eine Amufi.“
„Meinst du“, fragte der Alte von der Halbinsel, „etwa eine amour fou, eine
törichte Liebe mit –“
„Ja, ja“, bestätigte der Besucher, „das ist es! Es ist wie verhext: Weder geht es recht zusammen noch recht
auseinander. Ein ständiges Hin und Her! Mal denk’ ich: So, jetzt ist es
endlich aus! Und schon glimmt wieder neue Glut auf. Brennt es aber
lichterloh, naht auch schon die nächste kalte Dusche –“
„– und es zischt und qualmt“, ergänzte der Alte. „Klug ist das bestimmt nicht, ein Feuer zu –“
„Aber was wollt Ihr machen?“ versuchte Don Bardoletto, sich zu rechtfertigen.
„Mich selber duschen“, nahm’s der Alte wörtlich, „damit ich sauber –“
„Wenn Euch das Bad gesegnet wird?“ hielt der Besucher dagegen. „Nein, nein; sind wir beide zusammen, dann kehrt jeder seine schlechten Seiten
hervor: SIE spielt die Ungezogene und ich den selbstgerechten Richter –“
„– als Komödie?“ fragte der Alte.
„Als bürgerliches Trauerspiel!“ antwortete Don Bardoletto. „Wie – wie Der
zerbrochene Krug –“
„Meines Wissens ein Lustspiel“, wanderten des Alten Gedanken zurück in seine Schulzeit.
„Lustig ist das bestimmt nicht“, grollte der Besucher, „was SIE mit mir treibt! Kann SIE nicht einmal ein
bißchen –“
„Ja, ja“, zitierte der Alte, „es ist ein Jammer, daß die andern nicht so lieb und gut sind, wie wir selber sein –“
„– sollten“, ergänzte Don Bardoletto.
„– könnten“, verbesserte der Alte.
„Aber ich versuch’s doch immer wieder im Guten“, verteidigte sich der Besucher.
„Wer Gutes sät, wird –“
„– nicht immer Gutes ernten“, sah Don Bardoletto auf das Schwarze. „Vor allem, wenn’s auf das Steinige fällt! Was hab’ ich schon alles –“
„Dann räum die Steine halt weg“, schlug der Alte vor.
„Ihr habt gut reden!“ brummte der Besucher. „Was im Bild
klappt, muß in der Wirklichkeit noch lange nicht –“
„Hast du es schon einmal versucht?“
„Einmal?“ lachte Don Bardoletto bitter. „Da sind Hopfen und Malz –“
„Warum willst du deine Frau überhaupt zu Bier –“
„Freundin!“ verbesserte der Besucher energisch.
„Eigentlich noch nicht einmal das. Bekannte – Nee, welcher Mann kennt schon eine –“
„Nächste“, half der Alte aus.
„Na ja“, bemühte sich Don Bardoletto um Ehrlichkeit, „zuweilen ist SIE auch barmherzig. SIE hat auch ihre
guten –“
„Dann schau doch auf die und freu –“
„Aber hast du nicht gesehen“, blieb der Besucher auf seinem Gedankengang, „prallst du schon gegen ihre schlechten –“
„Nicht daß ich wüßte“, näherte sich der Alte mal wieder Calau.
„Warum müssen Frauen immer täuschen?“
„Da fragst du am besten sie selber“, konnte der Alte nicht besser helfen. „Vielleicht wollen viele Männer betrogen
–“
„Ich bestimmt nicht!“ war sich Don Bardoletto sicher.
„Aus Täuschung wächst Enttäuschung; niemals Vertrauen. Was soll das für
eine Ehe –“
„Soll?“ stieß sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort. „Niemand soll einen Eheversprecher –“
„Da habt Ihr wahrhaft recht!“ pflichtete der Besucher bei. „Aus Eheversprechen werden immer mehr Eheversprecher!“
„Und wer zwingt dich zur Ehe?“
„Eigentlich niemand“, gab der Besucher zu.
„Dann nimm es doch so, wie es ist –“
„Ständig dieses Ungewisse?“ zweifelte der Besucher. „Ich
wollte eigentlich mit IHR Schluß machen –“
„– um deine Eitelkeit zu kitzeln, weil du IHR zuvorgekommen wärest?“ ergänzte der Alte. „Wenn du von dem, was Menschen Liebe nennen, Eitelkeit und Eigenliebe abziehst und es bleibt nichts mehr übrig, ist das noch Liebe?“
„Manchmal weiß ich selber nicht, was Liebe ist“, gestand Don Bardoletto. „Vielleicht hab’ ich gar keine
–“
„Sprachst du nicht vorhin von Glut?“
„Ja; aber dieses ständige Hin und Her – Ach“, resignierte der Besucher, „es geht eben nicht –“
„– wenn du für jetzt schon erwartest“, ergänzte der Alte, „was noch gar nicht ist. Lern doch –“
„Ja, SIE müßte lernen“, brach es in Don Bardoletto wieder hervor, „nämlich nicht mehr zu täuschen!“
„Bei einer amour fou“, gab der Alte zu bedenken, „ist nicht nur eine töricht“, und er begann zu erzählen:
Amaranto hatte keine Freude mehr. Ja, als Kind, da hatte
er noch lachen und jauchzen können; doch nun, als junger Mann, – da freute ihn nichts mehr.
Begegnete ihm eine schöne Frau, so sah er nicht mehr die Schönheit, sondern bereits das verwesende Totengerippe. Stand er vor einem prächtigen Bauwerk, so staunte er nicht über die Pracht, sondern suchte und fand Risse, bröckelnde Steine und
Verfall. Und kam der Frühling mit seinem Blütenzauber, so sah Amaranto nur Welken, Verdorren und Vergehen. Welch ein Jammer! Wer rings um sich nur Sterben sieht, ist der noch am
Leben?
Wohl dem, dessen sich eine gute Fee erbarmt! Allein – noch war es Amaranto
nicht wohl, als ihm seine gute Fee einen Blumentopf mit einer Pflanze schenkte.
Was willst du denn mit d e m Gestrüpp?“ fragte lachend jeder, der Amaranto
besuchte.
„Warten. Pflegen“, antwortete Amaranto und fügte im stillen hinzu: „Das hat mir doch meine gute Fee
geschenkt.“
„Da wird im Leben nichts draus!“ spotteten die Leute.
Aber Amaranto ließ sich nicht entmutigen; denn weil er an seine gute Fee glaubte, meinte er, in jener Pflanze
noch eine Spur von Leben zu gewahren. Und er pflegte, düngte und tränkte, was er für lebendig hielt.
Und plötzlich geschah es: Aus all dem Toten brach eine Blüte hervor, ging auf im Sonnenschein; und alles Tote
fiel zu Boden –“
„– womöglich noch als Dünger“, spottete Don Bardoletto.
„Ja, das siehst du richtig“, bestätigte der Alte. „Und Blüte folgte auf Blüte, so daß sich Amaranto jeden Tag
wieder –“
„Märchen! Nichts als Märchen!“ tat’s der Besucher
ab.
„Suchet“, zitierte der Alte, „so werdet ihr finden“, und geleitete Don
Bardoletto hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *11.3.2011, freigegeben am 18.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 617 Nachtmeister Stropp und der Fall Johannisius
{s44}
„Stropp! Stropp!“ herrschte vor der holden Heimstatt unseres Nachtmeisters eine
strenge Stimme.
Geräusche friedlichen Schlafes kamen als Echo zurück und bezeugten ein sanftes Ruhekissen. Doch statt anzustecken, wirkten sie draußen wie ein Aufputschmittel.
„Stropp! Stropp!“ nahm die Stimme an Schärfe und
Lautstärke zu. „Wird’s bald?“
Der Schläfer drinnen mußte diese Frage als eine rhetorische aufgefaßt haben, denn er blieb die Antwort schuldig und in Morpheus Armen.
„Kannst du nicht hören?“
„Bin im Winterurlaub“, brummte es heraus, gefolgt von Anzeichen, daß der Antwortende weiterzuschlafen gedachte.
„Was schert mich dein Winterurlaub!“ bellte es draußen rücksichtslos. „Du kommst jetzt sofort heraus, oder – oder ich steig’ dir –“
„Der Friedensrichter!“ entsetzte sich drinnen jemand und war mit einem Mal hellwach. „Ich komme! Ich komme!“
„Du willst doch nicht etwa –“, war drinnen eine weitere Stimme geweckt worden. „Unser schöner
Urlaub!“
„Dienst ist Dienst!“ setzte unser Nachtmeister Prioritäten, die bekanntlich bei Ehefrauen sehr unbeliebt
sind.
„– solange du noch im Dienst stehst“, wurde er draußen knurrend empfangen. „Bürschchen, treib es nicht zu
weit!“
„Wen?“ schien es unserem Stropp an Erkenntnis zu
fehlen.
„Deine Unbotmäßigkeit!“ donnerte die Antwort.
„Hattet Ihr sie mir denn anvertraut?“ bat unser Stropp um eine Gedächtnisstütze.
„Stropp!“ brüllte der Friedensrichter. „Bist du so dumm,
oder tust du nur so?“
„Ja“, antwortete unser Igel prompt, doch dann dämmerte es ihm, daß er nicht mit seiner Frau sprach. „Äh, eher
nein.“
„Du machst mich noch wahnsinnnig!“ tobte der Fuchs.
„Ist es das, was Ihr von mir –“
„Das ist nicht zu fassen!“ neigte Reineke dazu, seiner
Prophezeiung zur Erfüllung zu verhelfen, faßte sich aber noch rechtzeitig. „Los! Mitkommen! Dort drüben ist ein Mord begangen worden –“
„Aber das ist doch bereits das Reich Eures Sohnes“, wagte der Igel einzuwenden. „Da ist Stroppelo zuständig
–“
„Eben!“ bestätigte der Fuchs. „Er ist der Mörder des
–“
„Wer sagt das?“ pflanzte sich plötzlich Frau Struppe mit
zornigen Augen vor dem Friedensrichter auf.
„Hörst du –“, Reineke hielt inne. Es war ratsamer, Blitz und Donner nicht unnötig auf sich zu
ziehen. „Reinerle. Der muß es ja –“
„Eure Brut?“ fragte die Igelin, ohne eine Antwort zu erwarten. „Und dem glaubt Ihr? Das kann ich Euch flüstern: Wenn er der einzige Zeuge gegen
unseren Sohn ist, dann werdet Ihr im ganzen Reiche niemanden finden, der ihm Glauben schenkt! Ein Justizirrtum ist das! Jawoll, ein –“
„Nun beruhige dich doch“, beeilte sich der Fuchs, einen offenen Krieg zu vermeiden. „Deswegen bin ich ja
hier. Dein Gatte soll mir helfen, eh, eh –“
„– seinen eigenen Sohn zu überführen?“ ergänzte die Eheliebste unseres Nachtmeister.
„– die Wahrheit zu finden“, fiel dem Fuchs noch rechtzeitig das richtige Stichwort ein.
Dagegen konnte Frau Struppe nichts einwenden und mußte ihren Gatten ziehen lassen; aber sie ahnte nichts
Gutes.
„Den kenn’ ich“, stellte unser Nachtmeister am Tatort sogleich fest. „Das ist der fromme Johannisius –“
„Fromm?“ lachte Reinerle, der seinen Vater und unseren Helden
erwartet hatte. Er verbesserte sich jedoch schnell: „Eh, ist? Fromm
ist? Das einzige, was der noch ist, das ist tot!“
Ob unser Stropp auch so unchristlich dachte, ist nicht überliefert, aber er mußte zugeben: „Der Tod hat ihn getroffen.“
„Und wer war’s?“ wollte Reineke wissen.
„Der Tod“, wiederholte unser Igel prompt. „Ich sagte es –“
„Wer ihn ermordet hat, will ich wissen!“ wurde der Fuchs lauter.
„Den Tod?“ zweifelte unser Igel, recht gehört zu haben.
„Der lebt doch –“
„Stropp!“ blitzte und donnerte es nun. „Ich hab’ dich
nicht hierhingebracht, Unsinn zu faseln! Du sollst mir beweisen, daß der da“, damit wies er auf einen kleinen, verschüchterten Igel,
der von Reinerle streng bewacht wurde, „der Täter ist!“
„Stroppelo?“ schien unser Nachtmeister nichts zu begreifen. „Aber der tut doch gar nichts. Er ist allerdings mein Sohn, wenn Ihr das –“
„Stropp!“ näherte sich Reineke gefährlich dem Siedepunkt. „Du – sollst – beweisen, – daß – er – den – Eichkater – da – umgebracht – hat! –
Verstanden?“
„Nein. Ja“, legte unser Stropp Wert auf die richtige Reihenfolge. Und schon begann sein treffliches
Gehirn zu arbeiten. „Täter kann nur gewesen sein, wer – wer am Tatort war –“
„Hahaha“, lachte Reinerle. „Papa, hast du das gehört? Gleich wird er noch sich selbst über–“
„– zur Tatzeit“, schränkte unser Nachtmeister ein. „Also kann ich es nicht gewesen sein, denn ich habe
geschlafen –“
„Beweise!“ forderte der junge Fuchs.
„Meine Gattin und ich können es bezeugen“, rechtfertigte sich unser Igel. „Und das reicht! Und als Ihr hier eingetroffen seid, Herr Friedensrichter, war Johannisius schon tot.
Also bleibt nur noch als Täter übrig – als Täter: der Tod!“
„Und dein Sohn?“ widersprach Reineke. „Der war vor dir
hier –“
„Und lebte da Johannisius noch?“ fragte unser Igel.
„Nein“, antwortete Stroppelo.
„Nun“, berichtete unser Stropp nach seiner Rückkehr, „es half alles nichts! Stroppelo wurde abgeführt und soll
heute abend abgeurteilt werden. Doch unterwegs ist mir einiges aufgefallen –“
Die Gerichtsverhandlung war öffentlich, und viele Tiere waren erschienen. Allein – es zeigte sich schnell, wie
der Friedensrichter den Prozeß zu lenken gesonnen war.
Und schon erhob Reineke seine Stimme: „Somit verurteilen Wir dich, Stroppelo, mißratener Abkömmling von Frau Struppe und Stropp, im Namen von Volk und Reich zum –“
„Au! Au!“ klagte plötzlich Reinerle. „Er hat mich getroffen, Papa, –“
„Wer?“ fragte der bestürzte Vater.
„Johannisius. Er wirft wieder mit –“, Reinerle hielt inne. „Aber den hab' ich doch –“
„Reinerle!“ hinderte der Friedensrichter seinen Sohn am Weiterreden.
„– umgebracht“, ergänzte unser Nachtmeister jedoch unerschrocken. „Und hier sind 3 Zeugen, die es gesehen
–“
„Spatzenpack!“ versuchte Reinerle verächtlich zu machen.
Aber sein Vater mochte einsehen, daß die Schlacht für dieses Mal verloren war. „Die Verhandlung ist
geschlossen, eh, Stroppelo sprechen Wir hiermit frei, eh, aus Mangel an Beweisen, eh, die Kosten des Verfahrens ,eh, trägt –“
„– der Steuerzahler“, entfuhr es Frau Struppe. Doch noch ehe Reineke aufbrausen konnte, zog sie Sohn und
Gatten mit sich fort. „Ach, Stropp, ich bin ja so stolz auf dich!“
Und unser Stropp seufzte dankbar: „Wenn ich dich nicht hätte!“
© Stiftung Stückwerken, *17.3.2011, freigegeben am 24.6.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 618 Die stinkende Stadt
„Mir das!“ war Don Kollettore sich selber zu schnell. „Bei meinen Erfahrungen!“
„So?“ zeugte der Alte von der Halbinsel davon, daß er noch zuhörte, jedoch nichts verstand.
„Ich muß mir von so einem jungen Schnösel sagen lassen“, stürmte der Besucher ungebremst weiter, „wie ich meine Arbeit zu machen habe?“
„Muß?“ griff der Alte auf.
„So hat der sich jedenfalls aufgeführt, dieser – dieser Besserwisser!“
„Der alte Streit zwischen den Generationen –“
„Also, so etwas hätte ich mir früher nicht erlaubt –“
„Früher“, seufzte der Alte, „wann war das?“
„Na, vor dieser neuen Generation“, wußte Don Kollettore gleich eine Antwort, „die meint, alles funktioniere so, wie es im Lehrbuch steht.“
„Und wer hat diese Lehrbücher geschrieben?“
„Lehrer“, grollte der Besucher, „Menschen, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan haben, als an ihrem Schreibtisch zu sitzen oder dummes Zeug zu
schwätzen. Und für dieses Nichtstun bekommen die auch noch Geld.“
„Du hast die Ruheständler vergessen –“
„Ja, ja“, pflichtete Don Kollettore bei, „das ist auch so ein Übel der Menschheit! Nun haben sie viel Zeit und
glauben, ihre Torheiten weitergeben zu –“
„Und welcher Generation gehören diese Lehrer und Ruheständler an?“
„Jedenfalls“, versuchte der Besucher abzulenken, „der kann in Zukunft noch was erleben! Mir gegenüber den Chef
spielen zu wollen! Nein, dem werd’ ich es noch eintränken! Das werd’ ich
dem nie –“
„Und dann wird er dir das nie vergessen“, führte der Alte weiter, „und schon beginnt eine neue Runde –“
„Aber was soll ich denn tun?“ rechtfertigte sich Don Kollettore. „Soll ich mir das etwa gefallen –“
„Soll?“ rieb sich der Alte mal wieder. „Nichts sollst du! Kannst du ungeschehen machen, was geschehen ist?“
„Nein“, mußte der Besucher zugeben.
„Wozu verschwendest du dann darauf deine Kräfte? Reibst dich daran auf? Ärgerst dich sogar selber?“
„Aber wo führt das denn hin“, gab sich Don Kollettore nicht geschlagen, „den Karren laufen zu lassen? Seit
wann kämpft Ihr für die Gleichgültigkeit?“
„Hoffentlich nie“, antwortete der Alte. „Es ist bestimmt nicht gleichgültig, allen Schmutz der Vergangenheit
immer wieder aufzugreifen oder – ihn loszulassen und seine Kräfte darauf zu verwenden, daß es in Zukunft besser wird.“ Und er begann zu
erzählen:
Es war aber eine Stadt, die – in der stank es gewaltig; und zwar derart gewaltig, daß die Bürger den
Herrn der Stadt hart bedrängten: Entweder er schaffe Abhilfe, oder er müsse abdanken.
Diese Art von Dankbarkeit ist bei Herrschern gemeinhin sehr unbeliebt und gilt bei ihnen als schlechter Lohn mit schlechten Zinsen. Deshalb setzte der Herr der stinkenden Stadt sein Bestes daran, die Gemüter seiner Bürger zu besänftigen.
Sein Bestes? – Das war zweifellos seine Tochter, zumal diese sich
willig bereit erklärte, sich für Vater und Stadt zu opfern: Wer die Stadt vom Gestank befreie, dem wolle sie eine treue Eheliebste sein.
Nun – ob die Ehe ein Opfer bedeute, darüber gehen die Meinungen auseinander. Allein – jeder Mann wird zugeben
müssen, daß ein Ehejoch nicht leicht und deshalb besser zu zweit zu tragen sei. Und ob dies mit Pascino ein Vergnügen gewesen wäre –?
Pascino war nämlich der 1. Kandidat, der die Stadt von ihrem Gestank befreien wollte. An allem seien die
Frauen schuld, glaubte er herausgefunden zu haben. Sie müßten nur sattsam im Waschen unterwiesen werden, und schon täte sich alles in
lieblichen Duft und Wohlgefallen auflösen.
Jedoch – solch ein Fund zeitigt keinen hohen Finderlohn, was bekanntlich bereits Adam erleben mußte. Wurde dieser aus dem Paradies vertrieben, so mußte Pascino bald die Stadt verlassen.
Für jenen eine harte Strafe, für diesen erträglich, denn infolge der Unterweisungen hatte sich der Gestank nicht vermindert.
Estero, der 2. Kandidat, schien zunächst erfolgreicher zu sein. Er war so klug, nicht einer bestimmte Gruppe die Schuld zuzuweisen, sondern das Übel in seiner Wirkung zu bekämpfen. Er empfahl nämlich allen Bürgern, sich die Nase zukleben zu lassen. Ein solcher
Vorschlag war außergewöhnlich, er war neu, er war überzeugend, und alle lobten ihn als einen klugen Einfall. Doch hatten die Bürger
bisher über einen schlechten Geruch geklagt, so beschwerten sich bald immer mehr über einen schlechten Geschmack. Somit konnten die
Hochzeitsglocken noch immer nicht läuten, und Estero mußte sich eine neue Bleibe suchen. Was nun?
Da meldete sich im Palast des Stadtherrn ein 3. Kandidat: Manuelo. Er hatte ein Landgut außerhalb des
Dunstkreises der Stadt und war von ungefähr hereingekommen. Vielleicht könne er helfen, denn er verstehe etwas von Ackerbau und
Viehzucht, und diese beiden Bereiche könnten oft als Gleichnis für das menschliche Leben dienen.
Er verließ auch gleich den Palast und schaute sich um, und dabei sah er Eigenartiges: Die Bürger hatten nämlich die Angewohnheit, ihr Nachtgeschirr und ihre sonstigen
Gefäße für alles Unreine auf die Gasse zu entleeren. Und war dann die Dunkelheit eingebrochen, so schlich jeder unter die Fenster
seiner Nachbarn, wühlte in dessen Kot und Kehricht herum und warf den Schmutz in das Haus des Nachbarn zurück. Daß es dadurch in den
Häusern nicht lieblicher duftete, wirst du gewiß nicht bestreiten; aber auch die Hände der Werfenden strahlten nicht vor
Sauberkeit. Wie das ändern?
Ganz einfach, dachte Manuelo. Ich muß Kot und Schmutz bei den Bürgern abholen und wegbringen, so daß sie ihn
nicht mehr zurückholen können. Und ich – ich dünge damit meine –
„So ein Quatsch!“ fühlte sich Don Kollettore berufen, im Namen aller zu sprechen, die dieses Thema für unanständig
halten. „Soll ich etwa –“
„Soll?“ griff der Alte mitleidig auf. „Nichts sollst
du! Wir dürfen! Wir dürfen die Menschen von ihrem Schmutz trennen, statt
mit ihm zu werfen. Und wir dürfen zusehen, ihn in Dünger zu verwandeln.“
Damit geleitete er den Besucher wieder hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *24.+28.3.2011, freigegeben
am 18.7.2024
Qouz-Note: 4
***
MamM 619 Feste
fasten
Es ist ja auch so vorgeschrieben“, rechtfertigte sich Don Severino.
„So?“ Mehr wußte der Alte von der Halbinsel nicht zu sagen, denn er hatte nicht zugehört.
„Obwohl sich das in den letzten Jahren sehr gelockert hat. Unsere Kirchenfürsten hören eben immer mehr auf den
Zeitgeist –“
„– und darauf, was ihnen frommt“, ergänzte der Alte.
„Ja“, lachte der Besucher, „frommen – ein zweideutiges Wort –“
„– oder ein Wort“, verfiel der Alte in die Rolle eines Gelehrten, „dessen Bedeutung sich mit dem Zeitbezug wandelt. Was mir heute frommt, –“
„Sogar Sekt wurde am Sonntag ausgeschenkt“, kehrte Don Severino zu seinem Thema zurück. „Der Herr Pfarrer
hatte nämlich Geburtstag. Aber Sekt? Sekt in der Fastenzeit?“
„Sind die Sonntage nicht davon ausgenommen?“ war sich der Alte nicht sicher.
„Ich bitte Euch“, unterschlug der Besucher, was er begehrte. „Soll uns nicht die Fastenzeit an das Fasten
Jesu erinnern? Hat er etwa sein Fasten alle 7 Tage unterbrochen? Und dann mit Sekt?“
„Da mußt du ihn mal selber fragen“, drückte sich der Alte vor einer Antwort. „Aber was du mir da erzählst,
zeigt mal wieder eine üble Folge des Fastens –“
„So?“ ahnte Don Severino den Tadel nicht.
„Oder gar 2 üble Folgen“, verbesserte sich der Alte. „Erstlich, daß jeder darauf schaut, wie die andern von
seinen Vorschriften abweichen. Und zweitens das Sollen –“
„Aber diese Pflicht vereint doch“, wandte der Besucher ein. „Was wäre das für ein Durcheinander, wenn jeder
fastet, wann und wozu er aufgelegt ist?“
„Wie das eint, siehst du ja“, ließ sich der Alte nicht überzeugen, „jeder achtet darauf, wie die andern gegen diese Pflicht verstoßen –“
„Seid Ihr denn gegen das Fasten?“
Statt einer Antwort schlug der Alte sein abgegriffenes Buch auf, blätterte darin und reichte es dann dem Besucher: „Hier, wie liesest du?“
Und dieser las: „Ihr fastet, daß ihr hadert und zanket und schlaget mit gottloser Faust. –
Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle: Laß los, welche du mit Unrecht gebunden hast; laß ledig, welche du
beschwerst; gib frei, welche du drängst; reiß weg allerlei Last; brich dem Hungrigen dein Brot, und die, so im Elend sind,
führe ins Haus; so du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. – Aber sollen wir denn nicht
enthaltsam –“
„Sollen?“ grollte der Alte. „Ein Wagen soll fahren, eine
Maschine soll funktionieren; der Mensch aber darf –“
„Eure liberalen Auffassungen decken sich aber nicht mit der Lehre der Kirche –“
„– der herrschenden Meinung“, verbesserte der Alte, „aber mit der dienenden?“
„Na ja“, lenkte Don Severino ein, „Ihr seht nicht danach aus, als ob Ihr das Fasten nötig hättet. Aber es kann
auch nützlich sein, zum Beispiel, wenn einer gelobt, dieses oder jenes Laster –“
„Gelobt?“ grollte der Alte wie bei dem Sollen.
„Und es wird mit demselben Menschen hernach 7mal ärger denn zuvor?“
„Na, na, na, das muß aber nicht zwangsläufig so sein –“
„Nein“, gab der Alte zu, „es gibt auch Menschen, die rühmen sich ihrer Selbstbeherrschung, als seien sie mit Gott auf gleicher
Augenhöhe –“
„Es gibt aber auch Menschen“, sah Don Severino anders, „die schaffen es, etwas endgültig unter die Füße zu bringen. Nehmt nur meinen Nachbarn: von heute auf morgen kein Alkohol mehr und keinen Tabak –“
„Ist er nun besser – oder besser dran?“ lachte der Alte.
„Es sei ihm gegönnt. Allein – vermutlich war’s bei ihm aber kein Sollen, sondern ein Wollen.“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal, so will es die Geschichte, ein junger Mann, der hieß Giovano. Und dieser Giovano hatte gehört,
die Prinzessin vom goldenen Berge sei entführt worden.
Gewiß hatte er irgendwo von ihr ein Bild gesehen und sich verguckt, denn er machte sich auf den Weg, die Prinzessin zu befreien. Doch war ihm bewußt, daß seinem Wissen und seinen Kräften Grenzen gesetzt waren, und deshalb bat er seine gute
Fee, ihn unsichtbar zu begleiten.
Zunächst führte ihn der Weg durch ein reiches Land. An allen Ecken boten prächtig gekleidete Händler fette
Speisen, Süßigkeiten und Spirituosen feil.
Doch die gute Fee warnte ihren Schützling: „Nimm nicht davon, selbst wenn sie’s dir schenken wollen. Denn sieh
nur, wie es denen geht, die solches annehmen.“
Und Giovano sah, wie die Bürger vor ihren Häusern saßen und zu keinem guten Werk geschickt waren. Das einzige,
wozu sie sich noch aufraffen konnten, war: bei den Händlern Nachschub zu kaufen; und dazu brauchten die meisten Kutschen oder Sänften,
oder sie ließen sich Speis’ und Trank sogar bringen. Einige hatten zwar Spaß und Gelächter, aber es war den starken Getränken
geschuldet. Und wer sich nicht rechtzeitig bei den Händlern eindeckte, dem ging es sehr übel.
Und Giovano bedankte sich bei seiner guten Fee, daß sie ihm die Freiheit erhalten hatte, und er kaufte nichts und ließ sich auch nichts schenken, bis er in das nächste
Land kam.
Das war ein dürres, armes Land. Deshalb erhielt der hungrige Wanderer gleich hinter der Grenze ein Brot und
eine Flasche Wein von seiner guten Fee. „Iß und trink“, ermunterte sie ihn, „und schau, wie es den Bürgern dieses Landes
geht.“
Sogleich gewahrte Giovano einen Bettler, und er ging zu ihm und teilte mit ihm Brot und Wein. Und beide wurden
satt. Dennoch blieb so viel übrig, daß Giovano auch bei seiner nächsten Begegnung einladen konnte: „Komm, Schwester, iß und trink mit
mir; es wird schon für uns beide reichen.“
Und eigenartig: Sooft Giovano Speis’ und Trank teilte, so oft blieb genug übrig für die nächste Mahlzeit.
So kam er endlich in das 3. Reich. Dort lebten böse Menschen, und sie waren es auch, welche die Prinzessin vom
goldenen Berge entführt hatten.
„Soll ich mir ein Schwert kaufen“, fragte Giovano seine gute Fee, „und alle totschlagen?“
„Soll?“ Auch die gute Fee schien dieses Wort nicht zu mögen. „Hast du denn nichts, das zum Leben hilft? Doch sing nicht ihre losen Lieder, nimm
auch nicht an, was ihnen gehört, sondern teile mit ihnen deine guten Gaben.
Und Giovano lehnte die Früchte des Landes ab und teilte aus: sein Brot, seinen Wein und seine Lieder. Und die
bösen Bürger nahmen’s an und wurden plötzlich etwas, was sie bisher gar nicht kannten: Sie wurden glücklich. Und vor lauter Glück und
Freude gaben sie Giovano, was ihnen gar nicht gehörte, – was sie nämlich geraubt –
„Aber was hat das alles mit dem Fasten zu tun?“ unterbrach Don Severino.
„Mach die Menschen glücklich“, schien der Alte gar nicht auf die Frage einzugehen, „dann hilfst du ihrer Güte, meinte jener
russische Lebenshelfer“, und er geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *31.3.2011, freigegeben am 20.7.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 620 Was ist Liebe?
„Was ist Liebe?“ Don Dottino genoß die Überraschung, welche diese Frage
auslöste. „Gar nicht so einfach, wie? Daran hat sich schon mancher die
Zähne –“
„So will ich nicht mancher sein“, lachte der Alte von der Halbinsel. „Frag doch den lieben Gott, der muß es ja –“
„Wieso der?“
„Weil Gott Liebe ist“, antwortete der Alte.
„Womit wir so schlau sind wie vorher“, brummte der Besucher, „nur auf höherem Niveau. Keiner weiß, wer und was
Gott ist; also weiß auch kein Mensch, was Liebe ist. Basta!“
„Eigentlich ja“, nahm’s der Alte wörtlich, „denn was wir Menschen zu wissen wähnen, kann nie genug sein. Aber
bevor du dich selber ärgerst, hier – wie liesest du?“ Und der Alte schlug sein abgegriffenes Buch auf, blätterte und reichte es dann
dem Besucher.
Und dieser las: „Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie blähet sich
nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber
der Wahrheit; sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf – Aber welcher
Mensch kann so lieben?“
„Niemand“, gab der Alte zu.
„Dann hätten also Menschen gar keine Liebe?“
„Doch“, rückte der Alte zurecht. „Der eine weniger, die andere mehr“, und er begann zu erzählen:
In den alten Zeiten wurde manche Tat noch mit dem Tode geahndet, und es läßt sich trefflich darüber streiten, wer dabei das größere Verbrechen beging.
Und wenn wir heute nicht nur darüber, sondern auch über die Richter und Henker jener Zeit zu Gericht säßen, wären wir keinen Deut besser. Es ist schon ein Jammer, daß wir Menschen eher
geneigt sind, zu richten und hinzurichten, denn zu helfen und aufzurichten.
Das mußte auch Geronimo erleben. Schon sein Name hatte
etwas Wildes an sich; und als er eines Tages ergriffen und in das Gefängnis abgeführt wurde, ernannte sich mancher im nachhinein zum
Propheten: Er habe schon immer sagt, mit dem werde es einmal ein schlimmes Ende nehmen, und nun sei es offenbar.
Mit Geronimo stand es mährsächlich schlimm. Bald wurde über ihn Gericht gehalten, und Richter von Ödenthal bekundete im Laufe der Verhandlung mehr als einmal, die Lage sei ernst und eindeutig. Nächtlicher Raubüberfall auf den königlichen Hofjuwelier. Geronimo sei in der Nähe
gesehen worden. Beutestücke seien bei ihm gefunden worden.
Schuldig! Todesstrafe!
Nun war es damals Sitte und Gesetz, daß ein Todesurteil erst dann rechtskräftig war, sobald es die Unterschrift des König trug. So gelangte auch der über Geronimo verhängte Todesspruch in das Kabinett des Königs.
Immer wieder tunkte dieser die Feder ein, doch immer wieder hielt ihn etwas ab, das Urteil zu unterschreiben.
Endlich ließ er es auf seinem Schreibtisch liegen und ging zu Bett. Unruhig war sein Schlaf, immer wieder wachte er auf; und als er merkte, daß der Schlaf nicht mehr zurückkehren wollte, stand er auf. Er
legte schichte Kleider an und beschloß, ein bißchen spazierenzugehen.
So früh war er schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Zwar zogen bereits die ersten Händler zum Markt,
ansonsten waren aber die Gassen still und leer.
Nur vor einem stählernen Tor warteten schon einige Menschen auf Einlaß. Links und rechts vom Tor eine hohe
Mauer, auf dieser anscheinend Stacheldraht. Ein unheimlicher Ort.
Gerade öffnete sich das Tor einen kleinen Spalt, und ein bewaffneter Wächter kam heraus. Rasch trat der König hinzu, deutete auf die Wartenden und fragte den Wächter, was dies für Leute seien.
„Mütter!“ lautete die knappe Antwort.
„Und was wollen die hier?“
„Ihre Söhne besuchen.“
„Ach ja,“, dämmerte es dem König, „das ist hier das Gefängnis! Haben denn die Häftlinge keine Väter
mehr?“
„Leiblich schon“, räumte der Wächter ein. „Doch wenn Ihr einen dieser Väter fragt, so wird er Euch entweder
sagen, sein Sohn sei für ihn tot, oder, er habe keinen Sohn.“
„Und Frau und Kinder?“
„Da ist es ähnlich“, antwortete der Wächter. „Das Leben läge ja noch vor ihnen. Einen Verbrecher hätte sie niemals geheiratet. Es gelte, Schaden von den Kindern
fernzuhalten.“
„Und die Mütter?“
„Die sind zäh“, antwortete der Wächter. „Die denken nicht an sich –“
Ob denn auch die Mutter jenes Geronimo hier warte?
„Da hinten steht sie“, und der Wächter deutete auf eine verhärmte Frau.
Der König trat sogleich zu ihr, sprach sie an und entdeckte schnell, daß jener Sohn der Mutter ein und alles war.
Warum der Sohn denn kein Gnadengesuch eingereicht habe?
„Aber er ist doch unschuldig!“ war sich die Mutter sicher.
Könne sie die Unschuld beweisen?
„Nein“, gab die Mutter zu, „aber ich fühle es – im Herzen.“
Und wenn sie sich irre?
„So bleibt er doch mein Sohn“, bekannte die Mutter freimütig, „und ich wollte, die Strafe fiele auf mich; denn
ich habe nicht gewußt, zu helfen.“
„Das haben viele nicht gewußt“, wandte der König ein.
„Eben!“ hakte die Mutter ein. „Es gibt nie einen
einzigen Schuldigen. Doch Geronimo ist unschuldig –“
Nachdenklich kehrte der König auf sein Schloß zurück. Der Glaube jener Mutter hatte ihn stark beeindruckt, und
er legte das Todesurteil erst einmal beiseite – ohne Unterschrift.
Was wäre, wenn – die Mutter richtig fühlte? Dann müßte ein anderer der Täter sein. Und wer? Jemand, der aus der Tat Nutzen zöge. Und der König schaute sich heimlich um. Was war anders? Wer war anders? – Ach!
Wie prächtig sich Richter von Ödenthal plötzlich kleidete! Eine neue Kutsche! Ein neues Palais wolle er mieten! Vielleicht sogar kaufen. Große Erbschaft! So?
Der König forschte heimlich weiter; besuchte Geronimo in dessen Zelle, besuchte Zeugen. Nein, direkt erkannt hätten sie Geronimo nicht; es sei ja dunkel gewesen; aber die Kleidung – Die aber war Geronimo kurz zuvor gestohlen worden.
Schließlich besuchte der König auch Richter von Ödenthal.
Ob er ihm die gefundenen Beutestücke zeigen könne?
Die seien nach dem Prozeß selbstverständlich an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben worden.
Doch da waren sie nie angekommen. Auch geerbt hatte Richter von Ödenthal in der letzten Zeit
nichts. Eine Hausdurchsuchung förderte einen großen Teil der Beute zutage.
Richter von Ödenthal wurde angeklagt und verurteilt.
Doch seltsam – mit dem Urteil landete auf des Königs Schreibtisch ein Bittgesuch – unterschrieben von Geronimo und dessen Mutter. Sie baten um Gnade für –
„– einen Verbrecher?“ empörte sich Don Dottino.
„Sie läßt sich nicht erbittern“, zitierte der Alte, „sie rechnet das Böse nicht
zu. Die Liebe höret nimmer auf –“, und er geleitete den Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *7.-8.4.2011, freigegeben am 20.7.2024
Qouz-Note: 2
***
- MamM Titelverzeichnis
- MamM 0a bis 20
- MamM 301 bis 320
- MamM 321 bis 340
- MamM 341 bis 360
- MamM 361 bis 380
- MamM 401 bis 420
- MamM 441 bis 460
- MamM 481 bis 500
- MamM 601 bis 620
- MamM 621 bis 640
- MamM 641 bis 660
- MamM 681 bis 700
- MamM 801 bis 820
- MamM 821 bis 840
- MamM 841 bis 860
- MamM 861 bis 880
- MamM 881 bis 900
- MamM 1.001 bis 1.020
- MamM 1.021 bis 1.040
- MamM 1.041 bis 1.060
- MamM 1.061 bis 1.080
- MamM 1.081 bis 1.100
- MamM 1.101 bis 1.120
- MamM 1.121 bis 1.140
- MamM 1.141 bis 1.160
- MamM 1.161 bis 1.180
- MamM 1.181 bis 1.200
- MamM 1.201 bis 1.220
- MamM 1.221 bis 1.240
Jüngstes Update:
21.7.2025