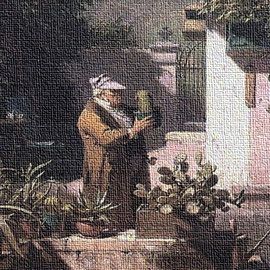MamM – Mährchen an meine Mutter Nr 1.221 bis 1.240
Überblick MamM 1.221 bis 1.236
1.221 Miesepeter – Immerfroh (*7.-8.3.2024)
1.222 Hildebiene und Lenzel (*14.-15.3.2024)
1.223 Nachtmeister Stropp und der Fall Zachälino (*21.3.2024)
1.224 Mariatha (*28.3.2024)
1.225 Golding, der goldene Hase (*4.4.2024)
1.226 Schizose? (*2.5.2024)
1.227 Der Palast (*7.6.2024)
1.228 Andrea und die Tischgemeinschaft (*13.-14.6.2024)
1.229 Von der Macht des kindlichen Vertrauens (*21.6.2024)
1.230 So ich dir? (*27.6.2024)
1.231 Eine große Familie (*4.7.2024)
1.232 Der Spielgeher Unterwalt (*12.7.2024)
1.233 Die Hirtenschule (*19.7.2024)
1.234 Es allen recht machen? (*26.7.2024)
1.235 Sonntagsstaat (*13.9.2024)
1.236 Souverän (*19.9.2024)
________________________________________________
MamM 1.221 Miesepeter – Immerfroh
„Auf was ist denn heute noch Verlaß?“ würzte Don Griesegrim sein Vorurteil
hinein. „Was? Wie? Ich könnt’ manchmal in die Luft –“
„Aber dafür sind wir Menschen nun mal nicht gemacht“, bezweifelte der Alte von der Halbinsel dieses Können. „Andererseits kann’s schon ein Gewinn sein, die Sorgentäler zu verlassen und sie von
oben zu –“
„Haarspalterei!“ tat’s der Besucher verächtlich ab. „Die
Leute haben schon recht, wenn sie Euch nachsagen, –“
„Ja, ja“, lachte der Alte, „solange Gerüchte nicht vorauslaufen, geht’s – Aber sag, ärgerst du dich etwa selber?“
„Und wie!“ gab Don Griesegrim offen zu. „Deshalb bin ich
ja hier. Ihr wißt nicht vielleicht, wie sich das ändern –“
„Ganz einfach“, mußte der Alte nicht lange suchen: „Mach einfach etwas anderes. Freu dich eben selber, anstatt
dich –“
„So schlau bin ich auch“, argwöhnte der Besucher Spott.
„Dann tu’s doch!“ versuchte der Alte Mut zu machen. „Es
geht eben nicht gleichzeitig: sowohl sich selber zu ärgern als auch sich selber zu –“
„Ihr habt gut reden“, blieb Don Griesegrim ablehnend. „Aber anscheinend muß es eben Pechvögel geben, denen
alles mißrät, und Glückskinder, wie zum Beispiel –“
„Dich“, ergänzte der Alte flink. „Hast du in deinem Leben nie Glück gehabt? Ist dir wirklich a l l e s danebengegangen?“ Und er
begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß – der wurde Miesepeter genannt. Ein nicht mehr ganz junger König. Seine Frau war ihm nach den Flitterwochen
davongelaufen, Kinder hatte er keine, und der Haussegen hing nicht schief, sondern war längst von der Wand gefallen.
Nun ja, wem’s zu Hause nicht mehr gefällt, der muß eben unter die Leute gehen. Doch da war alles noch
schlimmer! Kein Respekt mehr vor der Würde oder wenigstens vor dem Alter!
Obwohl – einen Bilderkult für seine Person hatte Miesepeter nie eingeführt. Weder in den Amtsstuben noch in den Schulen, noch in den
Wohnungen hing ein Bild von ihm. Herolde zogen auch nicht vor ihm her, und sich in einer Sänfte tragen zu lassen, das war ihm ebenfalls
fremd. Und Purpurmantel und Krone? Nein, im Winter trug er draußen einen
abgetragenen grauen Mantel und darunter einen Pullover mit Ellenbogenausgängen sowie im Sommer ein vergilbtes Hemd mit gewesenen, nun aber abgestumpften und entblößten Kragenspitzen, und das über
einer Hose in Holbergs gammel –, nein, im romantischen Emmentaler Stil. Der König hatte
eben keine Frau, die nach ihm guckte. Kurz, – da er nie Bittsteller empfing und sein Schloß nur durch einen Geheimgang verließ, sah in
ihm niemand eine Majestät, sondern jeder eine Indignität.
Bist du als Fußgänger bereits den Reitern und Kutschern ein Nichts, so war’s Miesepeter allen Menschen.
Niemand dankte seinen Gruß. Machte er auf dem Weg Entgegenkommenden Platz, nahmen es klein und groß als
Selbstverständlichkeit. Und der Paketkutscher war so frech, den Fußweg mit seiner Kutsche zuzustellen, so daß Miesepeter auf der
Fahrbahn sein Leben riskieren mußte. Und alles Tag für Tag.
Tscha, wohin geht, wem’s im Hause, aber auch unter den Leuten nicht gefällt? An die Arbeit? Da lauern jedoch die Tücken der Objekte. Die Schreibfeder schreibt nicht tintig, sondern furcht und gräbt ins Papier. Zum Fenster strömt keine frische Luft herein, sondern der beißende oder stickige Rauch aus den Kaminen. Und willst du auf Strümpfen durchs Zimmer gehen, ist dir ein Stuhlbein oder ein Tischbein ein Holz
des Anstoßes.
Also doch besser in die freie Natur? Freie? Über
den Waldwegen liegen schon seit Monaten umgestürzte Bäume. Und wurden doch mal Baumstämme abtransportiert, so hat dies die Wege in
Wasserstraßen verwandelt, mit schmalen, glitschigen Ufern, denen nicht zu trauen ist. Und wenn dich obendrein noch Meister Specht
auslacht, dann fangen selbst gelassenere Menschen irgendwann an zu kochen. Und König Miesepeter erst recht!
Nein, so durfte es einfach nicht weitergehen! Es war unserem König, als stehe der 1. Schlagfluß vor der Türe
und wolle gerade anklopfen.
Zunächst klopfte aber jemand anderes. Der König saß gerade an seinem Schreibpult und rief „Herein!“ Der Anklopfende sah’s aber anscheinend aus einer anderen Perspektive, ging nicht hinein, sondern klopfte erneut. Dieses Spiel wiederholte sich noch einmal, gereichte dem König jedoch ganz und gar nicht zur Belustigung. Zornig stand er auf, riß die Tür auf und wollte gerade seine Schimpfkanonen blitzen und donnern lassen, da – da fiel sein Blick auf: einen
Igel! Und hast du nicht gesehen, war dieser bereits ins Kabinett geflitzt und – konnte er etwa zaubern? Jedenfalls – schon hatte er auf dem Schreibpult Platz genommen; und lud den König
ein, es sich gemütlich zu machen, als wäre dieser der Gast. Miesepeter wußte nicht, was er sagen konnte, tat aber, wozu er
eingeladen.
„Hab’ gehört“, begann der Igel sogleich, „Er sei dabei, sich zu Tode zu ärgern. Ist Er wirklich so
dumm? Mach Er’s doch so wie ich: Freu’ Er sich zu Leben. Dann ist Seine
Erdenreise bedeutend glücklicher; und Er hat am Ende nicht so viele Selbstvorwürfe im Gepäck.“
War’s nicht gerade dieses Glück, was er seit langem vergeblich suchte? Deshalb überhörte Miesepeter die
Unbotmäßigkeiten des Igels und bat mit großem Interesse um genauere Auskünfte.
„Na also!“ fühlte sich der Igel in seiner Zuversicht bestätigt. „Als erstes brauchst du einen Freund. Einen immer gut gelaunten Freund. Also mich! Und der ist ständig bei dir. Und wann immer dir eine Laus über die Leber läuft, schaust du mich an, und schon isse weg.“
Aber er könne den Herrn Igel doch nicht überallhin mitnehmen, hielt der König dagegen.
„Dann kaufst du dir eben eine Hutschachtel oder eine Tortenschachtel“, war der Igel um eine Antwort nicht verlegen, „polsterst sie gut und bequem aus, legst gesunde
Leckereien hinein, und schon –“
„– komm’ ich nicht mehr mit“, konnte sich Don Griesegrim nicht länger zurückhalten. „Wo soll ich einen Igel
–?“
„Nichts sollst du“, rieb sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort. „Der Igel war ja noch nicht
fertig. Als nächstes riet er dazu, die Hofkapelle neu aufleben zu lassen, auf daß sie künftig jede Tafel mit rheinischer Frohsinnmusik
bereichere. Und dann müsse der König einen Blumengarten anlegen, in dem zu jeder Jahreszeit etwas blühe. Und dieses Anlegen wäre keine Aufgabe für den Schloßgärtner, sondern für den König selber. Und schließlich müsse er sich den Namen Immerfroh zulegen, nicht als Titel, sondern als
lebenslange –“
Doch da bemerkte der Alte, daß er wieder allein war und kein Igel.
© Stiftung Stückwerken, *7.-8.3.2024, freigegeben am 16.3.2024
Qouz-Note: 3+
***
MamM 1.222 Hildebiene und Lenzel
„Hauptsache“, konzentrierte Don Ichenberger, „ich bin der letzte, der dann hinter sich die Tür zumacht!“
„Im Gefängnis?“ war der Alte von der Halbinsel eben kein môderner Intellektueller.
„Wo denkt Ihr hin!“ fühlte sich der Besucher überlegen.
„Im Hochzeitssaal. Wenn der HErr –“
„Und dann?“ schien’s den Alten nicht aus seiner Gelassenheit zu reißen.
„Dann wird erst mal gefeiert“, freute sich Don Ichenberger.
„Ach so“, schien der Alte die Überflüssigkeit seiner Frage nun auch selbst zu erkennen, „is’ ja Hochzeit. Und
dann?“
„Na, das wißt Ihr doch“, wurde des Besuchers Nachsicht anscheinend heute hart geprüft. „Dann wird
regiert. Als König! Und mit eisernem –“
„Meinst du etwa das 1.000jährige Friedensreich?“ hatte der Alte dazu wohl andere Erwartungen.
„Richtig!“ meinte Don Ichenberger das Reich, nicht die Erwartungen. „So 5 bis 10 Städte unter mir müßten da schon drin sein. Freilich – offen gesagt: Bei
Euch wär’ ich mir da nicht so sicher. Zuwenig Erwählungsbewußtsein! Zu
viele Kontakte zu Andersgläubigen! Es heißt, Ihr hättet das Vaterunser sogar schon mit
Atheisten gebetet und –“
„– hab’s so gemeint und niemanden ausgegrenzt“, ergänzte der Alte.
„Seht Ihr“, fühlte sich der Besucher bestätigt, „und deshalb bin ich hier! Vielleicht seid gerade Ihr
das letzte Schaf um Mitternacht, das noch eingebracht werden muß und weshalb der HErr noch immer nicht gekommen ist. Geht in Euch und tut Buße –!“
„Wozu?“ fragte der Alte unverfroren. „Damit du endlich
regieren kannst? Und dann des Satans Anhang so zahlreich ist wie der Sand am
Meer?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß – ja, das paßt: der hieß Lenzel. Ein junger König, noch ledig und –
eigentlich doch nicht mehr. Nun, verlobt kann ich’s auch nicht nennen, denn es stand da noch eine Bedingung im Raum, die noch nicht
erfüllt war: Prinzessin Hildebiene wolle ihn erst dann zum Manne nehmen, wenn er sein Reich bestellt hätte.
Nun ja, in unserer Sprache kein eindeutiger Begriff: jemanden oder etwas kommen lassen, übermitteln, bearbeiten. Lenzel verstand die letzte Bedeutung darunter: sein Reich fruchtbar zu machen. Und da
angeblich durchs Zu- und Umhören noch niemand dümmer geworden sei, bestellte er seine geheimen Räte zu sich. Seine neuen
Räte! Denn als er seinen Thron bestiegen hatte, war es eine seiner 1. Amtshandlungen gewesen, die bisherigen Minister und Räte zu
Ehrenbeamten zu befördern und in Pension. Anschließend berief er Männer aus seinem engern und weiteren Freundes- und Bekanntenkreis in
die für einen Tag verwaisten Ämter. Keine Frauen? Nee, entweder hatte
Lenzel da schlechte Erfahrungen mit Schwestern belehrender Neigung gemacht, oder er hatte Angst, Hildebiene könne eifersüchtig werden.
Jedoch – erfahrene und gestandene Mannsbilder waren die neu berufenen Minister und Räte nicht, sondern etwa Lenzels Alter und noch etwas grün hinter den Ohren. Ich hätte also eben besser Jünglinge, Schnösel oder Milchbärte sagen müssen. Ach so,
die meisten von ihnen waren bisher von Beruf Sohn gewesen und bewandert im Kutschenwesen, Trinken und Ballspiel. Kinder von Tagelöhnern
waren selbstverständlich nicht darunter.
Und diese Sach- und Wesenverständigen rieten nun dem neuen König, sich vor allem auf die Begabtenförderung zu konzentrieren und eine Eliteschule nach der anderen zu
gründen; denn ginge es der Elite gut, so täte sich das schnell auf das ganze Volk ausdehnen.
Wirkung zeigte die Umsetzung dieses Ratschlags durchaus, und das weitgehender, als erwartet worden war. Tscha,
die lieben Eltern! Was die alles für Talente in ihren Kindern zu entdecken wußten! Und zwar bei reich und arm! Das eine Kind konnte mühelos alle Residenzstädte dieser
Erde aufzählen: der geborene Außenminister! Die andere wußte die Namen, Geburts- und Sterbedaten aller berühmten Komponisten der
Musikgeschichte: die geborene Stardirigentin oder gar Kultusministerin! Ein anderer konnte allein durchs Schmecken den Alkoholgehalt eines jeden Getränks bestimmen: der
geborene Wirtschaftsminister! Und das ist jetzt nur eine recht unbedeutende Auswahl. Sofern wenigsten ein Elternteil ein bißchen Zeit für seinen Nachwuchs erübrigen konnte, wußte es unwiderlegbare Argumente anzuführen, weshalb
seine Sprößlinge unbedingt eine Eliteschule besuchen müßten.
Ich sagte bereits, diese Einschätzungen seien bei reich und arm anzutreffen gewesen, aber bei diesen bedeutend mehr als bei jenen; jedenfalls wenn du die Väter befragt hättest. Irgendwie nahm der Stolz der Väter auf
ihre Kinder mit zunehmendem Wohlstand – ab. Also? Also begannen die Räte
mehr und mehr von ihrem Vorschlag Abstand zu nehmen und vom König beschlossene Projekte auf den Aktenholzweg zu schicken sowie bereits ins Leben gerufene Eliteschulen verhungern und verdursten zu
lassen.
Zu allem Überfluß kam nun auch noch Prinzessin Hildebiene zu Besuch, um nach Anlässen für ihre Hochzeitsglocken zu suchen. Allein – davon fand sie keinen, dafür um so mehr für das Gefühl, gebraucht zu werden.
Mehr und mehr Wohlhabende verließen die Enge der Residenzstadt und bauten sich vor deren Toren prächtige Landhäuser, umgaben aber Grund und Boden mit breiten Gräben. So etwas konnten die Zurückgebliebenen nicht ausheben, aber weitere Mauern errichten, Fenster verhüllen und Türen absichern. Bei Versammlungen oder Veranstaltungen achteten ruppige Türsteher strengstens darauf, daß nur Geladene mit Einlaßkarte Zutritt
erhielten; und das bei reich und arm.
Energisch nahm sich Hildebiene denn König zur Brust. Er kenne wohl nur den 1. Vers
Entzwei und gebiete! Tüchtig’ Wort;
doch dieses Sprichwörtliche gehe weiter mit dem 2. Vers:
Verein und leite! Bess’rer Hort.
Wenn er, der König, wolle, daß sein Reich Bestand habe, dann baue er gefälligst Brücken über alle Gräben, lasse Mauern niederreißen und gebe den Türstehern eine bessere –
„Aber was hat das jetzt alles mit Eurer Buße und meinem Regieren zu tun?“ konnte sich Don Ichenberger nicht länger
zurückhalten.
„Das kommt auf unsere Brücken an“, antwortete der Alte, Erkenntnis kaum mehrend, „die wir bauen. Lenzels Räte
und Minister wurden jedenfalls umgehend, eh, freigestellt, und dann konnte sich für diese Aufgaben eine jede und ein jeder bewerben, die meinte, dafür Wissen und Können mitzubringen und vor allem
Arbeitsfreude; unabhängig von Herkunft und materiellem Vermögen. Und dem
Landesvater schrieb Hildebiene ins Stammbuch, daß nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Und zwar allen Kindern! Eltern? Also nicht der Vater allein? Na, wann sie das wohl ins Stammbuch eingetragen haben
–?“
Doch da bemerkte der Alte, daß dieser Zeitpunkt nicht von allgemeinem Interesse war, denn der Besucher war inzwischen gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *14.-15.3.2024, freigegeben am 30.3.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.223 Nachtmeister Stropp und der Fall Zachälino
„Deher Lenz ist gekommen,
dihie Blüten brechen auf,
druhum komme, wer Lust hat,
zuhum Wandern und zum –!“
Abrupt hielt der treffliche Sänger inne. „Was hast du denn, Bruhno? ’ne
Leiche?“
„Nein, Herr Nachtmeister“, antwortete der kleine Bär, „ein hübscher Schmetterling!“
„Ah“, freute sich nun auch unser Stropp, „ein Tagpfauenauge, ein Bote des Frühlings. Und da hör’ ich auch noch den Zilpzalp! Ja, jetzt ist –“
„Den Zilpzalp hör’ ich auch“, bestätigte der Nachtassistentanwärter, „aber warum hör’ ich den Schmetterling nicht?“
„Tscha“, kannte unser Held seine Grenzen, „warum verstehen uns die Menschen nicht. Von uns Igeln sagen sie
sogar, wir täten schmatzen. Ich weiß es auch nicht, weshalb das so eingerichtet ist. Und noch nicht einmal im Land der Mährchen ist es einheitlich –“
„Willste Ostereier hab'n?“ wurde unser Igel unterbrochen. „Wat jibste –?“
„Nee“, lachte unser Nachtmeister, „das täte mir die Vogelwelt sehr übelnehmen.“
„Ach, sieht doch keener“, versuchte der Fremde zu beschwichtigen, „und ick halt’ auch dicht.
Ehrenwort!“
„Brauchen wir nicht“, lehnte es unser Bruhno ab. „Damit hab’ ich schon bei den Menschen keine guten
Erfahrungen gemacht. Nee, mein Chef hat recht. Wir brauchen keine Eier und
deshalb auch keine Ehrenwörter als Zugabe. Hat dich denn der Osterhase –“
„Soll dat etwa jetzt 'n Verhör sein?“ brauste der Fremde auf. „Ick hab’ se jedenfalls aus 1. Hand und könnt’ se deshalb sehr jünstig abjeben.“
„Du hast sie also selber geklaut“, folgerte unser Bär.
„Wie ick de Eier in ehrlichem Wettstreit erworben hab’“, blieb der Fremde verschlossen, „jeht dick überhoopt nischts an. Undankbares Pack! Selbst schuld, daß euch solch ein jünstijes Anjebot
entjeht!“ Grußlos huschte der Fremde davon.
„Wer war denn das?“ fragte unser Bär. „Kanntest du
den?“ Ja, ja, die heutige Jugend – wechselt halt gerne zum Du.
„Nein“, nahm’s unser Stropp nicht übel. „Ein junger Eichkater, vermutlich letzte Generation.“
„Letzte?“ wußte es die Lernkraft nicht zu deuten. „Kommt
danach nichts mehr?“
„Na ja“, gab unser Held zu, „manchmal scheinen sie schon zu denken, nach ihnen käme die Sintflut. Aber ich
meine genauer: den letzten Wurf im vergangenen Jahr. Und die haben wohl die meisten Flausen im Kopf. Und aufs Stehlen und Rauben scheint er sich auch schon zu verstehen. Allein – solange niemand Klage führt, brauchen wir da nicht zu
–“
„Herr Nachtmeister“, meldete sich nun eine piepsigere Stimme, „gut, daß ich Euch noch vor Eurem Feier-, eh, Feiertag erwische. Ist ja sowieso sehr unpraktisch eingerichtet, daß Ihr den ganzen Tag verschlaft, während wir unserer harten Arbeit nachgehen. Was wollt’ ich doch jetzt? –“
„Guten Morgen, Herr Winnezu“, war unser Stropp auch ein Freund von Höflichkeit, „kommt bitte zur Sache.“
„Das wollt’ ich ja gerade“, zeigte sich der Stieglitz ungehobelt, „bevor Er mich unterbrochen hat. Wo war ich
gerade stehengeblieben?“
„Uns einen guten Morgen zu wünschen“, blieb unser Nachtmeister nachsichtig, „jedenfalls kurz davor.“
„Nee“, zog der Vogel das Enttäuschen vor, „unterbrech’ Er mich nicht ständig. Also, ich komme, um Ihm einen
Körnerraub anzuzeigen.“
„Wann? Wo?“ versuchte unser Held zu ordnen.
„Er soll mich nicht ständig unterbrechen!“ wurde der Distelfink ganz rot im Gesicht. „Das geht schon seit Tagen so. Bei unserem Futterhäuschen –“
„Eigentlich war es ja kein richtiger Raub“, erzählte unser Igel etwas später beim Morgenbrot seiner Eheliebsten, „denn der Dieb hatte sogar eine Bezahlung hinterlegt,
aber nicht in der bei Vögeln allgemein üblichen Währung. Herr Winnezu meinte, es seien Haselnüsse oder Eichnüsse gewesen; und darauf hätte zur Zeit noch nicht einmal das Krähenvolk Appetit. Ansonsten gibt es
etliche Parallelen zu einem ähnlichen Fall vor etwa 2 Jahren. Na, wir werden es uns morgen früh mal –“
„Nichts da!“ widersprach Frau Struppe energisch. „Sonst kommt ihr viel zu spät nach Hause. Nein, ihr geht da gleich heute abend
hin!“
Nun ja, Frauen sehen eben alles aus ihrer Perspektive und können sich kaum vorstellen, daß es noch andere Ansichten gibt. Zum einen war’s dem Eheliebsten fürs Gehen zu weit, so daß Waschbär Wastel mal wieder
einspringen mußte. Zum andern mochte die Igelgattin viele Vorzüge haben und vieles besser können und wissen, aber bei der Aufklärung
von Verbrechen war der Gatte bekanntermaßen begabter. So auch hier. Unser
Stropp hatte es richtig vorausgesehen, daß Nüsse und Eicheln nicht der Geldkatze eines Nachträubers entspringen konnten, sondern jener Schlingel am frühen Morgen auf frischer Tat ertappt werden
mußte.
Also? Also kamen unsere 3 Freunde am Morgen doch mit deutlicher Verspätung nach Hause zurück. Aber noch ehe Frau Struppe ihre Kanonen losballern lassen konnte, wies ihr unser Bruhno lachend ein Versöhnungsgeschenk: Nüsse, jedoch ohne
Schale. Und wie die schmeckten!
Nun ja, wer kaut, kann nur schwerlich schimpfen und muß zuhören. Und dabei erfuhr die Igelfrau, daß die Nüsse
vom jungen Eichkater Zachälino stammten und geknackt worden waren. Er war nämlich
durch Wastel auf frischer Tat im Futterhäuschen verhaftet worden und durch unsern Nachtmeister auf den Weg der Besserung gelenkt worden. Künftig müsse Zachälino das Vogelfutter so bezahlen, daß auch die Vögel was davon hätten, zum Beispiel mit Nüssen ohne Schale. Und als Vorkosterin habe unser Stropp seine Eheliebste vorgeschlagen. Und weil
Zachälino auch der junge Spund von gestern mit dem illegalen Eierhandel gewesen sei, müsse er vorerst jede Woche hier vorsprechen für eine Belehrungsstunde, bis er zur rechten Einsicht gekommen
sei.
Über solch einen genialen Strafvollzug mußte selbst Frau Struppe staunen.
© Stiftung Stückwerken, *21.3.2024, freigegeben am 30.3.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.224 Mariatha
„Das ist nicht zu fassen mit dem Mann!“ versuchte Donna Tretmüller sich zu
erleichtern. „Meint Ihr, er tät’ mir mal im Haushalt –“
„Kann ich zu etwas“, fragte der Alte von der Halbinsel zurück, „was ich nicht
kenne, eine Meinung –?“
„– helfen?“ ließ sich die Besucherin nicht aufhalten.
„Und wenn, dann äußerst ungern.“
„Du sprichst von deinem Eheliebsten?“ wollte sich der Alte vergewissern.
„Von wem sonst?“ hielt’s Donna Tretmüller für selbstverständlich. „Ständig kommt er mit neuen Ausreden. Er müsse dem Nachbarn helfen; für seine Tante Besorgungen machen; die Leute im Armenhaus besuchen. ER macht sich einen feinen Lenz, und ich muß mich für die ganze Familie abschuften.
Ach, –“
„Kannst du denn gut kochen?“ fragte der Alte.
„Das will ich wohl meinen!“ antwortete die Besucherin selbstbewußt. „3 Kinder großgezogen, und es ist aus allen 3en was geworden!“
„Nur dein Mann ist nicht zu einer Sache geworden“, würzte der Alte mit Bedauern.
„Wollt Ihr Euch über mich lustig machen?“ argwöhnte Donna Tretmüller erregt. „Das will ich Euch nicht geraten haben! Ihr seid wohl auch so ein Pascha, der bedient
werden will und glaubt, Frauen gehörten an den –“
„Wenn sie’s besser können“, widersprach der Alte nicht ganz, „und es gerne –“
„Kein Wunder“, urteilte die Besucherin hart, „daß es bei Euch keine Frau lange –“
„Tscha“, lachte der Alte, „wir Mährchenerzähler sind meist ledig oder früh posthum“, und er begann zu erzählen:
„Es wär’ einmal eine Prinzessin, die hieß – die hieß Mariatha. Frag mich jetzt nicht, ob auf ihrem Taufschein
Maria-Martha gestanden hat; ich kenn’ sie jedenfalls nur unter jenem Namen.
Wie jeder Mensch hatte auch Mariatha ihre Stärken und ihre Schwächen. Also, gut kochen konnte sie
nicht; dafür war sie viel zu verträumt. Und wenn du beim Kochen mit deinen
Gedanken woanders bist, dann gehst du mit dem einen Gewürz zu großzügig um, mit dem andern zu knauserig. Allein – wenn eine Prinzessin
nicht gut kochen kann, mag aus ihr dennoch eine gute Königin werden, die das Kochen getrost Kundigeren überlassen kann.
Aber das mit dem Träumen am hellichten Tag, das machte den Eltern schon Sorgen, denn Mariatha träumte auch bei anderen Gelegenheiten. Sehr entrüstet darüber war vor allem Kriegsminister Donnerschütz. Vergeblich versuchte er, die Prinzessin für Strategie, Taktik und Waffenkunde zu begeistern. Nö, Mariatha war mit ihren Gedanken nicht bei der Sache.
Auch Kommerzienrat Aalisch hatte da kein Glück. Krückensatzrechnen, Haushaltsplanung: keine leuchtenden Augen
bei der Prinzessin. Noch nicht einmal das Fach Weißwestenhaltung konnte Mariathas Interesse wecken, geschweige denn fesseln. Ach so, du kennst dieses Fach nicht? Dabei ist es heutzutage doch sehr beliebt in
Unterricht und Umsetzung. Nun, es leitet sich durchaus von der Rinderhaltung ab: füttern, hegen, melken, schlachten. Nur eben nicht mit Kühen, sondern mit Menschen; und äußerlich völligst sauber und
ehrenhaft. Was meinst du, wie viele Orden Kommerzienrat Aalisch trug!
Allein – sie konnten Mariatha nicht blenden, weil sie eben – träumte.
In den andern Fächern der Prinzessin war es nicht besser; bis – auf eine Ausnahme: die bildende
Kunst; vor allem das Zeichnen und Malen. Na ja, höhere Töchter werden nun
mal in so etwas ausgebildet; aber später wird darüber kein Wort mehr verloren. Aber insbesondere als Meister Danteletti die Ausbildung übernehmen durfte, tagte die
besondere Begabung Mariathas. Bei ihm verfeinerten sich nicht nur ihr Handwerk und ihr Farbempfinden, sondern ihr Wahrnehmen und ihr
Träumen verbanden sich – fruchtend. Die Prinzessin gewann einen Blick für die Seele: eines Menschen, einer Landschaft. Und sie ließ sie dann in ihre Bilder einwirken. Nicht wegnehmend, sondern, ja,
teilend und mit-teilend.
Selbstverständlich malte Mariatha gerne Schönheit; aber ihre Bilder weckten in keinem Betrachter Habgier,
sondern Frieden und – Mitteilsamkeit. Mitteilsamkeit? Ja, gleich einem
Kind, das die schöne Mohnblume nicht pflückt, sondern jauchzt, wenn auch andere sich über sie mitfreuen. Kurz: Mariatha nahm nicht nur
die Seele im Betrachteten wahr, sondern brachte auch die Seele in den Betrachtenden zum Klingen.
Doch mitten in diesem Glück wurde Mariatha plötzlich Königin. Und nun mußte sie von morgens bis abends
Aufgaben erledigen, für die sie keine Begabungen hatte und sich durch ihre Träumereien auch nicht hatte ausbilden lassen: Militärwesen, Handelskriegsführung, Justiz, ja, selbst Bildung und
Kunst. Stell dir vor, du müßtest zu einer Preisverleihung eine Rede über einen Künstler halten, dessen Werke gar keine Seele
haben! Ach, es war ein einziger Leidensweg und – kein Leben mehr. Die
Folge? Die neue Königin wurde krank, sehr krank. Und da ihr die Leibärzte
strenge Bettruhe verordnet hatten, konnte Mariatha nicht mal eben in ihr Atelier schleichen und neue Lebenskräfte sammeln. Ja, aus
ihrem Schlafgemach waren sogar alle ihre eigenen Bilder verbannt worden, da diese Mariatha zu sehr aufregen würden; nach Meinung der
Leibärzte.
Die Königin siechte dahin, und als das Käuzchen draußen zu rufen begann, kam endlich eine Kammerzofe auf den Einfall, den Kunstlehrer zu rufen. Viel versprach sich davon niemand, allenfalls eine letzte Freude für die Königin, bevor der Fährmann sie –
„Aber was hat das jetzt alles mit meinem Egon zu tun?“ konnte sich Donna Tretmüller nicht länger
zurückhalten.
„Hoffnung?“ wollte sich der Alte nicht festlegen. „Die
jedenfalls gab Danteletti seiner ehemaligen Schülerin. Und siehe da, Mariatha genas und befolgte dann die ihr gegebenen
Ratschläge. Jeden Morgen ging sie zuerst in die Natur und skizzierte, dann in ihr Atelier und führte aus; und wenn dabei die Begeisterung merklich nachließ, ging sie zu ihren königlichen Pflichten und freute sich auf den nächsten Morgen. Und es heißt, daß einige dieser Pflichten sogar überflüssig wurden, sobald Mariatha ihre Bilder dem Volk –“
Jedoch – die Besucherin fühlte sich nicht mehr angesprochen und war gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *28.3.2024, freigegeben am 30.3.2024
Qouz-Note: 3-
***

MamM 1.225 Golding, der goldene Hase
„Seid Ihr eigentlich neidisch?“ fragte Don Geldenehr – katerhaft.
„Ja“, gab der Alte von der Halbinsel bereitwillig zu, „oft. Wenn ich meinen Gedanken freien –“
„Dacht’ ich’s mir doch!“ triumphierte der Besucher. „Die
Frauen, die für Euch schwärmen, kennen eben nicht Euer wahres –“
„Schwärmen?“ zweifelte der Alte sehr. „Und wenn, dann
hast du recht: SIE kennt mich eigentlich gar nicht. Aber du, bist du neidisch?“
„Nein, nie!“ war sich Don Geldenehr sicher. „Kenn’ ich
gar nicht! Das ist eben der Unterschied zu Euch: Ich hab’s ja im Leben zu was gebracht; wer aber neidisch ist, der –“
„– nährt sich wie jener Lazarus?“ ergänzte der Alte. „Aber du hast mich eben nicht ausreden lassen. Wenn ich mich als neidisch ertappe,
dann wandern zuweilen meine Gedanken von Tuttlingen nach Amsterdam zu Herrn –“
„Was wollt Ihr denn im Ausland?“ wunderte sich der Besucher.
„– Kannitverstan“, bremste der Alte zu spät, nach Tuttlinger Art, „und der Erfahrung: Alles hat seinen Preis.“
„Das mag schon sein“, wollte Don Geldenehr nicht vor den Kopf stoßen. „Ich jedenfalls sag’ immer:
Das beste Mittel gegen Neid,
das ist die eig’ne Tüchtigkeit;
und natürlich Gottes Segen. Beides gehört untrennbar –“
„Womit wir wieder bei jenem Lazarus sind“, ahnte der Alte, nicht verstanden zu werden, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger König, der hieß – den nannten sie Neidharz. Joa, solch eine Taufe wird schnell allgemeingültig: Einer tauft, ein anderer findet’s treffend und so weiter, und dann hast du dein
Minuszeichen vor allem Positiven.
Der König läßt ein Krankenhaus bauen. Das habe er aus Neid getan, wird’s ihm ausgelegt, weil er die
Nachbarfürsten übertrumpfen wolle. Der König läßt die Armen speisen. Das
habe er aus Neid getan, wird’s ihm ausgelegt, weil er scheel auf die reichen Bäcker und Metzger blicke und denen eins auswischen wolle.
Der König läßt ein Heer ausheben. Das tue er aus Neid, wird’s ihm ausgelegt, weil er mächtiger sein wolle denn alle
Nachbarn.
Nun ist das aber mir dem Heer wirklich keine Heldentat, und als der König es die Grenze überschreiten ließ, erst recht nicht. Das war aber noch zu einer Zeit, da ein Herrscher nicht von seiner sicheren Hauptstadt aus seine Soldaten in den Krieg schickte, sondern ihnen
voranzog. Aber nun geschah doch etwas Heldenhaftes; oder? Jedenfalls
war’s einzigartig: Nach wenigen Meilen machten die Soldaten hinter Neidharz Rücken einfach kehrt und gingen nach Hause. Tscha, wenn so
was nur ein einziger tut, wird’s Fahnenflucht genannt und als Verbrechen geahndet; wenn’s etliche tun, heißt’s Revolte – mit ähnlichen
Konsequenzen; wenn’s aber scheinbar alle tun, heißt’s Revolution und wird später jedes Jahr stolz an einem Gedenktag gefeiert – von
Menschen, die wähnen, daß sie damals gerne dabeigewesen wären. Nun, Neidharz wäre damals gerne nicht dabeigewesen, zumal sich auch noch
sein Pferd der umkehrenden Mehrheit reiterlos angeschlossen hatte.
Zur Grenze seien es ja nur ein paar Meilen gewesen, denkst du jetzt? Richtig! Aber wenn du dort von den Grenzsoldaten aufgegriffen wirst und sie dich in einem vergitterten und verriegelten Wagen in das Gefängnis der
Hauptstadt bringen, wird’s eine lange Reise, und du weißt nicht, ob du die Heimat jemals wiedersiehst.
Was war geschehen? Ein Grenzsoldat hatte sich den Steckbrief eines gefürchteten Straßenräubers gut gemerkt und
dessen Konterfei und war sich völlig sicher, in Neidharz den Gesuchten vor sich zu haben. Aber die herrschaftliche Kleidung? Eben! Die war gewiß beim letzten Überfall erbeutet worden, denn sonst hätte sie ihr
Träger nicht heimlich über die Grenze bringen wollen. Aber die Papiere?
Gefälscht! Zumal vom Verdächtigen eigenhändig unterschrieben. Und lehre
etwa die Lebenserfahrung, daß ein König in Feindesland, ohne Schutz, ohne Begleitung, lustwandle; was? Nein, das hier sei kein König, noch nicht einmal ein Edelmann, sondern eindeutig der gesuchte Schwerverbrecher und sei seiner gerechten Strafe
unverzüglich zuzuführen.
Die Richter sahen es ähnlich und bedauerten es sehr, daß in ihrem Lande die Todesstrafe nicht mehr verhängt werden durfte und sie sich mit der Höchststrafe von 30 Jahren
Zuchthaus begnügen mußten.
Allein – verhängte Strafe ist nicht gleich vollzogene Strafe, und diese traf schon damals die Unschuldigen wesentlich härter. Denn was du nicht begangen hast, kannst du nicht zugeben, also giltst du als Leugner und verstockt und habest das zusätzlich zu büßen! Bei Neidharz: absolute Einzelhaft bei Wasser und bei Brot! Wer kann da noch
überleben?
Nun begab es sich in jenem Land, daß Prinzessin Friedlinde den Königsthron bestieg und neue Sitten
einführte. Einführte; nicht verordnete! Also? Also brachte sie die neue Königin selbst in Umlauf. So besuchte sie selber die Gefangenen. Wo? In den Zuchthäusern! Und da ihr jener „Straßenräuber“ als besonders verstockt und
unverbesserlich geschildert worden war, besuchte sie ihn als einen der ersten.
Es war wohl um die Osterzeit; denn als die Königin die Zelle wieder
verließ, blieb ein goldener Hase zurück. Zum Verzehr? Nee, das konnte
Neidharz einfach nicht übers Herz bringen, sondern er schenkte ihm das Leben; der Hase gleichalso. Denn einer glaubte an den –
„Märchen! Hirngespinste!“ konnte sich Don Geldenehr
nicht länger zurückhalten. „Ihr wollt doch nur von Eurem Neid –“
„Neidharz ablenken?“ ergänze der Alte. „Nein, wer lebt,
der überlebt. Der Hase achtete nämlich nicht auf Namen und Omen, sondern auf den Schatz, der in dem früheren König noch vorhanden
war. Der werde noch gebraucht, so der Hase; denn gewiß werde er, Neidharz,
bald erlöst und dann müsse sein (des Königs) Schatz zugänglich sein. Und da Neidharz zwar keinen
Kontakt zu seinen Mithäftlingen aufnehmen durfte, aber zu den Läuterungsstoffen der Haftbibliothek, wandelten sich die folgenden Tage in wertvolles Sammeln und Veredeln. Tage? Hase und Häftling zählten die Vergangenheit nicht, sondern freuten sich an
jedem Abend: Morgen schon könne die Freiheit die Tür öffnen. Und dann wurde der wirkliche Straßenräuber gefaßt, die Zellentür öffnete sich, die Wahrheit trat ans Licht, und dennoch erfolgte
kein Austausch der Gefangenen. Denn Königin und König waren sich einig: Eine Strafe könne nicht 2mal für dasselbe Vergehen verhängt
werden und sei deshalb in Gnade –“
Doch der Besucher war inzwischen gegangen; – den Weg jenes reichen
Mannes?
© Stiftung Stückwerken, *4.4.2024, freigegeben am 6.5.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.226 Schizose?
„Wir sollen unsere Güter mit den Armen und Fremden teilen“, erzählte Donna Karre-Gaul vom Sonntag.
„Sollen?“ rieb sich der Alte von der Halbinsel mal wieder an seinem Reizwort. „Niemand soll –
„Aber Eure ganze Bibel da“, hielt die Besucherin dagegen, „ist voller Gebote und –“
„Die ist zwar mein Bibelexemplar“, stellte der Alte richtig, „aber ich habe die Bibel weder geschrieben noch übersetzt. Außerdem sind die meisten Regelungen, die pauschal »Gebote« genannt
werden, lediglich Verbote, die einen Freiraum einhegen und –“
„Stellt Ihr Euch damit nicht gegen die Kirche?“ argwöhnte Donna Karre-Gaul.
„Gegen die in den Kirchen herrschende Meinung?“ überlegte der Alte. „Schon möglich. Viele Geistliche wüßten vermutlich nicht mehr, was sie predigen
könnten, wenn sie das Wort »sollen« nicht mehr –“
„Unser Herr Pfarrer spricht sogar von einer Aufgabenliste“, blieb die Besucherin auf gewohnter Bahn, „die wir uns jeden Sonntag in der Kirche abholen und in der folgenden
Woche abarbeiten –“
„– dürfen?“ versuchte der Alte die Wiederholung seines Reizwortes zu verhindern; allein – dann sprach er’s selber aus: „Stell dir vor, wir fragen uns nicht mehr, was wir sollen, sondern was das Gute in uns will. Dann –“
„– seid wohl auch Ihr ein Anhänger der ketzerischen Lehre von der gespaltenen Persönlichkeit des –?“ ergänzte Donna
Karre-Gaul.
„– Menschen?“ griff der Alte auf. „Nein, denn »Person«
leite sich ab von: Maske. Mir geht es jedoch nicht um die Fassade, sondern um das Innere, und dazu fehlt jedenfalls mir noch manches
Bild, um meine Zerrissenheit, meinetwegen: meine Spaltungen und meine Widersprüchlichkeit, besser fassen zu können. Doch wir wollen mal
hören“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der – der hieß Harun; angeblich die aramäische Fassung vom hebräischen
Aaron. Die Gelehrten streiten sich über die Deutung dieses Namens und irren von Lade über Sarg zu: der Erleuchtete; ich aber – deute ihn gar nicht und bekenne schamlos: Ich weiß nicht, was sich die Eltern unseres Königs bei dieser Namenswahl gedacht
haben. Unser Harun wußte es auch nicht, entwickelte aber schon sehr früh eine Sympathie für seinen Namensvetter, jedoch nicht für den
historischen, sondern für den märchenhaften. Insbesondere fand unser Harun bereits als Kronprinz ein Vergnügen daran, sich unerkannt
unter seine künftigen Untertanen zu mischen. Untertanen? Sind Menschen, von
denen du lernen kannst, etwa Unterworfene? Auf diese blickst du hinab, zu jenen aber auf. Oder nach einem anderen Bild: Unser Harun fühlte sich wie ein angehender Handelsherr, der zu seinen künftigen Kunden reist, um von diesen zu
erfahren, was sie brauchen und womit er ihnen dienen kann.
Stell dir vor, ein Fabrikant täte sich ähnlich verhalten zu seiner Belegschaft, ein Beamter zu seiner Bürgerschaft, ein Pfarrer zu seiner Gemeinde: Ob das Klima dann
milder wäre?
Freilich – es ist nicht ungefährlich, wenn du dein sicheres Haus verläßt und unterwegs bist. Das mußte auch
unser Harun erleben; jedoch –ohne Gefährdung keine Wunder! Unser junger
König, denn das war er inzwischen, wurde nämlich von einem Straßenräuber angehalten, der ihn um dessen ganze Barschaft bringen wollte. Na, du kennst sicherlich die Parole dieser Zunft: Geld her oder Leben!
Harun nahm’s wörtlich, aber unerwartet und furchtlos: „Wenn ich dir jetzt Geld gäbe, was tätest du denken?
Vermutlich: Rauben lohne sich; und du tätest weitermachen wie bisher. Bis
dir eines Tages ein Fehler unterläuft oder du in ein Revier eindringst, das ein mächtigerer, weil brutalerer, Raubender für sich beansprucht. –“
„Red nicht so ’n dummes Zeug!“ bemühte sich der Straßenräuber um eine überlegene Stimme. „Leer deine Taschen aus, sonst –!“
„– müßtest du mit Leben vorliebnehmen?“ ließ sich unser Harun nicht einschüchtern. „Wär’ das nicht die bessere Alternative? Oder willst du etwa dieses Räuberdasein
»Leben« nennen: ständig auf der –“
„Ich hab’ gesagt, du sollst nicht dumm rumquatschen!“ wurde der Straßenräuber heftiger. „Geld her! Aber ’n bißchen flott!“
„Das kannst du sogar bekommen“, schien unser König einzulenken, aber nicht zu kapitulieren: „Wisse, vor dir steht dein König, der Macht und Mittel hat, dich hinter Schloß
und Riegel zu bringen oder dir zu helfen; aber das gewiß nicht beim –“
„Ah“, frohlockte der Straßenräuber, „dann brauch’ ich Euch ja nur hoppzunehmen und kann dann Lösegeld –“
„– und bei meiner Befreiung“, lenkte unser Harun um, „den Tod finden. Nee, Freund, zimperlich ist bei so etwas
–“
„Freund?“ wunderte sich der Straßenräuber. „Ihr nennt
mich Euren –“
„Gut“, gab der König zu, „bewiesen hast du deine Freundschaft noch nicht, aber die Gelegenheit dazu will ich dir schon geben. Hier in meinem Ranzen ist noch ein Stück Brot; und falls du mir noch nicht traust,
kannst du es selber herausholen. Jedenfalls wollen wir’s miteinander teilen, und dabei erzählst du mir einiges aus deiner Vergangenheit
und deinen Sorgen; und dann wollen wir gemeinsam schauen, wir ich dir helfen –“
„Und was hat das jetzt mit den Geboten und den Aufgabenlisten unseres Herrn Pfarrers zu tun?“ konnte sich Donna
Karre-Gaul nicht länger zurückhalten.
„Nun ja“, war der Alte um eine Antwort nicht verlegen, „unser Harun sollte sein Geld hergeben und hätte damit das Rauben gefördert. Er hat aber nicht nach dem Sollen gefragt, sondern nach dem, was das Gute in ihm wollte. Und das wollte wirklich helfen. Deshalb versicherte er jenen Mann seines besonderen
Schutzes und – der Einhaltung des Beichtgeheimnisses, und das glaubwürdig. Anfangs noch stockend, dann aber flüssiger, erzählte jener
Mann aus seinem Leben. Nachdem er sein Herz erleichtert hatte, drückte ihm der König mitfühlend die Hand: «Was muß das Gute in dir
gelitten haben!« Das habe ihm noch keiner gesagt, kam es über die Lippen –“
Allein – wie so oft hatte ein Besuch das gute Ende nicht abwarten und mit nach Hause nehmen wollen und war vorzeitig gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *2.5.2024, freigegeben am 6.5.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.227 Der Palast
„Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit!“ beklagte sich, doch unbewußt, Don Knirzel.
„So?“ hielt der Alte von der Halbinsel sein Interesse auf Sparflamme.
„Alles ist teurer geworden!“ beschwerte sich der Besucher. „Und wer muß die Zeche bezahlen? Wie?“
„Wer’s bestellt hat“, nahm’s der Alte zu wörtlich.
„Wir, die kleinen Leute!“ ereiferte sich Don Knirzel.
„Denn gerade die Preise für unser Brot und Obdach sind drastisch gestiegen. Die nutzen das schamlos aus, daß –“
„Die Preise?“ zeigte sich der Alte nicht sehr helle.
„– wir nicht woanders hingehen können“, blieb der Besucher in Fahrt.
„Ach so“, dämmerte es dem Alten endlich, „du meinst die Händler –“
„– und das Handwerk, die Hausherren und die Bauern“, ergänzte Don Knirzel.
„Und trotzdem klagen auch die“, wunderte sich der Alte.
„Weil sie nicht genug kriegen können!“ schloß der Besucher von sich auf andere.
„Und? Tätest du dich anders verhalten“, fragte der Alte, wenn du ein Krämer wärst, ein Bäcker oder
Bauer?“
„Wo ist da Euer Gott?“ verneinte Don Knirzel. „Wenn es
einen Gott gäbe, dann –“
„Wenn es keinen Gott gäbe“, korrigierte der Alte, „müßte auch ich Gerechtigkeit fordern und täte darunter nur meine eigenen Rechte verstehen und damit selber die
Ungerechtigkeit fördern; da ich aber an einen lebendigen – Doch wir wollen hören“, und er begann zu erzählen:
Nein, niemand hatte König verleumdet, und er wurde auch nicht
eines Morgens verhaftet; es war alles ganz anders. Also, es wär’ einmal ein Reichsverweser, der hieß König und meinte es gut mit seinem Volk. Von morgens bis abends brütete er neue Gesetze und Verordnungen aus und – Strafen;
doch mehr und mehr wurde ihm klar: Es war alles vergeblich! Statt glücklicher schauten die Leute verbitterter drein. Und wem gaben sie dafür die Schuld? Die Alleinschuld? Ihm, dem Reichsverweser! Das war gewiß übertrieben und überzogen; aber hatte er nicht doch was falsch gemacht?
Einsicht sei der 1. Schritt zur Besserung? Aber wenn du selbst Beteiligter bist? Das fragte sich König auch und gelangte zu dem
Entschluß, auf Reisen zu gehen. Wenn’s sich hier im Lande mit ihm nicht zum Guten entwickelt hatte, dann konnte es ohne ihn eigentlich
nur besser werden. Ein fataler Gedanke, wenn eine Tür für immer geschlossen wird! Aber König hoffte, wiederkommen zu können, und nahm zumindest einen Schlüssel mit.
Nun, vermutlich hast auch du gehört, daß ich kein Freund des Fahrens oder Reitens bin, sondern des Gehens; und
so reiste auch König nicht in einer Kutsche oder hoch zu Roß, sondern zu Fuß. Was es da alles zu entdecken gab!
Ameisen, die in einer anscheinend endlosen Karawane den Weg queren. Aber kein Kommandowort ist zu
vernehmen. Schleppen sie ihre Lasten etwa freiwillig? Ob es bei ihnen
Vorschriften gibt? Und um diese durchzusetzen, sogar Strafen?
Dann die Bäume, Sträucher und anderen Pflanzen. Wie sie gegeneinander um Licht und um Wasser
kämpfen! Noch erheben sich auf dieser Lichtung stolz die Fingerhüte, aber auf Dauer können sie sich gegen die neuen Bäume nicht
behaupten. Ja, selbst die Äste und Zweige des gleichen Baumes kämpfen gegeneinander.
Auch in den Gärten überall Spuren von Kampf und Gegeneinander: zerfressene Blätter, gepuderte Blüten, bewohnte Früchte.
Nirgendwo ein Vorbild für sein Volk?
Da gelangte König eines Tages in eine große Stadt; anscheinend eine Hauptstadt. Aber das höchste Gebäude war keine Kirche, auch kein Königsschloß, sondern ein riesiger Palast. Palast für wen?
Für niemanden, antwortete der Türhüter, denn er, der Türhüter, dürfe niemanden einlassen; und herausgekommen
sei auch noch niemand.
Aber wozu sonst dieses große Gebäude?
Der Palast beherberge die Gerechtigkeit, gab der Türhüter bereitwillig Auskunft, und weil die in diesem Lande so groß sei, habe eben auch die Herberge solche
Ausmaße.
Sonderbar! Verständnislos ging König weiter. Eine
unübersehbare Herberge, doch kein Mensch dürfe sie betreten? Dennoch drangen nun immer wieder die Wörter „gerecht“ und „ungerecht“ an
Königs Ohr. Polizisten verhafteten im Namen des Gesetzes. Richter fällten
Urteile nacht Recht und Gesetz und ließen ihren Spruch, rechtskräftig geworden, vollstrecken. Und selbst in den Kirchen wurde zur
Gerechtigkeit aufgerufen und wurden Forderungen nach mehr Gerechtigkeit aufgestellt und vorgebracht. Alle behaupteten sie, die
Gerechtigkeit zu kennen; aber – nach Angaben des Türhüters war noch niemand von ihnen zu ihr durchgedrungen. Wer sagte hier die Unwahrheit?
Der Türhüter? Aber woher dann diese Unterschiede?
Diese Disharmonie?
König kehrte noch einmal zu jenem riesigen Palast zurück und begann wie von ungefähr, um ihn einmal herumzugehen. Kein weiteres Tor; noch nicht einmal ein Fenster, durch das er hätte hineinschauen können, auch nicht mit einem Fernrohr von einem nahen
Berg. Aber – was war das hier? König bückte sich. Eine Pforte? Verschlossen? Nein; und König trat ein.
Aber sich wieder zu voller Größe aufrichten, das konnte König noch immer nicht, wollte er nicht mit dem Kopf anstoßen. Den Gang
bildeten anscheinend 2 Gewölbe ohne trennende Mittelwand, auch ohne Mittelsäulen; zwar weiteten die Seitenwände nach oben, ließen unten
aber zum Gehen nur eine schmale Rinne frei. Statisch eigentlich eine –
„Und was hat das jetzt alles mit der Gerechtigkeit zu tun?“ drängte Don Knirzel auf schnelle Deutung.
„Lang war der Gang jedoch nicht“, ließ sich der Alte nicht beirren, „und plötzlich stand König in einer großen Halle, gefüllt mit wärmendem Licht. Und einer warmen, weiblichen Stimme. Er sei der erste, der diesen Zugang gefunden,
aber auch durchschritten habe. Ein Fremder? Die Bürger hätten sich leider
damit begnügt, vom Türhüter abgewiesen worden zu sein, und lieber über das Innere geredet, als wären sie drinnen gewesen.
Bisher! Nun aber sei Hoffnung, daß auch andere –“
Doch diese Hoffnung blieb Don Knirzel verborgen, denn er war inzwischen fortgegangen.
© Stiftung Stückwerken, *7.6.2024, freigegeben am 15.6.2024
Qouz-Note: 4
***
MamM 1.228 Andera und die Tischgemeinschaft
„Und dann seh’ ich doch diesen jungen Schnösel zum Abendmahl gehen“, kramte Donna Strängler in ihrer Erinnerung.
„Am letzten Sonntag?“ versuchte der Alte von der Halbinsel zu Ordnung zu verhelfen. „In der Kirche?“
„Wo sonst?“ wertete die Besucherin ab. „Jedenfalls fand
ich das unerhört! In dieser Einstellung –“
„Hatte er dich nicht gegrüßt?“ gab der Alte nicht auf.
„Oder beleidigt?“
„Viel schlimmer!“ drehte Donna Strängler weiter auf: „Der wollte mich umbringen. Hätte mich beinahe über den Haufen –“
„Misthaufen?“ spielte der Alte mal wieder »Nimm’s wörtlich«.
„Spottet nur!“ wollte die Besucherin eigentlich das Gegenteil. „Obwohl ich Vortritt hatte! Jawoll! Und geht zum Abendmahl! Und gebeichtet hatte er’s vorher gewiß –“
„Jener Zöllner angeblich auch nicht“, hielt der Alte bekanntlich nicht viel von Kirchenordnungen.
„Aber sein Verhalten zeigt doch, daß er sich nicht ändern will“, rechtfertigte sich Donna Strängler. „Er geht
unwürdig zum Tisch des HErrn, isset sich selber zum Gericht, schuldig am Tod des HErrn und verdirbt
womöglich noch die ganze –“
„O weh!“ seufzte der Alte. „Was ist aus dem Evangelium
geworden! Wir sind alle schuldig am Tod es HErrn und haben deshalb kein
Recht, irgendeinen Menschen vom Heiligen Abendmahl auszuschließen.“
„Doch!“ widersprach die Besucherin vehement. „Die nicht
zu unserer heiligen Kirche gehören. Alle Ungetauften. Und natürlich alle
Unverbesserlichen, wie diesen Schnösel und angehenden –“
„– Bruder?“ ergänzte der Alte. „Sintemal er auch ein Kind Gottes ist. Doch wer Richtende
richtet, zeugt auch nicht vom Evangelium“, und er begann zu erzählen:
Es wären einmal eine Königin und ein König, die hatten 3 Kinder: den Kronprinzen Max, den Prinzen Nick und als jüngstes Kind die Prinzessin Andera. Na,
wie ist das, wenn du in einer Familie die Jüngste bist? Du mußt eigentlich nur eins lernen: zu lächeln, und das entwaffnend. Dann kannst du den größten Unfug anstellen, und niemand kann dich bestrafen; ja, für
dich müssen vermutlich die älteren Brüder sogar den Kopf hinhalten, weil sie zu oberflächlich auf dich aufgepaßt haben.
So war es auch bei Andera, Max und Nick, solange – die Eltern noch das Sagen hatten. Jedoch – genau an dem
Tag, da der Kronprinz volljährig wunde, verschwanden Königin und König. Waren sie entführt worden? Aber niemand forderte ein Lösegeld. Verunglückt? Aber alles Suchen blieb vergeblich.
Das Land aber mußte weiterregiert werden! Deshalb baten alle Minister den Kronprinzen, die königlichen
Amtsgeschäfte 3 Jahre lang kommissarisch als Reichsverweser zu übernehmen. Täten die Eltern inzwischen wieder auftauchen, und zwar
geschäftsfähig, dann werde nach deren Anweisung verfahren; anderenfalls müßten die Eltern für tot oder unmündig erklärt werden, und der
Kronprinz sei zum neuen König zu krönen.
Und schon änderten sich die Sitten im Königshaus – auf den 1. Blick nicht. Nimm nur die
Tischsitten. Max und Nick verhielten sich grundsätzlich bei Tisch so, wie sie’s gelernt hatten; aber nicht so Andera. Sie lud gleich am nächsten
Morgen auch ihre beiden Hunde zu Gast. Nun ja, hier und da wohl nicht ganz ungewöhnlich; aber wenn du als junger Reichsverweser plötzlich 4 ungeduldige Pfoten auf dem Tischtuch siehst, dann weiß ich nicht –. Max war auch zunächst etwas unsicher, setzte sich aber gleich gerade hin und zu seiner 1. Amtshandlung: Entweder die beiden Hunde verschwänden
auf der Stelle aus dem Speisesaal oder die ungezogene Schwester gleich mit. Na, wenn du Geschwister hast, dann weißt du, was jetzt
kommt: „Du hast mir gar nichts zu sagen! Ich geh’ zu meiner Mama! Ich will
zu meiner Mama!“ Da das aber nicht möglich war und der älteste Bruder unerbittlich blieb, speisten er und sein zu allem nickender
Bruder endlich allein.
Der nächste Morgen bescherte eine neue Probe. Dieses Mal kam Andera zwar
ohne Hunde, dafür aber mit einem ganzen Arm voller Stofftiere. Die wurden, je nach Größe, artig auf 2 Nachbarstühle oder auf den Tisch
gesetzt und liebevoll zum Mittafeln eingeladen, ja, gefüttert – nach der Art in solche Angelegenheiten eingeweihter Kinder. Aber nicht
lange! Denn der neue Reichsverweser verbat sich solch eine Unschicklichkeit energisch, paßte seine Amtshandlung von gestern
entsprechend an und erzielte ähnliche Folgen.
Am 3. Morgen kam Andera ohne Spielgefährten, tat ganz unschuldig und artig und – wurde aus Saal und Schloß verwiesen. Sie hatte sich nämlich erdreistet, laut ein Tischgebet zu beginnen, obwohl die beiden Brüder bereits ohne eins den 1. Bissen im Munde
hatten. Und als das Küken auch noch wagte, in ihr Gebet die Fürbitte einzukleiden, der liebe Gott
möge ihre Brüder doch wieder nett machen, da polterte der Kronprinz los. Und da er sich dabei verschluckte und keine respektable Figur
machte, kam’s eben zu jenem überzogenen Verweis. Ja, ja, nicht nur unsere Fehltritte machen uns Feinde, sondern auch Verhaltensweisen,
durch die sich andere Menschen uns unterlegen fühlen oder als Versager. Jedenfalls tauchte Andera am nächsten Tag nicht im Speisesaal
auf und blieb hinfort als wie vom Erdboden –
„Was hat das aber jetzt alles mit dem unwürdigen Genuß des Heiligen Abendmahls zu tun und der Exkommunikation?“
konnte sich Donna Strängler nicht länger zurückhalten.
„Ich bin noch nie würdig zum Heiligen Abendmahl gegangen“, bekannte der Alte freimütig, „sondern immer gewürdigt. Jedenfalls tauchten nach genau 3 Jahren Königin und König wieder auf, zwar etwas gealtert, aber ansonsten
unversehrt. Und Andera? Die hatte in den 3 Jahren nicht darben müssen,
sondern irgendwie immer ein Stück Brot, Früchte und frisches Wasser gehabt – wie von unsichtbarer Hand. Und – sie hatte ihre
Erfahrungen in Mitgefühl gewandelt mit Fliehenden und Ausgegrenzten; und Tatkraft. Und an dem Tage, da sie volljährig wurde, dankte ihr Vater ab, und Andera wurde zur neuen –
Doch der Alte war mal wieder alleine, wenn auch bei solch einer Phantasie nicht einsam.
© Stiftung Stückwerken, *13.-14..6.2024, freigegeben am 22.6.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.229 Von einer zuwenig bekannten
Macht
„Ich weiß nicht, ob ich bei Euch richtig bin“, wählte Don Arghaus eine Umschweife, „Ihr seid ja Junggeselle. Aber irgend etwas läuft zwischen mir und meiner Frau verkehrt. Eigentlich –“
„So?“ half der Alte von der Halbinsel mit Interesse.
„– spielen wir ständig Theater“, setzte der Besucher fort.
„Szenen einer Ehe“, senfte der Alte: „sprichwörtlich, also wohl keine Ausnahme, sondern die –“
„Aber ist das auch gesund und gut?“ zweifelte Don Arghaus.
„Welcher Mensch ist schon gesund?“ kleidete der Alte seine Binsenweisheiten schonend in Fragen. „Und ist etwas gut, weil’s die Mehrheit so macht? Aber wie ist es denn bei deiner
Frau: Zeigt sie sich dir gegenüber, wie sie –?“
„Ihr habt wohl nicht richtig zugehört“, tadelte der Besucher schonungslos, „wir beide spielen ständig Theater.“
„Dann schämt ihr euch also beide“, folgerte der Alte, „so zu sein, wie ihr wirklich seid? Habt ihr etwa
Angst?“
„Nun ja“, wollte Don Arghaus wenigstens hier nicht schauspielern, „ich kann schon mal sehr ausfallend und sehr laut werden. Doch wenn ich etwas beichte, dann mindert das in den Augen meiner Frau weder meine Schuld noch meine Strafe. Zum Beispiel neulich –“
„Halt!“ stellte sich der Alte in den Weg. „Ich bin nicht
euer Beichtvater. Schmutzige Wäsche müßt ihr beide schon zu Hause waschen, nicht unter den Leuten. Halten wir fest: Du hast Angst vor IHREN Strafen, und SIE hat Angst vor deinem lauten Zorn. Gut, wenn etwas weh tut, dürfen wir auch aua sagen, ist sogar kindlich; aber
strafen?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger König, der – der hieß Glarus. Der ward ob eines üblen Gerüchtes durch seine
Untertanen aus dem Lande gejagt. Tscha, so was kann’s geben, dem König aber nahm’s viel und ließ ihm wenig: derbe Braune vom Schuster,
die Arbeitskleidung eines Bauern und eine Kanten alten Brotes vom Bäcker. Mit diesen Gaben verdiente sich der verjagte König zunächst
einmal Blasen an den Füßen, einen tüchtigen Muskelkater in den Beinen und einen mitteilsamen Magen. Wasser gab’s aber
umsonst; Trinkwasser! Denn Brunnen waren damals noch frei zugänglich und
kleine Bäche noch nicht in Rohre weggesperrt.
Nun ja, wen dürstet, dem schmeckt das frische Wasser draußen gut; wem aber der Magen knurrt, der ist froh,
wenn er unter Menschen kommt. So erging’s auch unserem Glarus, als er nach Elfbürdingen kam, der
Hauptstadt des gleichnamigen Landes. Was für ein Glück, so schien es, denn die Elfbürdinger waren Fremden nicht abweisend eingestellt,
sondern äußerst leutselig. Gleich wurde Glarus eingeladen, sich dazuzusetzen, und dann ging es los! Mit was? Mit dem großen Essen? Nein, dafür waren die Elfbürdinger nicht weitbekannt, sondern wegen ihres Schnapses.
Einmal ist keinmal. Auf einem Bein steht es sich
schlecht. Aller guten Dinge sind 3. Na, du kennst das sicher. Und eigentlich wird kein Schnaps getrunken, sondern ein
Schnäpschen; und aus keinem Glas, sondern aus einem Gläschen. Aber mit
jedem Gläschen wirst du größer und größer in deinen Augen, bis du aufstehst und zu gehen versuchst. Bauz, da liegst du auf der Erde und
siehst alles von unten. 3 Tage lang kämpfte unser Glarus mit diesen wechselnden Perspektiven:
hinabschauen und hinaufschauen; dann riß er sich los und wanderte verkatert weiter.
So kam er nach Siebenbaden. Oy, oy oy! Wie prächtig hier die Fassaden der Häuser und die Kutschen! Wie wohlhabend gekleidet
die Bürger! Wie sauber die Straßen! Solch ein armer Schlucker wie Glarus
war hier wohl gar nicht willkommen. Aber Straßenfeger werden gerade hier besonders gebraucht. Und bist du tüchtig und ausdauernd, dann kannst du es schon zu was bringen. Zunächst
zu einer angepaßten Abendkleidung und dann – zu Wurfgroschen im Spielhäuschen. Nun ja, eigentlich ist’s ja Schiebegeld, aber das Werfen
klingt sportlicher. Na, jetzt ahnst du, wo unser Glarus seine Abende verbrachte. Er verlor, er gewann, er verlor und er verlor. Gewann er, sah er sich bereits als
einen reichen Mann; verlor er, als einen klugen und erfahrenen, der bald die richtige Strategie finden werde. Solange er nur das eigene Geld verspielte, brauchte er allenfalls einen Tag zu darben und auf seinen nächsten Tagelohn zu warten. Aber wenn er sich für besonders klug wähnte, wußte er auch andere Leute zu begeistern, ihm Geld zu leihen. Tscha, sobald er auch dieses Geld verloren hatte, prallte seine Klugheit doch sehr heftig gegen das Gefühl seiner Geldgeber, für dumm verkauft
worden zu sein, und es gab heftige Entladungen. Schließlich ward Glarus bettelarm und in Lumpen zur Stadt und zum Lande
hinausgejagt.
So kam er nach Dreischürzingen und weckte alsbald das Mitleid einer zu Reichtum überlebenden Witwe. Die nahm ihn in ihr Haus auf, zumal arm gekleidete Menschen leicht den Eindruck erwecken, vollkommen durchschaubar zu sein. Und weil es nun in jenem Lande so schicklich war, kaufte Waltraud ihrem Herbergsgast bald
einen goldenen Ehering, sich auch einen und legte die alten Ringe fort und die Witwenkleider ab.
Nun gab es in Dreischürzingen aber nicht nur Waltraud, sondern noch andere Witwen, Ehefrauen und Jungfern;
diese mit dem Reiz der Jugend und des Anschmachtens, jene mit dem Reiz der Erfahrung und der Befehlsgewalt. Jenen fühlte sich ein Mann
wie Glarus weit überlegen, diesen jedoch wie ein Kaninchen vor der –
„Eben!“ bestätigte Don Arghaus. „Aber so was dürft’ ich
meiner Frau niemals beichten; ihre Rache wäre furchtbar!“
„Hmh!“ schmunzelte der Alte. „So weit war ich noch gar nicht. Ehebruch – wie eben jedes gebrochene Versprechen und jeder Vertrauensbruch – ist keine kleine Beere. Aber merkwürdig: Wieso fällt einer Mutter das Verzeihen anscheinend leichter denn einer Ehefrau? Solange das Kind ehrlich ist und selber vertraut. Welch eine Macht liegt doch in dem
vertrauensvollen Blick eines Kindes! Gut, wenn wir ihn nicht verlernen oder ihn wieder lernen. Unsere Brunnen erquickten wieder mit klarem Wasser.“
Und er geleitete den nachdenklichen Besucher hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *21.6.2024, freigegeben am 29.6.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.230 So ich dir?
„Das soll er mir büßen!“ studierte Donna Schaffner die Rolle einer Furie
ein.
Da der Alte von der Halbinsel unterstellte, daß die gute Frau in alten
Anredeformen nicht mehr bewandert sei, bezog er’s nicht auf sich, rieb sich jedoch pedantisch mal wieder an seinem Reizwort: „Niemand soll –“
„Dann eben wird!“ zeugte die Besucherin von der allgemeinen Erfahrung, daß die Evas mit der Zunge flinker sind denn
Adam. „Wunde um Wunde.
Beule um Beule. Jawoll! Steht
alles in Eurem Buch da drüben –“
„– zum Wohle von Krankenschwestern und Ärztinnen?“ gab der Alte zu bedenken. „Heilt meine Wunde schneller, wenn ich dem Verursacher auch –“
„Soll der etwa straffrei ausgehen?“ fragte Donna Schaffner verneinend. „Oder gar noch belohnt werden? Was? Wie?“ Wo bleiben denn da Recht und Gerechtigkeit?“
„Wo sie hingehören“, antwortete der Alte, „nämlich unter die Barmherzigkeit und –“
„Daß ich nicht lache!“ ließ die Besucherin offen, ob sie’s als bloße Wirkung oder gar als böse Absicht
auslege. „Für die Gerechtigkeit zu kämpfen, das lohnt sich immer; erst
recht gegen solche Paschas wie Ihr, die uns Frauen doch nur –“
„– zum Innehalten und Nachdenken ermuntern wollen?“ ergänzte der Alte, aber fragend. „Fehlt mir zum Pascha nicht noch viel? Zum Beispiel der Harem? Also denk mal nach: Vermehrt sich die Gerechtigkeit, wenn ich Unrecht mit Unrecht vergelte?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein Kronprinz, der hieß – der hieß Karstenjo. Und wenn du meine Mährchen kennst, dann weißt du:
Bevor ein Kronprinz den Thron besteigt, muß er eine Bildungsreise machen. So auch hier. Doch die muß nicht sehr aufregend gewesen sein, denn ich weiß nichts über sie zu berichten.
Über die Rückkehr schon mehr. Das heißt: deren Versuch. Denn bereits am Tor der heimatlichen Residenzstadt wurde Karstenjo abgewiesen. Der
neue König Francesco habe die Anordnung getroffen, seinen älteren Bruder nicht einzulassen, sondern fortzujagen, denn auf dem hiesigen Thron sei nur für einen
Regenten Platz. Peng! Nu’ kommst du!
Von einem Augenblick auf den nächsten war des Kronprinzen Zukunft wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Das
könne doch nicht wahr sein! Er, Karstenjo, sei der rechtmäßige Thronerbe;
so sei es Sitte und Gesetz.
Aber Gesetze könnten geändert werden, erwiderte der Torwächter, und dann gelte ein neues Recht. Ja, ja, der
neue König habe weise vorausgesehen, daß sich sein Bruder diesem neuen Recht nicht beugen wolle. Und wer dieses neue Recht nicht über
sich ziehe, der müsse eben draußen bleiben. Und nun verschwinde er, der Gesetzlose, sonst müsse von der Waffe Gebrauch gemacht
werden.
Karstenjo sah endlich ein, hier nichts ausrichten zu können, und zog von dannen. Innerlich kochte
er; und es war keine Friedenssuppe, sondern Kriegsbrei. So ist es doch oft
unter den Menschen: Geht es um ein Reich, dann wird das nicht in einem Zweikampf geklärt, sondern es werden Söldner und Soldaten in den Kampf geschickt. Welch ein Wahnsinn!
Gut, daß es Sommer war! So brauchte Karstenjo nicht zu frieren, brauchte
noch nicht einmal ein Obdach und konnte seinen Durst an Quellen und Brunnen stillen. Hunger hatte er vorerst keinen; der meldete sich erst, nachdem der Kronprinz sein Heimatland verlassen hatte. Zwar
hatten Amseln und Stare noch einige Kirschen übriggelassen, auch waren schon erste Beeren reif, aber Brot findest du weder an Bäumen noch an Sträuchern, sondern nur in der Bäckerei. Doch nun gewahrte Karstenjo, daß er nicht nur kein Geld hatte, Söldner anzuwerben, sondern noch nicht einmal dafür, sich Brot kaufen zu
können.
Nun war es jedoch schon damals so: Arbeit hatte ein Bäckermeister genug, aber nicht genug Lehrlinge. Denn wer
in der Backstube arbeitet, hat’s zwar warm und früh Feierabend, hat aber einen frühen Arbeitsmorgen und es erst warm, wenn der Backofen wieder heizt. Das schreckt viele junge Leute ab, gereicht auch nicht zu mehr Beliebtheit bei den Mädchen, und so wird’s dich nicht wundern, was Bäckermeister
Brezelbaum dem hungrigen Fremden anbot: „Du gehst bei mir in die Lehre; und wenn
ich mit dir zufrieden bin, dann bekommst du bei mir genügend Kost, auch Logis, und außerdem will ich auf das Lehrgeld verzichten. Und
stets saubere Arbeitskleidung gibt es als Draufgabe. Also?“
Na, wenn dir der Magen knurrt und du solch eine Chance erhältst, dann wirst du’s gewiß annehmen. So auch
Karstenjo.
Nun hatte aber der Bäckermeister ein Töchterlein, das hieß Kerstin, und das ist kein Name für ein zimperliches
Schattengewächs. Und des Mädchens Spiel schaute der neue Bäckerlehrling an manchen Nachmittagen zu, wenn er sich auf der Bank vor dem
Haus von seiner Arbeit ausruhte.
Friedlich ging es da nicht immer zu, sondern sehr wild; sogar Püffe und Tritte wurden ausgeteilt. Schnell hatte dann auch Kerstin ihre Hand erhoben, um heimzuzahlen; doch dann ließ
sie den Arm wieder sinken und rechtfertigte das nicht ohne Stolz: „Mein Papa schlägt auch nicht zurück, wenn ich ihn aus Versehen getreten oder geschlagen habe. Ph, ein Kind weiß doch noch gar nicht, was es tut; da darf doch niemand
zurückschlagen.“
Die Achtung vor Kerstin wurde durch solch ein Verhalten gewiß nicht geringer. Oder wenn Kerstin einen
Diebstahl bemerkte und den Täter zur Rede stellte: „Du wolltest es bestimmt nur ausleihen. Mein Papa glaubt auch nicht, daß ich ihn
bestehlen will; und wenn ich’s wieder zurückgebe, ist alles wieder gut.“
Und stell dir vor, der Täter konnte nicht anders, als es –
„Und was hat das alles mit mir zu tun“, konnte sich Donna Schaffner nicht länger zurückhalten, „und mit dem, was mir dieser Kerl angetan hat?“
„Und manches Mal“, fuhr der Alte fort, als hätte er nicht zugehört, „teilte Kerstin ein Laiblein Brot mit ihren Spielkameraden. Das habe ihr Papa mit ihr geteilt, und deshalb teile sie es weiter. Tscha, wie mein
Vater mir, so ich dir, das klappt nur dann, wenn du einen gütigen Vater hast und du deine Kinderschuhe anbehältst. Selig sind die
Kinder, die so leben, denn –“
Doch die Besucherin hatte wohl keine solche Kindheit gehabt und war inzwischen gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *27.6.2024, freigegeben am 6.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.231 Eine große Familie
„Habt Ihr eigentlich ein Glaubensziel?“ fragte Don Waltan.
„Ja“, antwortete der Alte von der Halbinsel, „die ewige Herrlichkeit bei
Gott.“
„Nicht diese – diese Braut“, der Besucher versuchte, sich zu sammeln, „und diese Könige im 1000jährigen –?“
„Ich als Braut?“ zweifelte der Alte. „Für eine Frau mag
das erstrebenswert sein; aber für mich als Mann? Nee, ich täte lügen, wenn
ich behauptete, mich in diesem Bild wiederzufinden. Und viel zu viele haben sich daraus einen Konkurrenzkampf hinein- und
herausgelesen. Und –“
„– die Könige?“ erinnerte Don Waltan.
„Als Rang? Nö“, entgegnete der Alte. „Schon wieder
viel Pulver für einen Konkurrenzkampf. Die nach so etwas streben, könnte Gott doch gar nicht
gebrauchen.“
„Wie das?“ wunderte sich der Besucher. „Stellt Ihr Euch
damit nicht gegen die herrschende –?“
„Ist herrschen durch Menschen jemals christlich gewesen?“ fragte der Alte verneinend. „Göttlich ist es jedenfalls nicht. Göttliches Prinzip ist das Dienen; allen dienen! Wer aber herrschen will und gar kein Interesse am
Ergehen seiner Mitmenschen hat, ja, in ihnen sogar lauter Konkurrenten zu sehen wähnt, wie kann der als Same Abrahams Gottes Segen sein? Damit will ich nun nicht das Kind mit dem Bade
ausschütten. Gnade vor Recht ist auch das, was ich mir wünsche;
aber es ist mein Glaube, daß Gott souverän und unbestechlich ist und ich mir bei ihm kein Privileg durch eigene Leistung verdienen kann. Ich glaube, daß Gott immer an alle Menschen denkt; wieso sollte er da überhaupt an einzelne Menschen Privilegien verteilen? Teile und herrsche? Nö, mein Gott ist kein Freund des
Konkurrenzkampfes, sondern ein Liebhaber des Lebens“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger Kronprinz, der – der hieß Friedhelm. Der war dazu bestimmt, bald Thron und Reich zu
erben. Na ja, und zum Heiraten war er auch bestimmt; ob bald oder später,
Hauptsache: die Richtige. Wer aber war das?
Ach, ja, König Drosselbart läßt grüßen! Freilich – hier eher als
Prinzessin Drosselsang. Jedenfalls begann Friedhelm Blicke auf das schöne Geschlecht zu werfen und wurde dabei von mancher glänzenden
Verpackung eingehakt. Ja, ja, Verpackung – le mot juste? Schau dich nur mal
um: Anscheinend werden Verpackungen zu unzähligen Zwecken hergestellt, nur zu einem nicht: geöffnet zu werden. Und genau das erlebte
nun auch unser Friedhelm: All der Glanz war nur Blenden und Täuschen; und anscheinend wollte sich keine so zeigen, wie SIE wirklich
war. Wo aber getäuscht wird, kann kein Vertrauen fruchten.
„Wenn das so ist“, wandte sich der Kronprinz, vielfach enttäuscht, von seiner Brautschau ab, „dann ist’s doch besser, ich lege mich erst einmal darauf, das Regieren zu
erlernen.“
Tscha, wie wirst du ein guter König? 1. mußt du mit dem Werden anfangen, und 2. mußt du wissen: Was ist ein
guter König? Nee, so zu werden wie sein Vater, das wollte Friedhelm selbstverständlich nicht. Also? Also mußte er ins Ausland reisen und sich dort umschauen.
In seiner prächtigen Kutsche war unser Friedhelm am Hofe des Großherzogs Graban selbstverständlich sehr willkommen; denn wer derart vorfährt, verheißt lohnende
Geschäfte. Gerne war Graban bereit, seine Regierungskunst dem jungen Mann vorzustellen.
„Eigentlich ganz einfach“, faßte es der Gastgeber zusammen: „Teile und herrsche. Du darfst eben deine Gunst nicht verschenken, denn sonst bekommst du nichts dafür.
Nein, du mußt deine Gunst vermieten; denn alles hat seinen Preis. Und schon hast du Wetteifern unter deinen Untertanen, und niemand ist mehr träge, sondern jeder läßt aus sich alles herausholen, was er hat und
kann. Effektiver geht’s nicht.“
Doch an dieser Behauptung mußte unser Friedhelm bald sehr zweifeln, als er genauer hinsah. Und
hinhörte! Was wurden für Zeit und Kräfte vergeudet, sich gegenseitig ein Bein zu stellen und sich gegenseitig
schlechtzumachen. Nee, überzeugend war das für unseren Kronprinzen nicht.
Also ritt er auf einem seiner Pferde weiter an den Hof des Ebnergrafen Laschke. Auch dieser Regent ließ sich
gerne in seine Karten gucken.
„Bei mir sind alle gleich“, verriet Laschke, „und jeder kann machen, was er will. Hauptsache, sie zahlen alle
pünktlich ihre Steuern und lassen mich in Ruhe.“
Das mit der Ruhe mochte stimmen, doch wie lange noch? Denn es waren eben nicht alle gleich. Auch hier gab es eine Hackordnung und erbitterte Kämpfe um einen möglichst hohen Rang. Und wer’s weit nach oben geschafft hatte, der schielte sogar nach dem Thron.
In Gedanken versunken, wanderte Friedhelm weiter und kam an den Hof von Evelinde. Hof? Nee, in einem Schloß wohnte SIE nicht, auch wenn’s nicht auszuschließen war, daß es früher mal ein herrschaftliches Haus gewesen war. Nun aber war alles belebt mit Ranken und Reben und hatte seinen Jahresgang.
„Welch ein Glück, daß du mich hier antriffst!“ begrüßte die junge Frau. „Ich muß gleich wieder los, und du kommst am besten mit. Wie ich regiere? Gar nicht. Wirst es ja gleich sehen.“
Und mährsächlich: Evelinde gebot nicht, sondern – fragte. Denn –
„Und was hat das jetzt alles mit meinem Königtum zu tun?“ konnte sich Don Waltan nicht länger
zurückhalten.
„Mit deinem Herrschen?“ fragte der Alte und antwortete unerschrocken: „Vermutlich überhaupt nichts. Denn Evelinde verstand sich als Landesmutter. Und zwar für alle. Und deshalb müsse sie erforschen, welche Begabungen ein jedes ihrer Kinder habe. Und
wenn sie dementsprechend Aufgaben verteile, dann wirkten jede und jeder, was sie gut und gerne können. Dann könne sich auch eins auf
das andere verlassen, und alle täten einander brauchen und gerne helfen. Statt Eifersucht: Dankbarkeit. Wozu dann noch eine Fürstin? Alle gehören doch zur gleiche Familie, und keines werde
von der Mutter weniger geliebt oder –“
Allein – Don Waltan war inzwischen gegangen; anscheinend zum Herrschen, als gehöre er nicht zur
Familie. Noch nicht!
© Stiftung Stückwerken, *4.7.2024, freigegeben am 13.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.232 Der Spielgeher
Unterwalt
„So eine hat in unserer Gemeinde einfach nichts mehr zu suchen“, setzte sich Don Kurzweg auf seinen Richtthron.
„So?“, versagte der Alte von der Halbinsel seine Zustimmung. „Täte sie denn überhaupt noch etwas finden? Zum Beispiel Barmherzigkeit und –?“
„Steht’s nicht in Eurem Buch dort drüben“, war’s dem Besucher eigentlich gar keine Frage: „Eine solche werden sie
aus der Gemeinde werfen, –“
„– Evangelium?“ war der Alte noch nicht fertig.
„Evangelium ist dein Zitat nicht; obwohl das, was du jetzt nicht zitiert hast, nur allzu oft die Folge ist: und ihre Kinder müssen’s entgelten. Und das Evangelium täte die Ursache für diese Folgen auch in der Sippenhaft –“
„Nun, Kinder hat sie ja keine“, versuchte Don Kurzweg umzulenken, „aber einen Vater; und der ist wohl noch
schlimmer. Welche verirrten Ansichten die beiden –!“
„Verirrt?“ schien der Alte zu zweifeln, blätterte dann in seinem abgegriffenen Buch und reichte es dann dem
Besucher: „Hier, wie liesest du?“
Dieser aber las: „Das Verirrte holt ihr nicht, und das Verlorene sucht ihr nicht; sondern –“, hier
brach er ab und meinte, richtigstellen zu müssen: „Das ist hier wider die Hirten Israels!
Ich aber bin kein –“
„– Hüter deiner Schwester und deines Bruders?“ ergänzte der Alte. „Keinerlei Mitverantwortung? Nicht jeder, der verirrt genannt wird, war Handelnder aus freien Stücken. Mancher wurde verloren, und niemand hat ihn gesucht. Mancher hat frisches Brot erwartet, aber nur Opium vorgefunden, seine Erdenreise besser ertragen zu können. Ach, es ist schon ein Jammer! Allein – suchen wir in der Welt der Mährchen neue
Zuversicht!“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein Graf, der hieß – der hieß Unterwalt. Nun ja, anfangs war er nur ein Grafensohn, also ein
Prinz; da sein Vater Reichsgraf war. Doch reich, nee, das war der Vater
nicht. Die Burg eine zeitlose Baustelle mit viel Moos auf dem Dach, aber wenig Silber in der Truhe. Die Fensterläden, so sie geöffnet waren, derart geneigt, als wollten sie gerade den Absprung wagen. Und die Türsturze durch Absenkungen so niedrig, daß kein großes Tier hätte eintreten oder hinaustreten können, geschweige denn ein hohes, sondern
nur gebeugte Menschen. Die Häuser der Bauern sahen nicht wesentlich stattlicher aus. Wäre Unterwalt ein Stadtkind gewesen, etwa das Kind eines Tagelöhners oder armen Webers, so wär’ aus ihm ein Spielgeher geworden. Was das ist? Ein Kind, das niemanden zu sich nach Hause einladen kann, sondern zu
anderen zum Spielen gehen muß.
Nun war Unterwalt zwar kein Stadtkind, sondern hatte eigentlich eine herrliche Kindheit. Richtig romantisch,
mit verfallenen Türmen und Kellern, mit Feldern und Wäldern und – mit viel Phantasie. Was
mochte aus dem Knaben werden? Tscha, ich
tät’ seine Zukunft sogar ramontisch nennen. Irgendwann entdeckte nämlich jemand, vermutlich seine Mutter, seine besondere Begabung:
Unterwalt konnte malen. Nicht photographisch, sondern – mit Phantasie. Und
eben ramontisch: jedes Bild eine Geschichte, nicht auszuschöpfen, aber bei jedem Besuch ermutigend. Nee, Dukaten oder Taler kannst du
mit solch einer Kunst weder anlocken noch festhalten, aber du kannst damit leben.
Tscha, und als Unterwalt sich auf den Grafenstuhl setzte und damit ein Sitzrecht für die Fürstenbank hatte, wurde er doch noch sozusagen zum Spielgeher. Denn eine Braut konnte er sich nicht nach Hause einladen, sondern er mußte zu IHR gehen. Wie Richlinde und Unterwalt zueinandergefunden haben, das hat hinterher niemand begreifen
können. Erst recht nicht Mutter Alma. Eindringlich versuchte sie ihrer
Tochter ins Gewissen zu reden, daß eine Verbindung mit jenem Hungerleider nicht standesgemäß sei und weder Reichtum noch Ansehen vermehre. Dieser Kerl wolle sich doch einzig und allein ins gemachte Nest setzen und dann das verprassen, was
sie sich mühsam erarbeitet hätten. Und hätte ER erst einmal genügend Geld, na, dann wisse jede vernünftige Frau mit einigermaßen
Erfahrung, wie es dann um SEINE eheliche Treue bestellt wäre. Womöglich täte er sich dann sogar noch auf die Aktmalerei
legen.
Allein – wer das Gewissen voll ist, der kann nichts mehr eingeredet werden. Richlinde ließ die
Hochzeitsglocken läuten, und das auch für Unterwalt, schickte Fuhrleute zu dessen Burg, und – fortan war der Graf mit 2 Frauen verheiratet, wenn auch in der Schlafkammer nur mit der
jüngeren. Wenigstens da war Ruhe? Denkste!
Ich sagte ja bereits, daß aus Unterwalts Vaterhaus weder ein hohes noch ein großes Tier zu erwarten war, sondern nur ein gebeugter Mensch. Unterwalt hatte es nie gelernt, sich durchzusetzen. Und hier nun, auf Almas Schloß,
ward ihm ständig vorgehalten, was er alles zu tun habe; und alles Aufgaben, für die er gar keine Begabungen besaß. Demgegenüber wurde ihm zum Malen gar keine Zeit mehr gelassen. Zufrieden macht so
etwas nicht; und eines Tages platzte ihm der Kragen: Er schalt seine Schwiegermutter einen Drachen. Und es ist ja nicht das 1. Mal, daß ich eindringlich davor warne, Menschen einen Tiernamen zu geben. Doch leider auch hier: Augenblicklich wurde Mutter Alma fabelhaft.
Den Beifall der Eheliebsten fand diese Verwandlung ganz und gar nicht; Unterwalts auch nicht, denn er war nun
der Sündenbock und im Kampf gegen einen Drachen auf verlorenem –
„Und was hat das jetzt alles“, konnte sich Don Kurzweg nicht länger zurückhalten, „mit jener Verirrten –?“
„Unserer verlorenen Schwester zu tun?“ verbesserte der Alte. „Nun, Unterwalt wußte selber keinen Rat und ging deshalb zu seiner guten Fee. Doch die sah alles überhaupt nicht dramatisch, erst recht nicht tragisch. Der
Graf habe in seiner Schwiegermutter einen Drachen gesehen, sie deshalb so genannt, und schon habe sie sich verwandelt. Versuche er es
doch nun umgekehrt: Sehe er in dem Drachen eine Mutter, ja, auch seine Mutter, und nenne er sie auch so, dann werde sich schon manches finden. Freilich – er müsse schon darum kämpfen, täglich auch Zeit für die Aufgaben zu haben, für die er Begabungen erhalten habe. Na, und wenn in unserer Gemeinde wieder frisches Brot ausgeteilt wird statt Opium, dann –“
Doch das hatte auch dieser Besucher nicht abwarten wollen, sondern war gegangen; noch nicht einmal sich selber
hütend?
© Stiftung Stückwerken, *12.7.2024, freigegeben am 20.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.233 Die Hirtenschule
„Also in aller Demut und Bescheidenheit“, ließ Don Eusebio diese anscheinend alle werden, „einer dieser Könige in Jesu Reich bin garantiert auch ich.“
„So?“ klang der Alte von der Halbinsel eher verwundert denn zustimmend.
„Seit einigen Jahren hab’ ich endlich alles unter meine Füße gebracht“, begründete der Besucher seine Garantieerklärung, „bin also ein Überwinder –“
„Wie schön für dich“, verschwieg der Alte seinen Zweifel nicht, „aber wie schlimm für deine Untertanen, und – damit dann doch auch für dich.“
„Wie das?“ kam Don Eusebio nicht mit.
„Entweder sind deine Untertanen nicht so willensstark wie du“, folgerte der Alte, „dann kannst du sie nicht verstehen und ihnen auch nicht helfen; oder sie sind genauso willensstark wie du, brauchen dich nicht und können sich mit eigener Kraft helfen, aber dann wollen sie vermutlich auch
regieren wie –“
„Das sind doch Hirngespinste!“ entrüstete sich der Besucher. „So steht’s nicht in der Bibel!“
„Dort steht zum 1000jährigen Reich sehr wenig“, schränkte der Alte ein, „und manche herrschende Meinung baut Verbindungen hinein, die sich auf Dauer nicht halten
lassen. Was meinst du: Können Menschen, die vor allem an sich selber denken, Gottes Segen sein für
alle Völker?“
„Aus einem Sumpf kann nur retten, der selber auf sicherem Grund steht“, hielt Don Eusebio dagegen.
„Und retten will und retten kann“, ergänzte der Alte und begann zu erzählen:
Es wär’ einmal eine Herde Schafe, die hatte keinen Hirten. Und weil diese Tiere dieser Zeit und diesen Ortes
noch in einem hohen Ansehen standen, wurde eine Abordnung von ihnen sogar zum König vorgelassen, ihr Anliegen vorzutragen. Dort fanden sie nicht nur Gehör, sondern sogar unerwartete Unterstützung. Denn der
König war noch in den alten Schriften bewandert und wußte, daß ein Hirte sogar von der höchsten Instanz für würdig befunden werden konnte, zum König gesalbt zu werden. Und da der König nur ein einziges Kind hatte, dem er das Regieren jedoch nicht so recht zutraute, ließ er kurzerhand in allen Landen etwas
verbreiten. Was? Na, daß er die Hand seiner Tochter demjenigen verspreche, der jener Schafherde 3 Jahre lang ein treuer Hirte wäre.
Na ja, 3 Jahre sind eine lange Zeit; da hat doch manche Mutter eine Tochter, deren Hand leichter zu erringen
ist. So wird es dich nicht wundern, daß vor dem königlichen Schloß die Kandidaten nicht Schlange stehen mußten. Es meldeten sich noch nicht einmal 10 Bewerber, noch nicht einmal 5, sondern nur einer. Der fuhr aber in einer prächtigen Kutsche vor und entstieg dieser in einer Erscheinung, die allgemein stattlich genannt wird: von hohem Wuchs,
kerzengrade und selbstsicher im Auftreten. Also ein Schwiegersohn – na ja, dem König etwas unheimlich, dessen Eheliebster aber sehr willkommen: Da könne der König endlich mal sehen, was aus ihm hätte werden mögen, wenn er sich nicht so gehengelassen hätte. Jedenfalls wußte Richthart das Vertrauen des Königspaares so weit zu gewinnen, daß er für
die schwere Aufgabe zugelassen wurde.
Er ließ sich nun den Weg zu der Herde beschreiben, setzte sich wieder in seine Kutsche, jagte los und – kam auch endlich zum Stehen. Im Gegensatz zur gesuchten Herde, denn die kam zum Fliehen. Welches Schaf schaut
seelenruhig zu, wenn es gejagt wird? Die Herde hatte nicht um einen Jagenden gebeten, sondern um einen Hirten. Der Einstand ging also völlig daneben, und dazu nahmen die Schafe auch kein Blatt vor das Maul.
Richthart war jedoch nicht lernunwillig, sondern nahm die ihm zugeteilte Lektion bereitwillig an: Du darfst Schafe nicht mit oder aus einer Kutsche hüten. Auch nicht zu Pferde, gaben die Schafe als Draufgabe mit auf den Weg.
Weg? Tscha, das war die 2. Lektion: Schafe wollen wandern. Na, denn mal los! Alles hört auf mein Kommando! Ohne Tritt, marsch! Wenn jetzt nicht aus dem Hintergrund ein herzhaftes Lachen
erklungen wäre, so hätte der neue Hirte seine Herde bald aus den Augen verloren, zumal er sich erst jetzt umblickte. Wer da gelacht
hatte, das konnte Richthart nicht entdecken, doch hatte es ihm mehr nach einem Auslachen geklungen. Etwa über ihn? Die Schafe dachten ähnlich, nur daß sie es auf sich bezogen. Und da solche Gedanken
nicht trennen, sondern vereinen, zogen Herde und neuer Hirte erst einmal in die gleiche Richtung. Wohin?
In den Wald! Wohl eine Meile hinein, dann war Schluß. Denn dieser Zeit und diesen Ortes reimen bereits die Kleinen:
Wagst in den Wald du einen Schritt,
dann nimm gleich Axt und Säge mit!
Denn die königliche Forstverwaltung ist wegen ihrer Bedächtigkeit bekannt und die Bäume sind’s wegen ihres umwerfenden Wesens. So
stellte auch Richthart fest, daß Fußgänger in Altenstadt nicht willkommen sind; und da Kutsche und
Pferd den Schafen nicht willkommen waren, sah Richthart keine gemeinsame Zukunft mehr und gedachte, die Herde im Stich zu lassen.
Als er sich umwandte und bereits ein paar Schritte zurückgegangen war, trat ihm in der Abenddämmerung beherzt eine Gestalt entgegen
und hielt ihm vor, daß er von der Schäferei anscheinend keinen blassen –
„Genau!“ konnte sich Don Eusebio nicht länger zurückhalten. „Welch ein Idiot führt Schafe in den Wald?“
„Und das auch noch in den Altenstädter Ewald!“ lachte der Alte. „Aber ich sagte bereits, Richthart war nicht lernunwillig. Und lernunfähig auch
nicht. Zunächst einmal wußte jene Gestalt ihn dazu zu bewegen, die Schafe aus dem Wald wieder hinauszuführen. Nun ja, nach einem Umweg von 2 Meilen kamen sie etwa 2 Stunden vor Mitternacht bei Dortwehr wieder aus dem Walde hinaus, auch fortan nicht ohne Hindernisse. Handwerker hatten eine Straße
gesperrt und Globebanausen einen Fußweg. Immerhin war’s schon eine denkwürdige Prozession, die da durchs Dorf zog: voran Richthart,
dann der Gesangverein Blökespiel und jene Gestalt als Nachhut. Immerhin reichten die Kräfte bis zum Kühlebachtal, wo endlich Wasser und Weide gefunden werden konnten. Tscha, und von nun an wußte jene Gestalt
des neuen Hirten Interesse zu wecken und zu lenken. Wofür und worauf? Die
Herde zu fragen und zu bedenken, was die Schafe brauchen; und nicht, was der –“
Doch nun gewahrte der Alte, daß der Besucher inzwischen gegangen war, und er wünschte ihm auch so eine herzhaft lachende Gestalt wie in diesem Mährchen.
© Stiftung Stückwerken, *19.7.2024, freigegeben am 27.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.234 Es allen recht machen?
„Richtig unfreundlich!“ schimpfte Don Schaller. „Statt auf ihre –“
„Wie’s in den Wald hineinschallt“, war dem Alten von der Halbinsel seine Eitelkeit anscheinend wichtiger denn sein Mitempfinden, „so –“
„– Fahrgäste einzugehen“, blieb der Besucher in Fahrt, „gießen sie noch Öl –“
„Fahrgäste?“ griff der Alte auf. „Gastfreundschaft
–“
„Ha!“ lachte Don Schaller bitter. „Die wird bei denen
kleingeschrieben. Und das, obwohl wir immer länger unterwegs –“
„Immer?“ zweifelte der Alte.
„Durch die Verspätungen und Zugausfälle“, erhitzte sich der Besucher wieder, „verlängert sich meine Reisezeit um etwa eine Stunde pro Jahr. Wo soll das noch –“
„Soll?“ rieb sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort. „Niemand soll –“
„Doch!“ war Don Schaller anderer Ansicht. „Die sollen
erst mal zuverlässig werden! Und das auf Augenhöhe, –“
„Augenhöhe?“ verband sich der Alte. „Ja, die ist was
Gutes. Aber doch nicht als Soll, sondern –“
„Nee, nee, da muß endlich ein eiserner Besen her“, widersprach der Besucher, „und zeigen, was eine Harke –“
„Also mit ihnen in ihrer Muttersprache reden?“ überschätzte der Alte die Belesenheit seines Gastes. „Und du hast aber deine Freundlichkeit nicht erschüttern –“
„Ich hatte mich in der Warteschlange erst mal bei den andern umgehört“, gab Don Schaller zu, „was die für Schwierigkeiten mit dieser Bummelbahn haben. Na ja, wie das so ist, meine eigenen Erfahrungen hab’ ich natürlich nicht im Schweißtuch
behalten. Mag sein, daß der hinter dem Schalter was davon –“
„Ihr hättet beide wohl besser mal die Schuhe getauscht“, leitete der Alte ein neues Mährchen ein:
Es wär’ einmal ein junger König, der – der hieß Servinus. Der wollte es allen recht machen; was ja selbst der liebe Gott nicht kann;
jedenfalls auf dieser Erde nicht. Anscheinend war der junge König in der Welt der Märchen etwas bewandert, denn auch er beschloß,
seinen Unterricht unerkannt zu nehmen.
Unterricht? Ja, wer etwas machen will, muß erst mal etwas lernen; hier also: Menschen zu verstehen. Und das kannst du dir nicht aus dem Ärmel
schütteln, auch nicht an deinem Schreibtisch ausdenken, sondern du mußt zu den Menschen gehen und ihnen zusehen und zuhören. Wo aber
anfangen?
Bei den Kaufleuten! dachte Severinus; denn die zahlen
Steuern, geben Menschen Arbeit und Brot und gelten überall als wohlhabend und angesehen. Nun ja, auch dazu gibt es unterschiedliche
Ansichten. Severinus sprach jedenfalls mit seiner ursprünglichen Ansicht bei Herrn Direktor Batzenberg vor, ob er auf dessen Kontor als Praktikant arbeiten dürfe.
„Was hab’ ich davon?“ fragte der Kaufmann schwarzsehend.
„Frischen Wind“, ließ sich Severinus nicht einschüchtern.
Diese Antwort schien dem Herrn Direktor gefallen zu haben: Dieser junge Mann war jedenfalls kein Nichts. Und
als kostenloser Bote, Schreiber und Kaffeekocher täte er gewiß Gewinn abwerfen. Und das für einen ganzen
Monat!
Tscha, und was lernte unser Severinus nun? Worum ging es dem reichen Kaufmann? Den Gewinn, den andere abwerfen, aufzufangen, zu sammeln und wieder gewinnbringend einzusetzen. Also? Ging’s etwa um Raub? Nein, lachten die Kontoristen, rauben kannst du erst, wenn du keine Konkurrenten mehr hast. Bis dahin mußt du den Menschen das Geld ohne Gewalt abnehmen, aber so, daß sie es nicht merken. Ja, am besten ist es, wenn sie dir das Geld sogar aufdrängen, wie der Süchtige, der neue Drogen braucht. Somit ist das, was wir tun, auch kein Verbrechen, denn wir nehmen ja nicht, ohne was zu geben. Nur sind unsere Waren lediglich ein Mittel zum Zweck; in 1. Linie geben wir:
Anerkennung, Zeitvertreib, Sättigung.
Frei kamen Severinus die Kaufleute jedoch nicht vor, und er mußte sehr aufpassen, sie nur zu beobachten, jedoch nicht so zu werden wie sie.
Im nächsten Monat arbeitete der junge König unerkannt in einer Fabrik und lernte, worum es den Arbeitern ging. Eigentlich – war der Unterschied zwischen ihnen und den Kaufleuten nicht wesentlich, auch wenn’s niemand zugeben wollte. Um Gerechtigkeit gehe es ihnen, redeten sie sich ein; um eine gerechte
Entlohnung. Doch wie die auszusehen habe, dazu gab es keine einheitliche Meinung.
Aber es war hier in der Fabrik, wo der junge König zu ahnen begann, daß es kein erreichbares Ziel war: es allen recht zu machen.
Den 3. Monat brachte Severinus an der Hochschule des Landes zu und ab.
Oy, oy, oy, was wurden hier die Nasen hoch getragen! Was hier alles an Wissen auf Lehrstühlen thronte! An neuesten Erkenntnissen! Doch die großen Bibliotheken zeugten davon, daß so
arrogant früher auch schon gedacht worden war, bis – bis es als überholt und veraltet galt. Selbst das Bekenntnis jenes weisen Griechen
galt als Schnee von gestern: Ich weiß, daß ich nichts weiß.
In Gedanken versunken, ging der junge König nach dem Ende seines letzten Praktikums zurück zum Schloß. Da
wurde er plötzlich angesprochen, ob er Sorgen habe oder Kummer. Verwundert blickte er auf und sah in ein jugendliches Gesicht und 2
zuversichtliche Augen. So konnte er nicht anders, als seine Absichten zu teilen, seine Ernüchterung und seine Ratlosigkeit.
„Du hast es wohl nicht am richtigen Ende angepackt“, faßte Serenetta zusammen, was mit ihr geteilt worden
war. „Du hast nur das Unkraut gesehen, die Kletten, die Schlingpflanzen.
Keine guten Früchte? Keine Blüten? Kein zartes –?“
„Genau!“ übertrieb Don Schaller. „Was hat das alles mit
der Bummelbahn zu tun und deren unfreundlichen –“
„Zunächst überhaupt nichts“, gab der Alte lachend zu, „denn dort hatte der junge König gar kein Praktikum gemacht. Aber Serenetta wußte den Blick des jungen Königs darauf zu lenken, daß jeder Mensch wie ein Gartenbeet sei. Wolle er, Severinus, jedem Beet zu dessen Recht verhelfen oder jedem geben, was es zum Leben brauche: guten Samen, Pflege und Schutz sowie
genügend Wasser und Wärme? Und da auch jede Schaffnerin und jeder Lokführer ein solches –“
Doch schwarzsehend war es dem Besucher anscheinend zu bunt geworden, und er war grußlos gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *26.7.2024, freigegeben am 27.7.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.235 Sonntagsstaat
„Wißt Ihr eigentlich, was die Leute über euch reden?“ fragte Don Richtenberg.
„Wohl kaum“, antwortete der Alte von der Halbinsel. „Ist das überhaupt wichtig?“
„Na, wenn sie behaupten“, berichtete der Besucher, „Ihr kämt gewiß nicht in den Himmel, ist das nicht –?“
„Ist das eine göttliche Prophezeiung?“ zweifelte der Alte sehr.
„Jedenfalls offensichtlich“, wollte sich Don Richtenberg selber nicht festlegen, „so sagen sie. Denn wer so
wie Ihr in heruntergekommener Kleidung in das Haus des HERRN gehe, werde auch im Hochzeitssaal des Lammes kein
hochzeitlich’ Kleid tragen und deshalb hinausgeworfen –“
„So?“ sah’s der Alte anscheinend anders. „Hat da jemand
ein Gleichnis Jesu mit einem Bild aus der Offenbarung des Johannes zu einem
Bilderrätsel zusammengefügt und ausgelegt?“
„Sogar mit Gummistiefeln seid ihr angeblich schon in der Kirche –“
„– von Kutschern und Kutschierten gesehen“, ergänzte der Alte bestätigend, „und ausgegrenzt worden; die ihren
Sonntagsstaat nur in ihrer Kutsche und im Kirchengebäude tragen; Hauptsache, sie werden nicht –“
„Der Mensch wird zum Tier“, zitierte der Besucher, „wenn er nie einen
Sonntagsrock –“
„Ich kannte einen Professor“, hielt der Alte dagegen, „der seine Sonntagskleidung werktags bei der Arbeit trug und seine Freizeitkleidung eben am –“
„Ein Kirchgänger war der bestimmt nicht; oder?“ folgerte
Don Richtenberg.
„Das vermute ich auch so“, räumte der Alte ein, „denn er machte sich über Kirchgänger lustig und über Spaziergänger im – Ach“, seufzte der Alte und begann zu
erzählen:
Es wär’ einmal ein Königssohn, der – der hieß Andersen. Und da er der Kronprinz war, hielt er von Kindesbeinen
sozusagen seine Augen offen und Notizbuch und Bleistift griffbereit. Wozu?
Na, um festzuhalten, was er nach seiner Krönung anders machen wolle.
Kleidung fand lange Zeit keine Erwähnung in seinem Notizbuch; aber als er eines Tages wie von ungefähr Zeuge
wurde, wie ein Geschäftsmann von einem sehr seriös gekleideten Bankräuber übers Ohr gehauen wurde, war des Prinzen Interesse geweckt.
Schnell fand er heraus, daß Kleidung vielfach als Mittel für bestimmte Zwecke eingesetzt wurde. So kleideten
sich die Zimmerleute anders denn die Schornsteinfeger und diese anders denn die Bäcker. Wozu? Vermutlich um ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Handwerk zu zeigen. Allein –
hier und da wurd's aber auch, um diese vorzutäuschen.
So etwas gab es auch bei den hoch angesehenen Zünften der Bankräuber und Versicherungsbetrüger. Wie viele
Menschen darauf reinfielen und an Vermögen erleichtert wurden! Sonderbar!
Die Kleidung täuschte Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit vor, doch in ihr steckte etwas ganz anderes. Mußte das immer etwas
Schlechtes sein?
Als der Prinz begann, sein Interesse dem schönen Geschlecht zuzuwenden, hätte er das gerne verneint; doch
zunächst mußte er viel Lehrgeld bezahlen. Immer wieder ertappte er sich dabei, daß er auf die Kleidung hereinfiel. Bereits die Farben! Rosa hielt er für ein Zeichen von mädchenhafter Unschuld, Rot als
Ausdruck feuriger Leidenschaft und dunkles Blau mit silbernen Nadelstreifen als Hinweis für Herrschaftsansprüche. Doch gerade bei
dieser Kleidung wurde er am seltensten enttäuscht. Rosa erwies sich dagegen oft als launisch und unzuverlässig, Rot als Köder der
Torschlußpanik.
Aber der Prinz gewahrte auch, welchen Eindruck seine Geschlechtsgenossen auf die Schönheiten machten.
Offiziere in Uniform brauchten sich im Ballsaal über einen Mangel an Tanzpartnerinnen keine Sorgen zu machen; da konnte kein
Kanzleischreiber mithalten. Ob das Absicht des Kriegsministers war? Oder
sogar des Königs? Jedenfalls heirateten Offiziere in der Regel die attraktivsten Frauen; auch die treuesten?
Jedoch – Andersen wollte ja herausfinden, ob es auch Menschen gab, die wertvoller waren, denn sie mit ihrer Kleidung versprachen. Etwa die Bettler? O weh!
Hier konnte die Kleidung vermutlich nicht erbärmlich genug sein, um – Mitleid zu erwecken. Aber auch wer gewerbsmäßig bettelt, ist ein
Mensch wie du und ich und will nicht nur Geld, sondern auch Anerkennung. Und so wurde hier zuweilen nach Feierabend eine ganz andere
Kleidung getragen denn zur Geschäftszeit.
Eines Tages geriet Andersen bei seinen Streifzügen in einen kräftigen Regenschauer und wäre völlig durchnäßt worden, wenn nicht – ja, wenn nicht neben ihm ein
Pferdefuhrwerk gehalten hätte. Ob er mitfahren wolle? Besser naß gefahren
denn naß gelaufen? Aber er war so freundlich gefragt worden, daß er einfach aufsteigen mußte, ob er wollte oder nicht. Er tat es auch nie bereuen. Zunächst mußte er sich in einen Regenmantel einhüllen und
den unteren Teil seines Körpers mit einer Plane bedecken. Und dann ging’s weiter. Nö, nicht aufs Schloß, sondern auf einen kleinen Bauernhof mit Hühnern, einem fürstlichen Hahn, Gänsen und sonstigem Kleinvieh. Nachdem die Tiere versorgt waren, gab’s noch einen kleinen Plausch in der Küche. Über
was? Über Kleidung! Das lag auch nahe, denn selbst in der Küche trug die
freundliche Kutscherin ihr grünes Kopftuch, ihre grüne Schürze und – Gummistiefel! –
„Damit wird sie doch hoffentlich nicht zur Kirche gegangen sein!“ entsetzte sich Don Richtenberg.
„Das kann ich nicht ausschließen“, konnte der Alte nicht besänftigen. „Jedenfalls war sie der Ansicht,
Kleidung müsse Aufgaben erfüllen: Schutz gegen Wind und Wetter, Schutz gegen Kälte und Hitze, ja, und bequem müsse sie auch noch sein;
wie bei den anderen Lebewesen auch. Sie müsse eben zum eigenen Sein passen.
Ob sich das anordnen lasse? Nö; aber wenn niemand mehr aufgrund seiner
Kleidung bevorzugt oder benachteiligt werde, dann werde sich Natürlichkeit schon einbürgern. Wichtig sei doch nicht die Schale eines Menschen, sondern
seine Blicke, seine Stimme, sein Nachklingen, –“
Doch leider werden wir wohl nie erfahren, ob da eine künftige Königin gesprochen hatte, denn dem Alten war der Zuhörer inzwischen abhanden gekommen.
© Stiftung Stückwerken, *13.9.2024, freigegeben am 21.9.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.236 Souverän
„Und er hatte mich extra angeschrieben“, versuchte Donna Dannewann ihre Gedanken zu sortieren, „und eingeladen! Aber –“
„So?“ kochte der Alte von der Halbinsel sein Interesse auf Sparflamme.
„– ich komm’ also dahin“, fuhr die Besucherin fort, „und an die Türe; und jetzt stellt Euch vor: Ich werd’
nicht reingelassen. Was weiß ich weshalb! Ich kannte den gar nicht, der da
den Türsteher spielte. Aber der neue Bischof hatte mich extra eingeladen!
Schriftlich! Na, der mag seine Schäfchen meinetwegen ins Trockene bringen, aber nicht mit mir! Wo gibt’s denn so was! Da geh’ ich nie mehr –“
„Aber vielleicht wußte der Bischof gar nichts davon“, gab der Alte zu bedenken, „oder der Türhüter –“
„Und das sagt Ihr?“ wunderte sich Donna Dannewann. „Der
sonst die Geistlichkeit derart kritisiert? Ihr nehmt sie jetzt sogar in –?“
„Ich kämpfe nicht gegen Menschen“, versuchte der Alte geradezurücken, „jedenfalls ist das nicht mein Ziel. Und
mein Richtstühlchen hat mein Spiegel derart angewackelt, daß ich mich gar nicht mehr –“
„Jedenfalls ist der neue Bischof bereits jetzt bei mir unten durch“, beharrte die Besucherin, „und damit basta!“
„Und das Kind liegt mit dem Bade im Rinnstein?“ folgerte der Alte.
„Welches Kind?“ war Donna Dannewann in den deutschen Sprichwörtern und Redensarten anscheinend nicht sehr
bewandert.
Statt eine unmittelbare Antwort zu geben, begann der Alte zu erzählen:
Es wär’ einmal ein Königssohn, der – der hieß Hortewitz. Ein Kronprinz? Nee, sondern der jüngste von 3 Söhnen. Folglich war sein Nest noch nicht gemacht,
sondern er mußte sich eins in der Fremde selber bauen; oder?
Na ja, wenn einer nicht mehr weit von der Volljährigkeit entfernt ist, dann gibt’s da noch eine andere Möglichkeit: sich in ein Nest zu setzen, das bereits durch eine
Jemandin gemacht war. Auf jeden Fall: Wenn du Schokolade trinken willst, darfst du nicht auf dem Sofa abwarten und Tee trinken, sondern
mußt dich aufmachen und verreisen. Also?
Also rein in die Kutsche und losgefahren! So kommst du zwar schneller über die Grenze und hast unterwegs viel
gesehen, aber nichts gesammelt. Wozu auch; oder? Nun, Hortewitz gelangte also bald nach Leistenschlag, dort zum Schloß und ließ sich durch die Torwache als Heiratskandidat für die Prinzessin anmelden; falls noch eine frei sei.
Eine sei zwar noch frei, meinte der Torwächter, aber ob der Herr für die Prinzessin gut genug wäre, wisse er, der Torwächter, nicht.
„Herr?“ zeigte sich der Prinz ungnädig. „Für Ihn immer
noch: Eure Hoheit! Verstanden?“
„Jawohl, der –, eh, Eure Hoheit“, beeilte sich der Torwächter. „Ich bin schon unterwegs, Euch
anzumelden.“
Wenig später durfte die Kutsche in den Schloßhof fahren, Hortewitz entstieg ihr gesetzten Gemütes und begleitete gesetzten Schrittes einen Lakai ins Schloß. Wohin? Zur Prinzessin?
Nö, gleich zum König; denn der hatte noch immer das Sagen in Land und Schloß; so glaubte er.
Herzlich wurde der Gast nicht empfangen, sondern auf mehr als eine Armeslänge. Noch nicht einmal zum Sitzen
wurde er ermuntert, sondern der König kam gleich zur Sache: Da der junge Mann keine Aussichten auf einen Thron habe, sei er eigentlich gar nicht standesgemäß. Allein – vielleicht ließe sich aber doch was machen, wenn der junge Mann eine Aufgabe recht zu lösen wisse. Die Zahl der Untertanen dieses Landes sei nämlich schon seit Jahren einem starken Schwund ausgesetzt. Wenn dem nicht bald ein Riegel vorgeschoben werde, stehe leider zu befürchten, daß das Land in kaum 7 Jahren wüst und ausgestorben
wäre. Wenn der junge Mann dagegen den richtigen Riegel anzubringen wisse, sei er durchaus einer Königstochter würdig. Und damit er sich auch tüchtig anstrenge, sei ihm wenigstens ein kurzer Blick auf die Prinzessin gewährt. Mehr jedoch nicht, solange die besagte Aufgabe noch nicht allseits zufriedenstellend gelöst sei.
Damit rief der König seine Annemut in den Thronsaal, und (da keine Zeit zu verlieren
war) sahen Prinzessin und Prinz einander in die Augen. Und schon war Annemut wieder entschwunden, während Hortewitz hinterher
nicht mehr zu sagen wußte, wie er aus dem Schloß gekommen war.
Anscheinend zu Fuß! Denn für Kutsche und Pferd hatte er vorerst keine Verwendung mehr, er mußte sich ja
umschauen. Was er da sah? Lauter vorwurfsvolle Blicke! Er sei wohl nicht von hier, wurde er getadelt, aber dann müsse er sich auf jeden Fall bemühen, sich anzupassen. Und wenn ihm das nicht passe, dann solle er gefälligst wieder dorthin gehen, wo er hergekommen sei.
Anpassen an was? Das entdeckte Hortewitz gar bald: Jede Woche wurde ein neues Gebot erlassen! Obwohl eigentlich bereits alles geregelt war: die Frisur, die Kleidung, die Lektüre, die Ernährung, der Tagesablauf und – und – und. Und jede Übertretung wurde gnadenlos gerügt, im Wiederholungsfalle bestraft, und das so lange, bis der Übertretende des Landes verwiesen wurde
oder von selber auswanderte. Kein Wunder, daß so viele Läden, Werkstätten und Wohnungen leer standen.
Kaum waren 7 Tage gen Abend gezogen, da ließ sich bereits Hortewitz im Thronsaal anmelden: Sie hätten eine Lösung. Sie? Wieso nicht –
„Genau!“ konnte sich Donna Dannewann nicht länger zurückhalten. „Was hat das mit unserem neuen Bischof zu tun?“
„Vermutlich wird er dieses Mährchen niemals zu Gesicht bekommen“, kannte der Alte seine Grenzen. „Aber jener
König, der mußte sich schon was anhören! Zunächst klang’s wie ein Lob: Majestät sei wohl ein meisterhafter Schreiner. Ein Puppenschreiner. Denn er habe keine Menschen als Untertanen, sondern lauter
Marionetten, möglichst alle nach dem gleichen Leisten geschlagen. Aber ein mächtiger König sei er leider nicht. Denn jede Marionette könne ihn dirigieren, sobald sie eigenes Leben zeige. Und, Papa,
ergriff nun Annemut das Wort, souverän sei nur ein König, der bedingungslos liebe. Deshalb schlage sie vor, –“
Allein – dem Alten war die Zuhörerschaft mal wieder abhanden gekommen.
© Stiftung Stückwerken, *19.9.2024, freigegeben am 28.9.2024
Qouz-Note: 4
***
- MamM Titelverzeichnis
- MamM 0a bis 20
- MamM 301 bis 320
- MamM 321 bis 340
- MamM 341 bis 360
- MamM 361 bis 380
- MamM 401 bis 420
- MamM 441 bis 460
- MamM 481 bis 500
- MamM 601 bis 620
- MamM 621 bis 640
- MamM 641 bis 660
- MamM 681 bis 700
- MamM 801 bis 820
- MamM 821 bis 840
- MamM 841 bis 860
- MamM 861 bis 880
- MamM 881 bis 900
- MamM 1.001 bis 1.020
- MamM 1.021 bis 1.040
- MamM 1.041 bis 1.060
- MamM 1.061 bis 1.080
- MamM 1.081 bis 1.100
- MamM 1.101 bis 1.120
- MamM 1.121 bis 1.140
- MamM 1.141 bis 1.160
- MamM 1.161 bis 1.180
- MamM 1.181 bis 1.200
- MamM 1.201 bis 1.220
- MamM 1.221 bis 1.240
Jüngstes Update:
21.7.2025