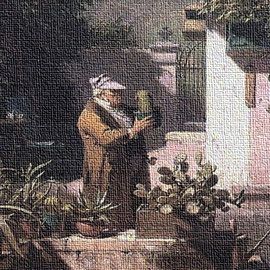MamM – Mährchen an meine Mutter Nr 1.201 bis 1.220
Überblick MamM 1.201 bis 1.220
1.201 Nachtmeister Stropp und – Meisje (*30.6.2023)
1.202 Nachtmeister Stropp und – Greuliches (*6.-7.7.2023)
1.203 Nachtmeister Stropp und die Habgier (*11.7.2023)
1.204 Nachtmeister Stropp und seine Tagleiden (*17.-18.8.2023)
1.205 Glück auf! (*25.8.2023)
1.206 Nachtmeister Stropp und das Katzenfrühstück (*22.9.2023)
1.207 Nachtmeister Stropp als Kaminkehrer (*29.9.2023)
1.208 Erstens kommt es anders (*3.11.2023)
1.209 Ärmelig, aber nicht ärmlich (*9.+11.11.2023)
1.210 AEG – AM ENDE G– (*17.11.2023)
1.211 Besessen, Haben, Sein (*23.+25.11.2023)
1.212 Wie aber wandelt der Tod? (*6.1.2024)
1.213 Der Zaubergriffel (*11.1.2024)
1.214 Kleemenz (*18.-19.1.2024)
1.215 Nach diesen schönen Tagen (*25.1.2024)
1.216 Nachtmeister Stropp und das Unrecht im Amt (*2.-3.2.2024)
1.217 Haltbare Brücken (*9.2.2024)
1.218 Tierhaltung – anders (*16.1.2024)
1.219 Zauberhafte Demenz (*22.2.2024)
1.220 Lauter Wettstreit (*29.2.-1.3.2024)
________________________________________________
MamM 1.201 Nachtmeister Stropp und – Meisje
Ja, ja, das war schon eine sonderbare Wandergesellschaft, die da im späten Frühjahr im Nordwesten von Leidentheil herumirrte! Bär Bruhno, Waschbär Wastel als Reittier und irgendwie das Igelpaar Struppe und Stropp. Weshalb ich’s nicht genauer weiß? Tscha, einzeln hab’ ich den einen und anderen schon gesehen,
aber zusammen nie. Da wußten sie sich immer so gut zu verbergen, daß sie für mich sozusagen unsichtbar waren. Und das geht wohl allen Menschen so, anscheinend selbst dem
Schlendertünnes.
Es war also Abend geworden, unsere 4 Wandersleute hatten auch endlich den Reimhügel (manche nennen ihn
auch Schwinge) erklommen, aber wo lag jetzt Rasenheim? Aus dieser Perspektive hatten sie
das Städtchen noch nie gesehen; und so kam ihnen auch nichts bekannt vor. Eine Wanderkarte und ein Kompaß wären da schon sehr hilfreich gewesen; aber – hast du schon mal eine
Wanderkarte für Igel gesehen? Wenn da alle Wege und Abzweigungen eingezeichnet wären, die es für Igel gibt, was wär’ das für ein großer
Maßstab! Das könnte gar nicht auf einen einzigen handlichen Papierbogen gedruckt werden, sondern dazu wär’ ein ganzes Kartenwerk erforderlich. Jedoch – wer wollte das alles
schleppen? Und Wegweiser? Hast du schon mal einen Wegweiser für Tiere
gesehen? Und wenn ja, auch für Igel? Siehste, an die wird gar nicht
gedacht. Da hatten’s die Bremer Stadtmusikanten wohl besser, aber selbst die sind angeblich nie bis Bremen gekommen. Und Bremen ist viele Male
größer denn Rasenheim!
Doch – wenn Du denkst, es geh’ nicht mehr, kommt geschwind ein Wandersmann daher! So auch hier! Und 3mal darfst du raten wer! Na, ahnst du’s
schon? Der Schlendertünnes! Nun aber schnell in Deckung! Und ahnungslos ging der
Schlendertünnes vorüber, und – tapp. tapp, tapp, ein Maskierter, ein Beamter auf Urlaub, ein Anwärter und eine herzensgute Eheliebste hinterdrein.
Stell dir das bitte nicht so einfach vor! Es ging bald zur Oede bergab, wobei der Schlendertünnes zwar nicht wesentlich
schneller wurde, aber – Tscha, was machen Igel, wenn ihnen Gefahr droht? Richtig! Sie rollen sich zu einer Kugel zusammen,
und den Rest kannste dir sicher denken. Und Gefahr drohte! Eine Kutsche kam des Weges, und nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn sich Igelin und Igel nach alter Sitte verhalten
hätten! Wie viele Igel bezahlen’s Tag für Tag mit ihrem teuren Leben! Jedoch – Struppe und Stropp sind nicht viele, sondern unsere Struppe und unser Stropp; und die gibt’s nur
einmal. Also nicht zusammengerollt, sondern flink ins Feld geflitzt und abgewartet, bis die Gefahr vorüber ist.
Unsere Freundin und Freunde kamen also heil hinunter in den Weiler, und glaub’ bloß nicht, daß hier irgend jemand ihren Gruß erwidert hätte! Die Ziege gaffte sie
nur an und kaute ruhig weiter, und der Pfau würdigte sie keines Blickes; dem Schlendertünnes ging’s mit dem Bauernvolk nicht besser: Als wäre er Luft oder das Grüßen hier noch
unbekannt.
Doch Oede ist noch nicht Rasenheim: Es ging noch weiter hinab, bis die 5 endlich zur Kitharabrücke kamen. Und hier hielt der Schlendertünnes plötzlich inne, denn – er gewahrte, daß er hier nicht alleine war. Zu seinen Füßen regte sich – ein
junges Meisenkind. Und zwar nicht nach Art der Alt-Meisen, die flink fortfliegen, wenn ein Wandersmann des Weges kommt, sondern nach Art der Blindschleichen; die stellen sich nämlich
tot, wenn Gefahr im Anzug ist. Der Schlendertünnes wäre beinahe auf das arme Vogelkind getreten. Immerhin scheuchte er es jetzt nicht nach Tölpelart von der Brücke, denn er wußte
nicht, ob das Kind fliegen konnte; aber wie ein echter Tierfreund handelte er auch nicht. Er sprach zwar ein paar mahnende Worte und warnte auch vor den Kutschen, die hier des Weges
kommen könnten; aber das war’s auch schon mit seiner Anteilnahme. Kein genauer Augenschein, ob etwa ein Flügel gebrochen sei oder wichtige Federn fehlten, auch kein Angebot von Kost
und Logis; nein, wie Priester und Levit in jenem Gleichnis befahl er das arme Kind dem Schutz des Schöpfers an und ging seelenruhig weiter.
Na, unsere 4 Tiere, die alles aus einer Deckung heraus beobachtet hatten, waren schwer enttäuscht. Allein – so sind nun mal die Menschen! Die Tiere sind
anders! Kaum war der Schlendertünnes außer Hörweite, eilten unsere Freundin und Freunde zu dem armen Kind, um ihm zu helfen und vor allem: um es zu beschützen. Bruhno mußte die Straße
vom rechten Ufer der Kithara scharf im Auge behalten, Wastel die Straße vom linken Ufer, und Igelin und Igel hatten sich durch geschicktes Fragen ein Bild von der Lage zu machen.
Dabei kam heraus, daß das Kind auf den Namen Meisje höre und – aus dem Nest gelockt worden war. Es sei ein lustiger, brauner
Geselle an den Nestrand gekommen, als die Eltern gerade weggeflogen waren. Ob jemand mal reiten wolle, habe der Geselle gefragt. Wer von den jungen Nestbewohnern hatte schon mal was
vom Reiten gehört? Natürlich niemand. Aber um sich vor den Geschwisterchen ein bißchen hervorzutun, hatte Meisje vorgegeben, sie
kenne es und habe überhaupt keine Angst davor. Geschwind sei sie dem lustigen Gesellen auf den Rücken geklettert, und dann sei der plötzlich von Ast zu Ast gesprungen, daß der kleinen
Reiterin Hören und Sehen vergangen seien. Als sie wieder zu sich gekommen sei, habe sie sich hier bei der Brücke wiedergefunden; und der braune Geselle habe sich mit großem Gelächter
aus dem Staube gemacht.
Frau Struppe und unser Stropp sahen sich dabei groß an: Ob sie diesen lustigen Gesellen etwa auch kannten?
Allein – dann sei noch ein schlankes Tier des Weges gekommen, an dem wohl hinten eine lange Raupe festgewachsen sei; eine sehr nackige Raupe. Und als Meisje
die habe lospicken und verzehren wollen, habe sich der Fremde sehr dagegen verwehrt: Sich vollfressen solle sie schon, damit sie gemästet sei, wenn er wiederkomme, aber seinen Sch-Wanz solle sie
gefälligst in Ruhe lassen. Was mästen sei, wisse sie nicht, auch nicht, was ein Sch-Wanz sei. Überhaupt sei’s mit jenem Tier nicht ganz geheuer gewesen; und sie wolle jetzt zu
Mama und Papa und ihren Geschwisterchen. Aber wo die zu finden seien, wußte Meisje nicht.
„Dann komm mit uns in unser Ferienquartier“, schlug Frau Struppe vor. „Speis und Trank werden wir für dich gewiß auch noch finden, und das ist doch viel besser als
hier den nahen Tod vor Augen. Und vielleicht finden wir deine Angehörigen auch noch.“
Meisje willigte vertrauensvoll ein, und so nahmen am späten Abend 5 Gestalten den Garten des Schlendertünnes in Besitz.
© Stiftung Stückwerken, *30.6.2023, freigegeben am 18.11.2023
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.202 Nachtmeister Stropp und – Greuliches
Unsere Freundin und Freunde waren also endlich im Garten am Fuße des Rasenheimer Groschenberges angekommen: Frau
Struppe, ihr Eheliebste, Nachtmeister Stropp, sowie dessen Assistentanwärter Bruhno
und Waschbär Wastel; ja, und das entführte Meisenkind Meisje.
Wastel oder unseren kleinen Bären jetzt noch auszuschicken, Meisjes Eltern und Geschwister zu suchen, hielt niemand für ratsam; denn Meisen sind keine Nachtvögel
und hätten sich zu Tode erschrecken können, wenn plötzlich ein Fremder aus der Dunkelheit am Nestrand aufgetaucht wäre. Also suchten sich unsere Freundin und Freunde ihr Quartier unter
Schirm und Schutz einer Lorbeerkirsche (angeblich; Botaniker sind da skeptisch), legten sich wie ein Schutzwall um die kleine Meise und – schliefen
bald ein.
Auch Igelin und Igel? Na, denk nur an die strapazenreiche Reise! Und daß die eigenen Bedürfnisse hinter
dem Wohl des kleinen Kindes zurückstehen mußten.
Am nächsten Tag machten die 5 was? Richtig! Erst einmal faulenzten sie; denn 1. waren ja Ferien,
und 2. wollten zumindest Bär und Waschbär von keinem Menschen gesehen werden. Allein – als die Sonne immer höher stieg, drängte Frau Struppe darauf, daß nun endlich jemand nach Meisjes
Zuhause forschen möge. Gewiß täten sich die Eltern bereits große Sorgen machen und ihr Kind überall suchen. Aber wer könnte es hier in der Deckung finden?
„Ich könnte mich doch draußen hinstellen“, bot Meisje an, „und laut nach Mama und Papa rufen.“
„Auf daß du die Katzen auf dich aufmerksam machst?“ dachte unser Bruhno weiter.
„Hat jemand in der Nacht das Käuzchen gehört?“ fragte unser Held in die Runde.
Nein, das hatte niemand gehört.
„Anscheinend ist es verzogen“, folgerte unser Igel. „Also muß sich einer von uns auf die Pfoten machen, die Eltern von Meisje zu suchen. Aber wen nehmen wir
da? Wir beiden Igel sind im Klettern auf Bäume eine Niete; unser Bruhno tut sich da verständlicherweise auch etwas schwer;
und unser Wastel ist maskiert und könnte Meisjes Angehörige verschrecken. Mh, was machen wir da?“
„Ganz einfach!“ wußte das Meisenkind Rat. „Ich klettere dem lieben Wastel auf den Rücken, und dann gehen wir gemeinsam auf die Suche: Wastel könnte mich beschützen,
und ich sorge dafür, daß keine Meise vor ihm Reißaus nimmt.“
„Ja, doch, das ist ein guter Vorschlag“, lobte unser Nachtmeister. „Kind, aus dir kann noch was –“
„Papperlapapp!“ tönte es störend dazwischen und lispelnd weiter: „Den Vogel, der tsu frühe zsingt, frizßt am Abend die Kattse.“
„Paß auf, daß du nicht von der Katze gefressen wirst“, ließ Frau Struppe nichts auf jemanden kommen, den sie einmal zu ihrem Schützling erkoren hatte.
„Ph, da weizß ich mir tschon tsu helfen!“ prahlte die Fremde. „Die hat tschon mal geglaubt, tsie hätte mich und hatte doch nur meinen Tschwanz im Maul. Die
tsoll nur kommen!“
„Versündige dich nicht gegen deine Schöpfer!“ Schließlich hatte Frau Struppe ja mal am Bölcer Kirchweg gewohnt. „Und nun fort mit dir! Dich hat niemand
nach deiner Meinung –“
„Bizst mir wohl bözse, weil ich euch die Tschnecken und Regenwürmer wegfrezss’, wazs?“ folgerte die Fremde.
„Aber dazs eine tsag’ ich euch: Die hier im Garten tsind alle mir, tso wahr ich die Frau Tschlichtenbrich bin!“ Dann schlängelte sich ein kupfern
glänzende Band von dannen.
„Was war denn das für eine eingebildete Person?“ fragte unser Bruhno.
„Erinnerst du dich nicht mehr an unseren Fall Schlichensiepen?“ fragte unser Stropp zurück, bevor er sich selber
genauer erinnerte: „Ach, stimmt ja, das war der letzte Fall, bevor wir dich kennengelernt haben. Wie die Zeit vergeht! Freilich – Frau Schlichensiepen war nicht so eine eingebildete
Blindschleiche wie die hier eben.“
„Und wieso heißt sie Blindschleiche?“ hakte unser Bär nach. „Kann sie denn nicht sehen?“
„Doch“, antwortete nun Frau Struppe, „aber die Menschen, die sie so genannt haben, hatten bestimmt Tomaten auf den Augen. Und nun fort mit euch beiden! Wenn
ich da an deine Mama denke, ach, dann tut’s mir fast –“
Aber den Rest hörten die beiden nicht mehr.
Stunde um Stunde verging nun, aber Meisje und Wastel kamen und kamen nicht wieder. Besorgt hielt vor allem Frau Struppe nach ihnen Ausschau. Und dann, dann
passierte es! Was? Frau Struppe wurde Zeugin bei einem Mord!
„Stropp“, flüsterte sie aufgeregt, „ist das nicht, ist das –?“
Und nun sahen es auch unser kleiner Bär und sein Lehrmeister: Eine graue Katze trug etwas in ihrem Maul auf den Weg, legte es dort ab und begann es seelenruhig Stück für
Stück zu verzehren. Eine Maus? Nein, der hätte sie ja noch das Todesspiel aufgezwungen. Nein, etwas kupfern
Glänzendes!
„Hochmut kommt vor dem Fall!“ kommentierte es Frau Struppe. „Und wer nicht hören will, muß –“
„Und ich hatte sie noch warnen wollen“, warf sich unser Held zerknirscht vor, „daß ihr Trick mit dem Schwanz nur einmal funktioniert.“
„Mord bleibt aber Mord!“ besann sich Bruhno seines Lernstoffes und schritt in Amtsmiene hinaus und unerschrocken zum Tatort: „Im Namen des Gesetzes: Ich verhafte dich
wegen Mordes an –“
„Wap willpt denn du, ham, ham“, ließ sich die Katze nicht stören, „du kleiner, mampf, mampf, Hopenpeiper?“
„Dich auf der Stelle verhaften!“ ließ sich unser kleiner Bär nicht einschüchtern. „Auf frischer Tat –!“
„Seit wann werden hierzulande Jägerinnen verhaftet!“ empörte sich die Katze. „Frau Greuler ist kein Wilddieb, merk dir das mal,
du junger Spund! Alles ordentlich von Baron Spatenmax gepachtet und gestattet. Dagegen die hier war ihm schon seil langem ein Dorn im Auge, weil sie nämlich als arge Wilderin unter
seinem Regenwürmervieh gewütet hat. Und auf Wildfrevel steht nun mal die Todesstrafe; und das seit alters. Aber so was wißt ihr Grünschnäbel ja nicht mehr und wollt es auch
nicht wissen.“
Und da inzwischen auch Igelin und Igel herbeigeeilt waren, schimpfte und drohte Frau Greuler nun: „Was wollt ihr eigentlich hier in meiner Jagdpacht? Statt mir Vorhaltungen zu machen, solltet ihr mir eigentlich dankbar sein, daß ich euch von einem Futterfeind erlöst habe. Da sind die
Schnecken zuvorkommender. Also fort mit euch, ihr undankbares Pack! Sonst lass’ ich euch meine Messer und Säbel spüren!“
Oh weh! Zwar war oben im Haus der Schlendertünnes ans Fenster getreten, aber als Hilfe wäre er gewiß zu spät gekommen.
Dennoch kam Hilfe und zur rechten Zeit!
„Scher erst einmal du dich von dannen!“ wurde die Katze plötzlich angeherrscht. „Im Namen meines Nachtmeisters verbann’ ich dich hiermit aus diesem Garten bis auf
Widerruf!“
„Ein Räuber!“ entsetzte sich Frau Greuler und hetzte in großen Sprüngen zum nächsten Zaun, hinauf, hinunter und von dannen.
Wer dieser Räuber war? Wenn du’s noch nicht ahnst, verrate ich’s dir beim nächsten Mal. ADieu!
© Stiftung Stückwerken, *6.-7.7.2023,
freigegeben am 26.11.2023
Qouz-Note: 3+
***
MamM 1.203 Nachtmeister Stropp und die Habgier
Du hast es erraten, wer die Katze Greuler aus jenem Garten verbannt hat? Ja, ja, so sind sie, die auf der schiefen Bahn wandeln: Vor
der Obrigkeit haben sie oft keine Angst, aber gegenüber Konkurrenten sind sie auf der Hut. Sogar gegenüber scheinbaren; denn seitdem Waschbär Wastel für unseren Nachtmeister arbeitete, konnte er eigentlich nicht mehr dem Diebsgesindel zugerechnet werden. Er schien sich also noch rechtzeitig besonnen zu
haben, für was er nicht und für was er am Ende seiner Erdenreise einmal werde dankbar sein können.
Zum Beispiel für seinen letzten Auftrag. Zusammen mit Meisje war es ihm bald gelungen, deren Eltern ausfindig zu machen.
Die waren natürlich erfreut, ihr Kind lebendig wiederzusehen, aber – auch unter Meisen hat die Liebe Grenzen. Und wenn du dir mal verlassene Nisthöhlen anschaust, wirst du bemerken, daß
kein Kind ein eigenes Kinderzimmer hat. Nun, ich will da nicht richten, sondern nur festhalten: Die Meiseneltern zogen durch vorsichtiges Fragen ihre Erkundigungen ein; und nachdem
die Antworten zufriedenstellend ausgefallen waren, stellten Mutter und Vater es ihrer Tochter frei, wo sie künftig wohnen wolle; bei Meisen gilt wohl eine sehr niedrige
Volljährigkeitsgrenze.
Ach so, was die Eltern gefragt haben? Na, ob Meisje im Garten am Fuße des Groschenberges genug zu essen bekomme? Ob sie genügend Schutz finde? Und ob in der neuen Wohngemeinschaft alles sittlich einwandfrei zugehe? Gut, von
unserem berühmten Nachtmeister hatten sie noch nicht allzuviel gehört, und recht vertrauenswürdig sah der Waschbär auch nicht aus. Aber Wastel wußte den Argwohn zu zerstreuen, als er den
Eltern die Möglichkeit eröffnete, Meisje täglich zu besuchen und ihr das Fliegen beizubringen; falls sich das Mädchen für unsere Freundin und Freunde entscheiden wollte! Und es
wollte! Wastel sei ein guter Kletterer und täte bestimmt bei der Einrichtung einer eigenen Wohnung helfen.
Aber die dürfe nicht auf dem Boden gebaut werden, ermahnten die Eltern; und selbst frei auf einer Eiche sei’s nicht unbedingt sicher vor Wiesel, Marder und
Sperber. Und sogar bei Nistkästen dürfe der Eingang nicht so groß sein, daß sie von den ungezogenen Kohlmeisen beansprucht werden könnten.
Nistkästen? So was gab’s am Fuße des Groschenberges nicht. So tierfreundlich war der Schlendertünnes
anscheinend nicht. Oder war er gar zu dumm? Denn vor allem die Blaumeisen behaupten ja von sich, sie seien für jeden Garten ein
wahrer Segen.
Jedenfalls – Meisje kehrte mit unserm Wastel in jenen Garten zurück, und das, wie wir beim letzten Mal gehört oder gelesen haben, gerade noch rechtzeitig. Ja, da
siehste mal wieder, wie wichtig es sogar für einen Nachtmeister ist, gute Freunde zu haben!
Allein – in einem Garten sind nicht alle Tiere gut Freund miteinander. Warum? Warum-Fragen lassen sich
von uns Menschen nie hinreichend beantworten, aber es ist wohl unbestritten, daß wir zu Streit und Zwist einen großen Beitrag leisten. Beim Schlendertünnes klang ja eben schon an, daß er
gar keine Nistkästen aufgehängt hatte, und von Futterhäuschen für den Winter weiß ich auch nichts zu berichten. Aber das ist alles nur die Spitze des
Eisberges, täten die Polartiere sagen. Und nun halt dich gut fest!
Wenn du unser Igelpaar schon länger kennst, weißt du sicherlich, daß die beiden ihre Nahrung von Fleisch auf Gemüse, Obst und sonstige Früchte umgestellt hatten.
Und eigentlich müßte es davon in einem Garten ja genug geben, wenn – das Wörtchen wenn nicht wär’. Und der Mensch! Hier: der
Schlendertünnes!
Stell dir vor: Gleich in den ersten Tagen fing der Schlendertünnes an, die Sträucher abzuernten: Himbeeren, schwarze Johannisbeeren,
weiße Johannisbeeren, rote Johannisbeeren und Stachelbeeren. Und nicht nur oben, wo ein Igel gar nicht drankommen kann, sondern auch ganz unten.
„Das ist keine Dummheit mehr“, urteilte unser Waschbär, als er von seinem sicheren Strauchversteck aus diesen Raub beobachtete, „das ist schon Habgier!“
„Ach, er will eben nichts umkommen lassen“, versuchte unser Stropp zu beschwichtigen, als er beim Abendfrühstück davon erfuhr.
„Aber gleich alles ratzekahl abräumen“, ließ sich unser Wastel nicht umstimmen, „das spricht nicht von einem guten Herzen.“
„Es wird nichts so heiß gegessen, wie’s gekocht wurde“, versuchte eigentlich auch Frau Struppe zu besänftigen, konnte sich aber nicht
die Bemerkung verkneifen: „Bestimmt ein Einzelkind; unsere Kinder haben jedenfalls das Teilen gelernt!“
Immerhin wurden unser Held und unser Bär Bruhno damit beauftragt, die Tatorte auf ihren Nachtgängen genauer zu inspizieren. Und
dabei fand sich’s, daß der Schlendertünnes manche Beere übersehen hatte und daß auch manche Beere anscheinend achtlos neben den Ernteeimer auf den Boden gefallen war. Und mit diesen
Früchten schlugen sich jetzt Igel und Bär nicht einfach die Bäuche voll, sondern sammelten jene eifrig ein und brachten sie in ihr Strauchversteck, um sie mit Frau Struppe, Wastel und Meisje zu
teilen. Was täte unser Stropp daraus folgern? Richtig! Die beiden Sammler waren anscheinend nicht als Einzelkind
aufgewachsen.
Aber beim gemeinsamen morgendlichen Spätstück wurde es doch noch einmal zur Sprache gebracht, ob dem menschlichen Beerenraub nicht irgendwie abzuhelfen wäre. Bei
den Stachel- und Johannisbeeren war nichts mehr zu machen, aber bei den Himbeeren gab es noch nachreifende Früchte. Jedoch – einen Bären kannst du nicht auf die Ruten klettern lassen, ja,
noch nicht einmal einen Waschbären, die täten viel zuviel abbrechen. Also? Also war wieder der berühmte Scharfsinn unseres Helden
gefragt; obwohl – obwohl dieser bekanntlich tagsüber ja sein Mittagsschläfchen hielt, während die Menschen die Gärten plünderten.
„Ihr müßt mal sehen“, riet er seinen Tagfreunden verschmitzt, „daß ihr den Henkel des Sammeleimers irgendwie etwas einfettet. Da könnt ihr euch ruhig von den
Schnecken noch einiges abschauen und bei ihnen in die Lehre gehen. Na, und dann müßt ihr den Schlendertünnes nur noch derart erschrecken, daß er den gefüllten Eimer fallen läßt und dieser
umkippt.“
Ein guter Rat? Na, nicht für den Schlendertünnes; denn wenn dir einmal die Beeren aus dem Eimer gefallen
sind, findest du nicht mehr alle wieder. Manche sind zum Beispiel in ein Mauseloch gekullert und – Ah, wenn eine Wühlmaus erst mal auf den Himbeergeschmack gekommen ist, frißt sie
weniger an den Kartoffeln oder den Wurzeln von Sträuchern und Blumen. Sollte etwa unser Stropp auch das bedacht haben? Zuzutrauen wäre es ihm. Jedenfalls blieben für unsere Freundin und Freunde noch etliche Himbeeren für die Nachlese übrig.
© Stiftung Stückwerken, *11.7.2023,
freigegeben am 27.11.2023
Qouz-Note: 4+
***
MamM 1.204 Nachtmeister Stropp und seine Tagleiden
Ach ja, lieber Nachtmeister, bist du ein glückliches Tier?
„Tscha“, täte unser Stropp schillernd seufzen, „es kann der Frömmste nicht im Frieden leben,
wenn’s seinem Nachbarn nicht gefällt, der noch nicht einmal boshaft zu sein braucht. Und ich bin noch nicht einmal der
Frömmste.“
Kannste das verstehen? Verstehen, so habe es mal eine weise Frau
oder ein weiser Mann gesagt oder gewandelt, bedeute: mit den Augen des andern zu sehen. Und dazu gehört auch: mit den Ohren des andern zu
hören. Und nun stell dir mal vor, du hast eine anstrengende Nachtschicht hinter dir, legst dich aufs Ohr, schlummerst auch erschöpft ein, und – plötzlich steht dein Ohr wieder auf und
meldet dir: Flugstunden.
Nicht fröhliche wie bei den Mauerseglern. Nicht aus fernen Höhen wie bei den Schwalben, sondern – nervige.
„Meisje, nicht so! Du bist doch keine Ente! Fliegen sollst du; nicht schwimmen!“
„Nein, Meisje, was bist du dämlich! Zum Küken fehlt dir nur noch das Gackern! Gut, Bruhno, dann eben das Piepsen!
Aber was verstehst du schon vom Fliegen!“
Und dazwischen immer das verzagte Jammern unserer kleinen Meise, die so gerne sausen möchte wie oben in den Lüften die Schwalben und Mauersegler, es aber einfach nicht
schafft.
Und wenn unsere Meisje noch resignierend klagt: „Ich bin wohl zu dumm dazu“, könntest du dann noch ruhig schlafen?
Unser Stropp jedenfalls nicht. Dem geht so was ans Herz. Und schon muß er sich von seinem Taglager erheben und trösten: „Meisje, du bist eben keine Schwalbe
und auch kein Mauersegler; dafür kannst du viel besser klettern als sie. Und was soll etwa ich sagen? Ich kann überhaupt
nicht fliegen; und auf Bäume und Sträucher klettern kann ich auch nicht. Und dennoch bin ich die meiste Zeit vergnügt.“
„Und wie machste das?“ täte Meisje fragen und tut es auch.
„Weil er mich hat“, zieht nun Frau Struppe das Gespräch an sich, „und ich rück’ ihm den Kopf schon zurecht, daß er nicht mehr auf das
schaut, was er nicht hat oder nicht kann, sondern auf das, was er hat und was er kann. So einfach ist das!“
„Kannste das bei mir auch so machen“, klang’s mehr bittend als fragend.
„Eh“, schwankte die Igelin zwischen dem, was ihr gutes Herz empfahl, und dem Selbsterhaltungstrieb, ehe ihre Führungsstärke siegte, „versuch’s doch erst mal mit Bruhno,
denn der ist eigentlich ein Tagtier und hat bereits tüchtig bei uns gelernt.“
„Ist aber tagsüber immer so müde“, hielt das Meisenkind dagegen, „weil er mit auf die Nachtschicht muß.“
„Dann halt dich an Wastel“, wollte Frau Struppe den eingeschlagenen Weg fortsetzen. „Schließlich übt er mit dir ja das Klettern.“
„Und ist tagsüber auch so müde“, hatte Meisje wieder einen Einwand. Ist es nicht erstaunlich, wie schnell dieses junge Kind altklug geworden ist?
„Dann wende dich eben an die Tagvögel“, sprach die Igelin ein Machtwort. „Ich und mein Mann müssen jedenfalls jetzt schlafen.“
Und das taten sie auch – vorerst. Indessen schaute sich unsere Meisje eifrig um und gewahrte dabei Vögel, die irgendwie wohl zusammengehören mußten, obwohl sie
nicht das gleiche Federkleid trugen. Die einen bevorzugten eine grün-bräunliche Tarnfarbe, die andern ein feierliches Schwarz, das häufig unter Wesen anzutreffen ist, die ihr Brot und noch
mehr damit erwerben, daß sie das Recht drehen, wenden und bearbeiten oder zu Grabe tragen. Aber was wußte unsere Meise schon von solchen Berufen! Auffallend war, daß die Getarnten
auch wesentlich stiller waren, während die Schwarzröcke sogar der Sangeskunst huldigten, nicht ohne Eindruck auf die Tarnröcke. Immerhin waren diese Vögel größer als Meisjes Eltern;
und zumindest die Tarnröcke erschienen unserem Meisenkind auch als geduldiger. Allein – irgendwie mußte es bereits mitbekommen haben, daß heutzutage kaum noch jemand etwas ohne Bezahlung
tut, – sei’s in Geld, sei’s in Ehre. Aber was konnte unsere Meisje anbieten? Und was täten jene Vögel pro Flugstunde
nehmen?
Da fiel der Blick unserer Kleinen auf einen Strauch, der viel höher war als alle anderen im Garten. Ja, sogar höher als der Feuerdorn; denn den hatte der
Schlendertünnes jedes Jahr zu stutzen. Und an jenem hohen Strauch hingen massenweise Früchte in einem Schwarz, das dem der Schwarzröcke zwar ähnelte, aber leicht ins Rötliche
schimmerte. Anscheinend hatte den der Schlendertünnes bisher übersehen. Und jene Vögel auch. Wenn Meisje nun diesen Strauch den Tarnröcken zumindest empfahl, dann mußte die
Anzahl der Beeren gewiß für etliche Flugstunden schicken. Gedacht, getan!
Jedoch – das Verhalten der Erwachsenen richtet sich leider nicht nach der Einfalt der Kinder! Die Tarnröcke sagten zwar wenigstens danke für die Empfehlung, aber
wieso hätten sie dafür noch eine Gegenleistung erbringen? Sie wüßten doch jetzt, wo der Strauch stehe. Zwar dürfe sich das
Meisenkind noch einen kleinen Mundvorrat abpflücken, aber sobald sie eine Feder am Fuße des Strauches abgelegt hätten, sei dieser damit zu ihrem Eigentum erklärt, und jegliche Nutzung durch 3.
müsse als Hausfriedensbruch, ja, sogar als Diebstahl oder Raub angesehen und beim Friedensrichter angezeigt und in dessen Auftrag polizeilich verfolgt und gerichtlich geahndet werden.
Ja, so sind die Tiere; und wenn unsere Meisje ein bißchen älter geworden ist, wird sie hinter all dieser willkürlichen Gerechtigkeit bestimmt die Schwarzröcke
vermuten.
Aber die Menschen sind nicht besser! Denn kaum hatten jene Vögel ihre Eigentumsrechte durch eine Feder angezeigt und das Ernten begonnen, kam der Schlendertünnes in den Garten, und zwar mit einem leeren Eimer, und scherte sich um die Rechtstitel der Vögel nicht im geringsten. Ei, was gab es da für ein
Gezeter! Wer konnte dabei noch schlafen!
Auch kein Igel. Und weil der Friedensrichter so schnell nicht greifbar war, wurde unser Stropp von jenen Vögeln aufgesucht und genötigt, ihnen Recht zu
verschaffen.
Das könne noch nicht einmal der liebe Gott, dämpfte unser Held die Erwartungen, dachte einen Augenblick nach und traf dann folgende
weise Entscheidung: Jedem Bewohner des Gartens, einschließlich der Feriengäste, stehe ein Anrecht auf alles zu, was dort wachse. Bettler und Asylsuchende dürften jedoch nicht abgewiesen
werden. Da aber dieses Gemeinrecht schwer gegen den Mißbrauch durch Menschen durchzusetzen sei, empfehle er, in solchen Fällen den Eimertrick, der bereits bei den Himbeeren nicht ohne
Wirkung gewesen sei. Ansonsten sei es doch gut eingerichtet, daß jener Strauch besonders ganz oben sehr viele Früchte trage, an die kein Mensch herankomme. Und als Rechtskosten lege
er jenen Vögeln auf, Meisje jeden Tag eine Flugstunde zu geben, bis das Kind ausgelernt habe.
Und wenn sie nicht sterben, werden sie noch so manches erleben!
© Stiftung Stückwerken, *17.-18.8.2023,
freigegeben am 28.11.2023
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.205 Glück auf!
Lebt denn der Alte von der Halbinsel noch? Wenn er noch nicht gestorben oder wenn er vom Tode zum
Leben hindurchgedrungen ist, dann lebt er noch.
So hat ihn noch neulich Donna Bodenseh gefragt: „Was ist Glück?“
„Hm“, schmunzelte der Alte von der Halbinsel, „dazu fällt mir eine Grabinschrift ein:
Er hat zeitlebens Glück gehabt,
doch glücklich ist er nie gewesen.
Meines Wissens ist sie dann doch nicht zu Stein geworden, aber als es ihr Verfasser als eigenen Nachruf niedergeschrieben hat, wird er’s wohl gerade so gesehen haben. Und das zeigt 2erlei:
1. – Glück ist nicht gleich Glück; und 2. – verändern sich mit der Zeit unsere –“
„Gibt es also kein absolutes Glück?“ wollte die Besucherin wissen.
„Ich weiß es nicht“, mußte der Alte enttäuschen, „ich kann da nur mit Glauben aufwarten. In Gott ist Glück, so glaube ich’s,
und ohne Gott gibt’s kein Glück, weil es nicht von Bestand –“
„Das ist aber sehr abstrakt“, urteilte Donna Bodenseh, „wer kann damit etwas anfangen! Die Glücksforscher sind da viel hilfreicher und –“
„– lassen sich ihre Ratschläge teuer bezahlen“, ergänzte der Alte abschwächend. „Das ist eben der große Unterschied: Glück durch Menschen ist in der Regel nicht
kostenlos, Stückwerk und noch nicht einmal des Geldes wert. Nur wenn’s nichts kostet, kann es Menschen wenigstens glücklicher machen; eine Zeitlang. Aber was ich mit
Gott anfange, das wird zu einem Glück führen, das bleibt“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger Königssohn, der hieß –, der hieß: Fortunino. Und weil er seinen Namen so deutete, als habe dieser
etwas mit Glück zu tun, nahm er sich vor, das Glück zu suchen.
Tscha, wie sieht das Leben für einen jugendliche Prinzen aus? Die Nacht bis zum frühen Morgen im Ballsaal,
dann bis zum Nachmittag geschlafen, – was bleibt dir da noch anderes übrig, als wieder ab in den Ballsaal? Denn zu einem Tagwerk ist’s
zu spät. Ist das noch Leben? Oder nur ein Dasein?
Dasein – ein treffliches Wort in unserer Muttersprache: Du bist niemals hier, erst recht nicht bei dir selber, sondern immer nur da.
Nun ja, was ist an einem Ballsaal so schlimm? Er dient doch dem Vergnügen; oder? Na ja, wenn ein Heranwachsender möglichst früh an die Welt des Balls herangeführt wird, hat er zunächst wohl eines nicht: Vergnügen an den
Angehörigen des anderen Geschlechts. Erst recht nicht, wenn sie Hochnäsigkeit ausstrahlen und du dich in ihrer Nähe unsicher fühlst.
Aber da gebe es doch noch die Spieltische, das Glücksspiel, da sei das Glück bereits im Namen anzutreffen; oder? Auf dem Etikett wohl; aber darunter liegt viel Unglück, und nach diesem müßten diese Spiele eigentlich heißen.
Nun hatte Fortunino aber einen Vater, und dem war es ganz und gar nicht gleichgültig, welche Entwicklung sein Sohn nahm.
„Geh ruhig auch zu den Spieltischen“, sprach der König zu seinem Sohn, „wenn du mit deiner Zeit nichts Besseres anzufangen weißt. Dort kannst du zumindest viel über
die Menschen lernen: ob sie sich an Regeln halten; was ihnen wertvoll ist; ob sie auch andern etwas gönnen. Und das erfährst du über dich selber auch. Allein – eines hab’
ich mir damals von Anfang an angewöhnt: Niemals um Geld oder ähnliches zu spielen. Denn es täte mich nicht freuen, wenn ich verlöre, was ich mit eigener Mühe erworben oder von unseren
Vorfahren durch deren Mühe ererbt habe. Aber es täte mich auch nicht freuen, wenn ich’s andern abgewönne und dadurch Gräben entstehen.“
Und weil der Vater auch entsprechend lebte, hatten seine Worte Gewicht, und Fortunino ließ seine Geldkatze künftig erst einmal zu Hause, wenn er zu einem Ball fuhr und zu
Spieltischen. Und er machte die Augen auf und gewahrte, daß der Vater nicht übertrieben hatte.
Allein – irgendwann veränderte sich auch des Prinzen Blick auf die Angehörigen des schönen Geschlechts. Nee, nee, dieses Runde war viel lieblicher anzuschauen denn
das Kantige der männlichen Jugend. Und wenn SIE lächelte, – wie schön SIE war! Erst recht, wenn SIE den Fortunino anlächelte! Und er denken mußte, es gelte ihm allein und
ausschließlich und für immer. Das war ein Glück, das sich an keinem Spieltisch gewinnen ließ. Doch – eines befremdete ihn: Daß er dieses Glücksgefühl nicht nur bei einem einzigen
Mädchen empfand, sondern auch die Blicke anderer ihn entzünden konnten; und das zuweilen am gleichen Abend. Und weil er seinem Vater vertraute, teilte er mit ihm seine
Eindrücke.
„Ha“, lachte der Vater, „du sprichst vom Verlieben. Ja, das geht schnell, wenn du nicht aufpaßt. Solange du dagegen nicht besser gewappnet bist, blick den
Mädchen einfach nicht mehr in die Augen, sondern spitz die –“
„Aber gilt nicht die Liebe als das höchste Glück?“ erwartete der Prinz Bestätigung.
„Verlieben ist nicht gleich lieben“, antwortete der Vater, „und –“
„Was ist denn bei der Liebe anders?“ fragte Fortunino.
„Liebe paart sich nie mit Habgier“, teilte der König keine weit verbreitete Ansicht, „denn sie will nicht besitzen, sondern geben. Sie will aber auch nicht
vergöttern oder sich vergöttern lassen, sondern dem Veredeln dienen. Und – die menschliche Liebe hat Grenzen; deshalb ist sie nie das höchste Glück.“
„Was ist aber dann das höchste Glück?“ wollte der Prinz wissen.
Das müsse er, Fortunino, selber herausfinden, antwortete der Vater, und deshalb möge er, der Prinz, mit Eintritt seiner Volljährigkeit auf Reisen gehen.
Gehen! Nicht fahren oder reiten.
Und der Prinz wanderte und wanderte, sah vieles, vergaß auch wieder vieles, aber sammelte auch. Und er fand Glück, wo er’s vorher nie vermutet hatte. Einmal
betrat er die Stube armer Bauersleute, als diese gerade das Abendbrot bereitet hatten. So kärglich es auch war, er wurde einfach dazugeladen. Und als das Haupt der Familie Jesum als
Gast und Segnenden ansprach, da war’s dem Prinzen, als trete jener wirklich an den Tisch und segne. Und seltsam, je häufiger sich der Prinz Zeit nahm, bei sich selber einzukehren und
Gegenwart zu feiern, desto stärker war sein Glücksgefühl. Dennoch – eines wollte er von seinem Vater noch wissen, als er zurückkehrte: Ob’s noch mehr Glück zu entdecken gebe?
„Tja“, antwortet der Vater, „wenn du singen kannst: Bist du bei mir, so geh’ ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruh’, dann wandert dein Blick zu einem Glück hinauf, das bleibt.“ –
© Stiftung Stückwerken, *25.8.2023,
freigegeben am 28.11.2023
Qouz-Note: 2-
***
MamM 1.206 Nachtmeister Stropp und das Katzenfrühstück
Ja, ja, das war schon ein Sommer: warm, sonnig und naß! Auch am Groschenberg.
Nun ja, wenn wir Menschen verreisen, dann wünschen wir uns an unserem Urlaubsort in der Regel immer Sonnenschein und trockenes Wetter, solange unser Trinkwasser von
woanders herkommt, wo es tüchtig regnen möge. Nur gut, daß wir Menschen noch nicht das Wetter machen können, auch wenn wir das Klima durch unsere Sünden schädigen!
Und die Tiere? Nun ja, unser Nachtmeister Stropp ist ja des Nachts
unterwegs, da sieht er vieles nicht. Aber auch ihm ist schon manches aufgefallen: ein vertrockneter Strauch, fehlende Pflaumen für Saft und Konfitüre und – viel Müll. Sogar in jenem
Garten am Fuße des Groschenberges.
Doch wer unseren Helden gefragt hätte, ob dieser sich Sorgen um die Zukunft mache, hätte als Antwort erhalten: „Nö, denn wer so etwas Geniales geschaffen hat, der weiß es
auch zu reparieren. Und wer bereits die Zukunft kennt, den kann kein Gegner besiegen.“
Nun ja, die Zeit am Bölcer Kirchweg hat (wie’s die Eingeweihten bereits wissen) halt ihre Spuren hinterlassen. Und
Naturfreundschaft pflegten unsere Freundinnen und Freunde ja bereits von Kindesbeinen an. Oder hast du je gehört, Frau Struppe habe Müll in die
Landschaft geworfen? Oder Waschbär Wastel habe die Luft verpestet? Oder
unser Bär Bruhno habe jemanden totgefahren? Und unser Meisenkind Meisje hat gewiß noch nie Erde, Wasser oder Luft vergiftet. Nur wir Menschen haben – Aber ich will lieber von unseren Freundinnen und Freunden erzählen.
Also – unser Meisenkind bekam täglich seine Flugstunde bei den Schwarz- und Tarnröcken, aber mit den Mauserseglern konnte unsere Meisje dennoch nicht mithalten;
denn selbst die beste Meisterin kann nur weitergeben, was sie selber kann und hat, zumal wenn sie im Laufe der Zeit träge geworden ist und keine Fernreisen mehr unternimmt. Und eines Tages
flogen dort keine Mauersegler mehr am Himmel, so daß sich unsere kleine Meise nichts mehr von ihnen abgucken konnte.
Auch die andern fanden das schade, ganz besonders unser Nachtmeister und seine Lernkraft. Denn wenn du des Abends dein Nachtwerk unter jubelndem Jauchzen beginnen
kannst, geht’s gleich leichter von der Hand, und du hast mehr Freude im Herzen.
„Die kommen nächstes Frühjahr wieder“, wußte unser Stropp durch seine langjährige Erfahrung das Jungvolk zu trösten, „nicht nur nach hier, sondern auch nach
Dortwehr.“
Unsere Meisje war’s zufrieden; und weil es ihr in Rasenheim gefiel, hatte sie auch kein Fernweh. War’s nicht überhaupt
eine große Torheit, für nur 3 Monate solche Reisestrapazen auf sich zu nehmen?
„Nö“, meinte unser Held, als ihm diese Frage vorgelegt wurde, „vielleicht hat das alles einen großen Sinn. Ich nehm’s wie ein schönes Geschenk von diesen lieben
Vögeln; denn ich hab’ gehört, daß es dort, wo sie sich fast 9 Monate im Jahr aufhalten, viel lustiger zugeht; sogar die Menschen, die dort leben, seien viel fröhlicher. Und
extra wegen uns kommen –“
„Dann könnten tsie doch für immer hierbleiben“, zischte es plötzlich dazwischen. „Ts, ts, ts, ich tsag’ts ja immer wieder: Wer hoch fliegt, hat nicht viel im
Kopf.“
„Frau Tschlichtenbrich“, entsetzte sich Frau Struppe als erste, „seid Ihr von den Toten auferstanden? Euch hatte doch die Katze –“
„Dats war meine Coutsine“, antwortete die Blindschleiche. „Gleicher Nachname. Detshalb nennt mich betsser Vroni –“
Aha, soso, die Siegbringerin!“ entfuhr es unserm Igel; denn nicht nur wenn das Herz voll ist, kann der Mund übergehen, sondern auch wenn der Kopf voll ist. „Dann auf gute Nachbarschaft! Und wenn du mal Schutz und Hilfe brauchst, –“
„Will’s nicht hoffen“, klang’s jetzt nicht so siegesgewiß, „aber vor Frau Greuler hab’ ich schon etwas Angst. Daß ihr auch niemand Einhalt gebieten kann!“
„Gebieten, das ist eben nur was für hohe Tiere, die herrschen wollen“, rechtfertigte sich unser Nachtmeister, „aber Lenken und Erziehen wirken oft viel
nachhaltiger. Wer weiß, vielleicht fällt mir auch hier etwas ein.“
Und da er beim Lenken und Erziehen heimlich zu seiner Eheliebsten hinübergeblinzelt hatte, war schon mal eine fest davon überzeugt, daß aus dem Vielleicht ein Sicher
werden würde.
Tscha, und dann kam der Clemenstag! Schon am späten Vormittag wummerte es derart durch jenen Garten, daß sich sogar der
Schlendertünnes am liebsten Watte in die Ohren gestopft hätte oder aufgestanden wäre, um mit harten Wörtern Kriegsbeile zu schmieden. Er saß nämlich
gerade im Garten und zerkleinerte seinen Pflaumenbaumschnitt und war so dem Wummern ungeschützt ausgeliefert. Musikgeschmäcker sind nun mal verschieden, aber wem sie missionarisch
eingehämmert werden sollen, der darf zumindest aua sagen. Aber er tat’s nur für sich, als hätte er sich an jenen Weisen aus dem Teil der Schweiz
erinnert, wo die Täler wallen und Seen lachen und alles Neue erst einmal mit einem Nö beginnt: Erst wenn es in deinem Herzen ganz still geworden ist,
rede.
Der Nachmittag war ruhiger, aber irgend etwas mußte vor dem Haus im Gange sein, so daß unser Igel und sein treuer Bruhno heute etwas früher zu ihrer Nachtschicht
aufbrachen und erst einmal vor dem Haus nach dem Rechten sahen.
Einen unrechten Schlendertünnes sahen sie jedenfalls, der gerade ein Schachspiel verloren hatte, weil er (wie er zerknirscht
versicherte) zu wenig acht auf seine Dame gegeben hätte. So etwas wäre unserm Nachtmeister bestimmt nicht passiert.
Tscha, und dann kamen die Franjas: eine zupfende Sängerin, ein Gitarrist und ein Händeklopfer; und damit kam Stimmung auf. Insbesondere der Gitarrist hatte es
unseren beiden Freunden angetan. Nun läßt es sich über Musikgeschmack zwar heftig streiten, aber dieser Musiker glich in seinem Auftreten einem Sämann: Er säte freudigen Optimismus aus und
fand fruchtbaren Boden. Ob er es war, der unsern beiden Freunden diesen grandiosen Einfall gab? Welchen Einfall?
Nun, jedem rauschenden Fest folgt meistens was? Richtig: ein Katerfrühstück! Jedoch – am Groschenberg
ist manches anders. Hier gab’s weder Hering noch saure Gurken, noch einen Kater, sondern eine gewisse Katzendame und – eine kupferfarbene Wurst, die wesentlich weißlicher zum festlichen
Verzehr bestimmt gewesen war. Nun aber ähnelte sie sehr einer jungen, aber wohlgenährten Blindschleiche, und das so verlockend, daß Frau Greuler nicht
widerstehen konnte. Allein – mit Delikatessen hat sich schon mancher den Magen verdorben! Erst geriet dieser bei Frau Greuler in Aufruhr, dann wurde ihr schwindelig, daß sie große
Schwierigkeiten hatte, nach Hause zu kommen; und als sie gegen Abend von ihrem Rausch erwachte, hatte sie einen tüchtigen – Kater! Seitdem hat sie nie wieder einer Blindschleiche
nachgestellt. Was freudiger Optimismus mit Musik doch alles bewirken kann, – wenn er überspringt!
© Stiftung Stückwerken, *22.9.2023,
freigegeben am 28.11.2023
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.207 Nachtmeister Stropp als Kaminkehrer
Ja, das war schon ein Sommer in diesem Jahr! Nicht zu trocken, nicht zu naß, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Für unsere Freundinnen und Freunde
gerade das Richtige: viele Wochen lang Ferien! Wenn das so weiterginge, bräuchten sie gar keinen Winterurlaub mehr. Und so wurde die Rückreise nach Dortwehr von Woche zu Woche
verschoben.
Allein – auch in Rasenheim wurden die Tage zumindest ab August spürbar kürzer und die Nächte somit länger. Da sich aber unser
Nachtmeister nicht nach der Sonne Aufgang oder Untergang richtete, sondern nach deren Stand, brauchte er auch in den 1. Herbsttagen seine Nachtschicht nicht
auszudehnen; aber – die Nächte waren doch deutlich kühler denn im Sommer.
Im Garten wurden die letzten Bohnen geerntet und die Kartoffeln, und wie sich dabei der Schlendertünnes anstellte, na, das vermehrte nicht sein Ansehen bei unseren
Freundinnen und Freunden: der Igeldame Frau Struppe, deren Gatten Nachtmeister Stropp, dessen Lernkraft Bär Bruhno, dem Waschbären Wastel und dem jungen Meisenmädchen Meisje. Stell dir vor, der
Schlendertünnes grub die Kartoffeln mit der Grabgabel aus, nicht mit der Kartoffelforke, so daß es manchem Erdapfel eher zu einem Aufspießen gereichte denn zu
einer Auferstehung. Zumal dieser Lausejunge unbedingt unmittelbar nach einigen Regentagen seine Ernte einbrachte, so daß sich Frucht und Erdreich noch nicht so leicht Lebewohl sagen
wollten. Jedoch – was machte dieser Bengel? Er kratzte die schützende Erde von den Kartoffeln ab und ließ das Ergebnis in der
Sonne trocknen. O weh! Da gab’s aber eine Gardinenpredigt, und zwar nicht im Schlafzimmer, sondern im Garten! Unsere Freundinnen und Freunde meinten jedoch, so was hätte der
Lümmel verdient; denn Futter müßte behutsam behandelt werden und nach sattsamer Unterweisung.
Tscha, was gab’s sonst noch? Vom Straßenfest hab’ ich bereits berichtet und wie der Katze Greulich die Lust
auf Blindschleichen gänzlich vergangen ist. Ach so, eines gab’s noch: Gefahr!
Schon im letzten Jahr hatten unser Nachtmeister und seine Lernkraft Merkwürdiges erlebt. An einem späten Sommerabend war nämlich der Schlendertünnes plötzlich aus
dem Haus getreten. Hatte der etwa ein Treffen mit seiner Liebsten? Heimlich waren unsere beiden Freunde ihm gefolgt. Nee,
Menschen schien er nicht zu suchen, schnupperte aber immer wieder in der Luft, zog eine Runde um die Häuser der Nachbarschaft und schien irgend etwas zu suchen, aber nicht zu finden.
Erfolglos ging er wieder ins Haus.
Was der Schlendertünnes damals gesucht hatte, das ging dem Scharfsinn unseres Helden erst in diesem Jahr auf, nämlich beim Straßenfest. Etwas abseits der Bänke
flackerte ein kleines Lagerfeuer; und zwar auf einem Ständer, der anscheinend mit Holzscheiten gefüllt war. Vermutlich waren die nicht ganz trocken; denn hin und wieder
knisterte und zischte es; und als etwas Wind aufkam, schickte das Feuer kleine Sternschnuppen – in die Dunkelheit? Nein, zu den
Feiernden. Und Ruß! Die Stimmen von Sängerin und Sänger kamen nicht mehr in die Höhe; und obwohl er Ruß und Rauch versucht hatte auszuweichen, war der Schlendertünnes noch nach
2 Tagen heiser.
Kein Wunder, daß der Schlendertünnes eine Woche später 2 Männer zur Rede stellte, die ebenfalls solch ein Bohnenstrohfeuer entfacht hatten und versorgten. Wie von
ungefähr konnten unsere beiden Freunde dieses Gespräch belauschen. Der Schlendertünnes bat sogar um Verzeihung, als er fragte, ob’s den beiden bewußt wäre. Was bewußt? Na, daß ihr Rauch noch in 1 km Entfernung zu riechen sei. Er gönne ihnen ja ihre Freude, aber er bitte die beiden, sich etwas einfallen zu
lassen, damit die Nachbarschaft nicht durch Ruß und Rauch belästigt und geschädigt werde. Ei, da hatte er aber was gesagt! Er täte ihnen wohl ihre Freude nicht gönnen und – Das
habe er nicht gesagt, widersprach der Schlendertünnes und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, auch keine Vorschriften gemacht, sondern überlasse es ihnen und ihrem Grips, sich selber eine
Lösung auszudenken; dann ging er weiter. Wenn Blicke hätten töten können, wer weiß, ob der Schlendertünnes noch am Leben –
Nun ja, voller Zuversicht waren weder der Schlendertünnes noch unsere Freunde. Besorgt setzten die beiden ihre Runde fort: Was wäre, wenn diese Unsitte mit den
Bohnenstrohfeuern immer weiter um sich griffe? Menschen ist ja viel Dummheit und Rücksichtslosigkeit zuzutrauen! Kurzerhand
berief unser Igel am nächsten Morgen im Gartenversteck eine Krisensitzung ein. Denn wer schon mal Wälder und Felder hat brennen sehen, will so etwas nicht noch einmal erleben. Tscha,
wie konnte solch einem Unglück vorgebeugt werden?
„Wir klauen den Menschen einfach das Brennholz“, brauchte unser Waschbär nicht lange zu überlegen.
„Alles Brennholz der Welt?“ gab unser Stropp zu bedenken. „Sie werden immer Nachschub finden und am Ende gar
unseren schönen Bergwald abholzen.“
„Na, dann führen wir eben Krieg“, schlug unser Bruhno vor.
„Nu, was das heißt“, versuchte Frau Struppe zu lenken, „hast du bereits am eigenen Leibe erfahren. Nein, einen Krieg gegen die Menschen könnten wir Tiere nie
gewinnen; jedenfalls nicht wir größeren Tiere. Nein, aber aus der Dunkelheit solche Bohnenstrohpester mit Kompost zu bewerfen, also – wenn ihr das wollt, dann wär’ ich dabei.
„Ich tät’ einfach wegfliegen“, blieb unser Meisenkind unbekümmert.
„Und die andern, die nicht fliegen können?“ dachte unser Stropp auch an sich. „Die werden vom Feuer schnell
eingeholt. Nein, ich hab’ mich neulich mit einem Rotschwänzchen unterhalten, und das hatte kurz zuvor mal einem Kaminfeger bei der Arbeit zugesehen. Die Kamine sind inzwischen so
eingerichtet, daß sie fliegende Funken rechtzeitig einfangen, den Ruß einsammeln und sogar den Rauch vermindern und reinigen. Doch solche Kamine gibt’s für die Bohnenstrohfeuer nicht.
Also? Also müssen wir einen Brief an die Regierung in Köglück schreiben, daß auch die
Bohnenstrohfeuer solch einen Kamin als Aufsatz erhalten müssen.“
„Denk nur an die Kaltequelle in Dortwehr“, mußte unser Bruhno die Zuversichtlichkeit seines Lehrherren trüben, „der hat seit über 18 Monaten auch noch keine Behörde
zurück ins Leben verholfen.“
„Dann dürfen wir’s eben nicht für uns behalten“, wußte Frau Struppe Rat. „Stropps Einfall ist wie immer genial, nur müssen wir’s weitersagen und unter die Leute
bringen, wie töricht solche Bohnenstrohfeuerstellen sind und wie rücksichtslos und was dagegen getan werden kann, daß sie nicht mehr schaden und –“
„– Frieden ist“, ergänzte unser Nachtmeister. „Struppe, was wären wir ohne dich und deine weisen Ratschläge!“
© Stiftung Stückwerken, *29.9.2023,
freigegeben am 28.11.2023
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.208 Erstens kommt es anders
„Betet Ihr eigentlich noch?“ suchte Donna Nickenkopp eine Rampe zum Abladen.
„Ja“, gab der Alte von der Halbinsel zu, „aber mit den Jahren formloser und formloser.“
„Was?“ entsetzte sich die Besucherin. „Laßt Ihr es etwa an der nötigen Ehrfurcht fehlen? Kein Wunder, daß Ihr hier in so ärmlichen Verhältnissen –“
„Die wohl Milliarden von Menschen als paradiesisch erscheinen“, hielt der Alte dagegen. „Beten, um auf Erden reich zu –?“
„Mit Sorgen und mit Grämen / und mit selbsteig’ner Pein / läßt Gott sich gar nichts nehmen, / es muß erbeten sein“, zitierte Donna Nickenkopp. „Das sagt schon der alte
Gottesmann. Und der Heilige Paulus lehrt uns den 4-Klang: Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Und die Heilige Kirche –“
„– oder die sich dafür halten, haben ein Gebot draus gemacht“, konnte es der Alte nicht loben, „und den letzten Teil jenes Verses –“
„– hat uns gelehrt, mit dem Danken zu beginnen“, wollte sich die Besucherin nicht aufhalten lassen.
„Um Gott heidnisch zu umschmeicheln?“ gab der Alte zu bedenken.
„Mich hat er jedenfalls überreich gesegnet“, ließ es Donna Nickenkopp nicht an sich heran. „Also kann’s ja nicht verkehrt sein. Aber wenn ich mich hier so
umschaue, –“
„– bin ich dem lieben Gott ein Rabe?“ konnte der Alte ein Schmunzeln nicht
unterdrücken. „Nein, ich will niemandem das Beten vermiesen; allein – ich achte, das Beten ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um
des Betens willen. Und deshalb ist mir das Vaterunser der beste Leitstern für das
Gebet: viel Fürbitte und viel Gottvertrauen und der Wunsch, den Dank nicht zu plappern, sondern zu leben“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal eine Prinzessin, die – die hieß Paula. Eigentlich Paulinchen; aber
sobald sie die Bedeutung der beiden Namen zu unterscheiden wußte, nannte sie sich Paula. Und als sie in den fremden Sprachen besser bewandert war, hätte sie sich noch lieber Maxima oder
Megane genannt; aber ihr Vater wollte es nicht durchgehen lassen. Zumal sie wirklich nicht groß von Gestalt war. Und da die Prinzessin darin eine Wurzel vieler Übel sah, machte
es ihr durchaus großen Kummer.
Nun wissen wir ja aus den Märchen, daß es Feen gibt; angeblich auch schlechte und böse, aber das sind vermutlich Hinzudichtungen strenger Eltern. Paula
glaubte jedenfalls an eine gute Fee, und zu der ging sie endlich mit ihrem Kummer. Sie wünsche sich eine größere Gestalt. Jetzt nicht so lang und dürr wie eine Bohnenstange, aber doch
so groß, daß alle anderen Mädchen ihr nur bis zu den Augen reichen täten; und das ohne dicke Sohlen und ohne hohe Absätze.
Die Fee hörte sich das Anliegen an, nickte und meinte, Größe sei an sich nichts Schlechtes.
Fröhlich zog unsere Paula wieder auf das Schloß ihrer Eltern – in der Gewißheit, ihre Bitte werde in Erfüllung gehen. Allein – es tat sich nichts, und von Tag zu
Tag wandelte sich die Gewißheit mehr und mehr in Enttäuschung. Alle anderen Kinder wuchsen in die Höhe, nur Paula wuchs nicht!
Vorwurfsvoll ging sie nach einem Jahr wieder zu ihrer Fee: Statt besser sei es schlimmer geworden! Sogar zu andern Kindern
müsse sie aufschauen, erst recht zu allen Erwachsenen.
„So?“ schien sich die Fee zu wundern. „Du kannst noch immer zu Kindern aufschauen? Ist das keine –?“
Wenn die Fee was nicht könne, dann möge sie das nur sagen. Aber vielleicht könne sie wenigstens den Wunsch nach einem Pferd und einer prächtigen Kutsche
erfüllen.
Wieder nickte die Fee, als wolle sie dem Wunsche stattgeben. Aber auf dem Rückweg zum elterlichen Schloß fand die Prinzessin weder Pferd noch Wagen, sondern – einen
Esel. Und der trabte geduldig neben ihr her und ließ sich auch nicht abwimmeln, sondern verhielt sich so, als wäre er für Paula bestellt. Reiten ließ er sich aber nicht;
jedenfalls nicht von Paula! Und einspannen auch nicht. Aber Lasten zu tragen, dazu war er durchaus bereit. Ja, das war schon ein sonderbares Verhältnis zwischen den beiden:
Einerseits schämte sich die Prinzessin für ihr Grautier, andererseits war es ein zuverlässiger Begleiter durch dick und dünn.
Und so brauchen wir uns nicht zu wundern, daß unsere Paula ihren Jasager mit zu ihrem 3. Besuch bei der Fee nahm. Inzwischen war sie nämlich in das heiratsfähige
Alter gekommen und hatte dabei gewahrt, daß blaue Augen ein trefflicher Köder seien, die tollsten Hechte an die Leine zu bekommen.
Wieder hörte die Fee nickend zu und entließ unsere Paula mit der Hoffnung, daß wenigstens der 3. Wunsch in Erfüllung gehen werde.
Kustepuschen! Der Prinzessin Augen wandelten sich nicht in 2 blaue Vergißmeinnicht, sondern blieben graue Mausöhrchen. Und obendrein wurde ihr eines Tages
schonungslos entdeckt, sie habe einen Silberblick. Trotz seiner Bezeichnung nicht als Kostbarkeit bekannt; denn wenn dich Menschen umgeben, wissen diese nie genau, wen du wirklich
anblickst. Das ist dann so, als wenn du 2 Fischen gleichzeitig deinen Köder zuwirfst – mit der Folge, daß keiner von beiden anbeißt. Tscha, aus dem Mausöhrchen war auch noch ein
Mauerblümchen geworden! Und das war auf jene Fee gar nicht mehr gut zu sprechen. Die konnte wohl gar nichts! Oder war sie etwa eine böse Hexe? Jedenfalls ging unsere Paula zu der nicht mehr hin; vorerst!
Da begab es sich eines Abends (Paula hatte einen gebirgigen Weg zur Heimkehr gewählt), daß ein stolzer Prinz dahergeritten kam und
nicht achtgab auf die kleine Gestalt und deren grauen Begleiter. Und schon war es geschehen! Nun, wer klein von Gestalt ist, fällt auf dem Weg nicht tief und nimmt keinen
Schaden; aber ein stolzer Reitersmann kann bei einem Sturz sogar in Lebensgefahr geraten. So auch hier! Während Paula nur Staub abzuschütteln brauchte, konnte der gefallene
Reiter nicht mal das, sondern blieb regungslos liegen. Das durfte doch nicht so bleiben; oder? Jedoch – zu helfen wußte die
Prinzessin nicht; dafür aber ihr Esel. Und irgendwie schafften sie es dann gemeinsam, den Verletzten auf den Rücken des Tieres zu bringen und aufs Schloß. Mit einem Pferd wäre
so etwas nicht möglich gewesen; zumal das Reittier jenes Prinzen erschrocken Reißaus genommen –
„Und was hat das jetzt bitte schön mit dem Beten zu tun?“ konnte sich Donna Nickenkopp nicht länger
zurückhalten.
„Das kommt drauf an, ob du’s amtlich siehst oder kindlich“, antwortete der Alte. „Als der Prinz jedenfalls aus seiner Ohnmacht erwachte und in 2 Augen mit
Silbergehalt blickte, glaubte er sich in den Himmel. Und wenn ich recht unterrichtet bin, erhielt jene Fee nach einiger Zeit sogar Besuch von einem Brautpaar und einem Esel; und alle
waren fröhlich. Wie im richtigen Leben: Am Ende wird alles gut; und wer darauf vertraut, hat viel mehr Freude.“
Doch diesen letzten Satz hörte die Besucherin leider nicht mehr, obwohl der Alte seine Freude gewiß mit ihr geteilt hätte.
© Stiftung Stückwerken, *3.11.2023,
freigegeben am 28.11.2023
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.209 Ärmelig, doch nicht ärmlich
„Habt, habt –“, druckste Donnina Violetta herum, „habt Ihr schon mal geliebt?“
„Zumindest war ich 3mal verliebt“, antwortete der Alte von der Halbinsel sinnend, „jedenfalls
für länger. Das 1. Mal war ich 17, und das dauerte 8 Jahre, also 4 bis 8
Jahre; das 2. Mal war ich 25, und das dauerte 9 Jahre; und beim 3. Mal war ich 36, und –“
„Und – und kennt Ihr das auch“, fuhr das Mädchen stockend fort, „aus Liebe zu verzichten? Weil – weil du
glaubst, den andern nicht glücklich machen zu können; oder so.“
„Diesen Gedanken kennt wohl jeder, der liebt“, vermutete der Alte. „Er kann durchaus ein Anzeichen sein, nicht nur verliebt zu sein, sondern sogar zu lieben.“
„Aber – aber“, folgerte Donnina Violetta entsetzt, „aber dann müßte doch jede Liebe unglücklich enden; oder?“
„Blaise Pascal sieht das anders“, antwortete der Alte, schlug dann aber nicht den Weg der Gelehrsamkeit ein. „Zum Glück stehen
bei der Liebe immer 2 Subjekte auf der Bühne, während das Verliebtsein Subjekte in der Regel nur mit Objekten paart. Es ist nun kein klingendes Bild, aber stell dir vor, du
wirfst einen Stein in einen Teich. Das bleibt nie ohne Wirkung, sondern –“
„Aber – aber wenn nun beide Seiten verzichten: er und ich“, trug die junge Besucherin Hoffnung zu Grabe, „dann –“
„Dann ist das schon Stoff für eine Tragödie“, schien der Alte sein Beileid ausdrücken zu wollen, besann sich jedoch noch rechtzeitig auf seine Rolle als Mährchenonkel:
„Aber jener Bothe aus Wandsbeck macht Hoffnung, etliche Ehen seien im Himmel geschlossen worden und würden auf Erden
– Doch ich will jetzt keine Brücke zu den Groschenromanen bauen“, und er begann zu erzählen:
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, wär’ einmal eine Prinzessin, die – die hieß Hele–, eh,
Helina. Tscha, und irgendwann war sie so alt wie jetzt du und – warf ihre Angel aus. Es kamen auch manche Fische angeschwommen, sogar
Barsche und Hechte, spielten mit dem Köder, jedoch – spielen ist noch nicht anbeißen. Und anbeißen ist noch nicht einhaken. Und einhaken ist noch nicht an Land ziehen. Na ja, du
weißt inzwischen ebenfalls: Das Angeln bedarf der Geduld.
Aber endlich zappelte doch ein Fisch auf dem Land; und weil’s nicht sein Element ist, ward er geküßt und verwandelte sich in – den Prinzen Fridolin. Nee, nee, geheiratet wurde noch nicht so bald; und der König achtete streng darauf, daß jener Prinz nicht auf dumme Gedanken kam und auf
dem Königsschloß übernachtete sowie daß Helina alle Tassen im Schrank behielt und nicht in das Landhaus am Rande der Residenzstadt rückte, das Fridolin zugewiesen worden war.
Allein – die beiden begegneten sich täglich und gingen dann gemeinsam im Schloßpark spazieren, sogar unter einem Schirm. Na ja, du kennst das inzwischen wohl auch:
’ne Tageswanderung hätten die beiden jetzt nicht geschafft; also nicht über mehr als eine Meile.
Ach, es hätte alles so schön sein können! Doch dann hätte ein gewisser Mark Tapley nicht vergnügt sein können, und aus
Karl Valentin wäre kein Regenskünstler geworden. Jedenfalls – eines Tages blieb jener Prinz aus, auch am nächsten Tag und am übernächsten
Tag. Erst am Sonntag in der Stadtkirche sah Helina ihn wieder, aber nicht in ihrer Nähe. Und als die Kirche aus war und die Prinzessin sich
verstohlen umschaute, da war der Prinz bereits verschwunden. So auch am nächsten Sonntag. Hm, was war da zu tun? In solchen
Fällen ist es anscheinend gut, wenn du eine Kammerzofe hast. Eine einfühlsame! Denn die spürt bald, wenn da was nicht in Ordnung ist, hakt neu–, eh, wißbegierig nach und – bietet ihre
Dienste an.
Als am nächsten Sonntag die Kirche aus war, sah Helina den Prinzen wieder nicht; aber nachdem sie sich nach dem Mittagsmahle in ihre Gemächer zurückgezogen hatte,
erstattete Trinette Bericht. Die Zofe hatte nämlich den Prinzen abgefangen und zur Rede gestellt, brachte aber keine erfreulichen
Zeitungen. Er habe keine Lust mehr gehabt, mußte Trinette berichten, deshalb sei er nicht mehr gekommen. Und nun?
Helina wandte zunächst die nordische Taktik an: Du bist für mich Luft! Äußerlich ist das in der Regel mit dem Blindekuhspiel verbunden. Auf den 1.
Blick! Denn selbstverständlich hatte die Augenbinde der Prinzessin ganz schmale Sehschlitze. Und durch diese gewahrte Helina immer wieder, daß Fridolin weiterhin immer nur Augen für
Eine hatte, nämlich – die Kuh! Aber Anstalten, sich ihr zu nähern, machte er einfach nicht. So ein blöder Schafskopf!
„Du mußt ihn eifersüchtig machen!“ wußte die Zofe französischen Rat; mit flämischer
Hoffnung: Dan komt hij zeker.“
Denkste! Es ist eine allgemein anerkannte Weisheit, daß Frauen ihre Geschäfte nach dem Motto ordnen: Wir haben zwar keine Ahnung, aber wir reden schon mal drüber! Jedenfalls verhielt sich Fridolin überhaupt nicht nach der Devise, die uns Männern
unterstellt wird: Wir haben zwar keine Ahnung, aber wir fangen schon mal an! Oder ahnte er etwa etwas? Allein – sein Blick wurde
trauriger, aber Anstalten, sich Helina zu nähern, unternahm er weiterhin nicht.
In ihrer Not ging die Prinzessin schließlich zu ihrer Fee Binsenkraut und schüttete dort ihr Herz aus.
Die Fee hörte sich alles ruhig an, nahm aber dann kein Blatt vor den Mund und schalt unsere Helina eine dumme Gans. Wie könne sie wähnen, daß aus Täuschung
Vertrauen erwachse? Und könne etwa auf dem Boden des Argwohns Liebe leben?
Tscha, und nun gab’s eine Nähstunde! Die Prinzessin möge mal den Ärmel dort drüben holen und an das Kleid hier halten. Und? Sei das eine feste Verbindung? Nein! Also? Also müßten Nadel und Faden her. So weit, so gut. Nun möge sie den Faden hurtig durch den Rand des Ärmels ziehen. Hurtiger! Noch
hurtiger! Und? „Da kannst du dich noch so abschuften: So hält der Ärmel nicht am Kleid! Also? Du mußt mit dem Faden b e i d e Seiten zu verbinden trachten. Nicht nur einmal, sondern viele –“
„Und was soll ich jetzt aus Eurem Faden machen?“ mangelte es Donnina Violetta etwas an Ramontik.
„Soll?“ rieb sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort. „Nichts sollst du. Erst recht kein
Bilderrätsel daraus machen. Denn sonst wär’s ein Gebot und keine freudige Entdeckung; und es gäbe nur eine einzige Deutung. Helina erbat sich jedenfalls Kleid, Ärmel, Nadel und
Faden, kehrte sinnend auf ihr Schloß zurück und legte alles in ihrer Kammer in eine Vitrine. Und dann ging’s los! Und wenn die beiden nicht gestorben sind, – in meinen Mährchen leben
sie ohnehin weiter, – dann verbinden sie sich noch heute.“
Nach Art der Jugend sprach die Besucherin kein Dankeswort, aber bewegte das Gehörte in ihrem Herzen. Das macht Hoffnung! Und still freute sich der Alte
bereits im voraus.
© Stiftung Stückwerken, *9.+11.11.2023, freigegeben am 13.11.2023
Qouz-Note: 2
***
MamM 1.210 AEG – AM ENDE G–
„So leid es mir tut“, packte Donna Distelfalter aus, „Auch ihn werd’ ich wohl bald vor die Tür setzen müssen.“
„Dein wievielter Mann ist das jetzt?“ fragte der Alte von der Halbinsel vorahnend.
„Also richtig verheiratet“, dachte die Besucherin nach, „ja, doch, das ist jetzt mein 6. Aber außer denen gab’s noch –“
„Ein hoher Verbrauch!“ stellte der Alte fest.
„Ha“, lachte Donna Distelfalter, „das hab’ ich bei meinem Buchführungslehrer gelernt. Der hat mir nämlich das Abschreiben beigebracht. Und wenn du degreessiv
abschreibst, also einen konstanten Prozentsatz vom jeweiligen Restbuchwert, dann bleibt schnell nicht mehr viel übrig, und es lohnt sich schon bald eine Neuanschaffung.“
„Hattest du denn auch was mit diesem, eh, Lehrer?“ entlarvte der Alte sich als nicht ganz frei von Neugier.
„Nee, bei dem waren Hopfen und Malz verloren“, enthüllte die Besucherin. „Der hat mir nämlich mal erzählt, er kenne nicht nur das Abschreiben, sondern auch die
Kapitalwertmethode. Und –“
„– die hat er dann auch auf Frauen angewandt“, ergänzte der Alte, „also die Anschaffungskosten mit allen künftigen Ein- und Auszahlungen, abgezinst auf die Gegenwart,
zusammengezählt.“
„Richtig!“ bestätigte Donna Distelfalter. „Und er kenne keine Frau, bei welcher der Kapitalwert – Aber jetzt wird mir das erst bewußt: Geht auch Ihr nach
dieser Berechnung –“
„Ich bin Junggeselle, das stimmt“, gab der Alte zu, „und Frauen sind nicht nur bei der Anschaffung teuer, sondern auch beim – Aber wieso bist du eigentlich hier und
sagst mir –?“
„Vielleicht gibt’s ja für meine Ehe noch Hoffnung“, gestand die Besucherin ein, „und von Euch geht das Gerücht um, es gehe bei Euch immer alles gut aus;
oder?“
„Ich bin weder ein Experte für Gerüchte“, versuchte der Alte richtigzustellen, „noch für den Ehekrieg, sondern nur für Mährchen; aber wir wollen mal hören:“
Es wär’ einmal eine Prinzessin, die – die hieß Buxelina. Na, da ahnste wohl schon, wenn die sich eines Tages das Fangeisen an
den Ringfinger steckt, dann wird sie die Hosen anbehalten. Und so war’s auch! Ja, sie steckte den Trauring nicht nur sich selber an, sondern auch noch dem Prinzen Degenhart, ihrem künftigen Gemahl.
Zunächst einmal war der noch sehr wild und hatte sich seine Hörner noch nicht abgestoßen. Ob’s daran lag, weil er sich von Kindesbeinen nicht viel um die Viehzucht
gekümmert hatte? Jedenfalls galt seine Vorliebe von Anfang an den unberechenbaren Katzen und – den Wolfshunden im weitesten
Sinne.
Das war bei der Prinzessin ganz anders. Sie liebte vor allem jene Tiere, deren Fleisch Katz und Hund als Futter dient; und das draußen! In ihrem Schloß
duldete sie eigentlich überhaupt keine Tiere. Erst recht nicht im Schlafzimmer.
Aber in jener Ehe gab’s noch weitere Baustellen. So hatte der Prinz bereits als junger Schnösel den Idiotentest durchgezogen. Vielleicht kennst du ihn, auf
deine Verhältnisse abgewandelt, auch: Ein gefülltes Röllchen, also der Idiotenstengel, wird rumgereicht, und jeder Kandidat muß durch ihn Luft einziehen; und das muß er an 6 Tagen
wiederholen; und wem am 7. Tage nach dem Ziehen nicht mehr schlecht wird, der hat den Test bestanden und gilt künftig als Voll–, eh, als besonders männlich.
Die Prinzessin hatte diesen Test noch nie bestanden, weil sie ihn noch nie gemacht hatte. Und sie hatte das auch für die Zukunft nicht vor. Und bereits vor
der Hochzeit, also von Anfang an, hatte sie dem Prinzen zu verstehen gegeben, sie sei nicht sein Aschenbecher und das Schloß keine Gaststätte. Wenn er das ändern wolle, könne er das gerne
haben, müsse dann aber am Abend als ein Gast Hut und Mantel nehmen und Abschied. Und Gift dazu und darauf, daß er sich dann ein anderes Heim suchen müsse. O weh! Das Ahnen
wächst!
Tscha, und dann die Sache mit dem Fahren und Reiten! Hartnäckig halten sich die Gerüchte, beides habe Degenhart noch vor dem Laufen erlernt.
Dazu hatte Buxelina ihre eigenen Ansichten. Ihre ablehnende Haltung zum Reiten rechtfertigte sie damit: Sie sei doch nicht lebensmüde. Und auch keine
Gutsherrin! Und vom Kutschieren halte sie nichts, weil ihr der liebe Gott ihre Beine zum Laufen gegeben hätte und nicht zum Wegschnallen oder
Sitzen. Und sie hatte sehr hübsche Beine!
Nun, das mag bereits genügen, und es ist nicht zu bestreiten: Das Schlachtfeld des Ehekrieges war gut vermint. Jedoch zunächst auch gut verminnt. Katz und
Hund waren in den Schloßpark verbannt, das Hausverbot für den Idiotenstengel wurde auch beachtet, und Degenhart respektierte es, daß die Prinzessin nie zu ihm in die Kutsche stieg, sondern zu Fuß
ging.
Doch da begab es sich an einem ungemütlichen Novembertag, daß sich der Prinz in seiner zugigen Kutsche eine Erkältung zuzog und
deshalb für 7 Tage das Bett hüten mußte. 7 Tage sind eine lange Zeit, und in einem kranken Leib steckt nicht unbedingt ein willensstarker Geist.
Jedenfalls – als Buxelina am 7. Tag ihren Krankenbesuch machte, traf sie dort auch Lieblingshund und Lieblingskatze an, ja, und – du ahnst es schon: Degenhart
saß aufrecht im Bett und zog genüßlich –
„Aha, deshalb!“ kam’s Donna Distelfalter anscheinend bekannt vor.
„In ihrer Wut“, erzählte der Alte weiter, „packte die Prinzessin ihren Gemahl an den Schultern und stieß ihn heftig gegen einen Pfosten des Betthimmels. Und wen
oder was hielt sie mit einem Mal in den Händen? Ein Schoßhündchen! Nun ja, besser als gar nichts! Vielleicht gab’s dafür ja
irgendwann einen Gegenzauber. Bis dahin wurde den Hofleuten eingetrichtert, der Prinz sei zu einer Genesungskur verreist; und auf daß es keine Lüge sei, begann Buxelina sogleich
damit; nicht mit der Reise, aber mit der Kur. Das neue Schoßhündchen wurde nach Strich und Faden zum unbedingten Gehorsam dressiert. Die Folge? Unbedingter Gehorsam und unbedingte Liebe schließen sich gegenseitig aus. Gut, die Prinzessin empfand noch den Stolz des Besitzes und der
Zuchtmeisterin, aber lieben – nein, lieben konnte sie dieses Tier nicht. Allein – die Hoffnung war noch nicht gestorben, und mit der ging Buxelina zu ihrer guten Fee. Tscha, und die gab kurz und knapp den Rat, die beiden Eheleute möchten an dem und dem Bach eine Wanderung von der Quelle aus machen; das übrige
werde sich schon finden. Nun ja, selbst Schoßhündchen springen gerne über einen Bach. So auch hier. Und ist der Bach zu breit, so laufen sie eben über eine Brücke. Werden
sie dann zurückgepfiffen, dann kehren manche aber nicht um, sondern laufen weiter, um bald die nächste Brücke zu nutzen. Degenhart gehörte zu „manche“. Aber irgendwann kam keine
Brücke mehr, und der Bach war so reißend, daß das Schwimmen selbst einem Hunde das Leben gekostet hätte. Da kehrte das Hündchen um und lief Richtung Quelle zurück, bis es die letzte Brücke
gefunden hatte. Buxelina lief natürlich auf ihrem Ufer in die gleiche Richtung. Und als die beiden endlich zusammengefunden hatten, nahmen sie sich in die Arme, küßten sich, und
plötzlich – Warte doch! Ich wünsch’ euch beiden, daß auch ihr noch eure Brücke wiederfindet. ADieu!“
© Stiftung Stückwerken, *17.11.2023,
freigegeben am 18.11.2023
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.211 Besessen, Haben, Sein
„Wir sollen Buße tun“, berichtete Donna Pilgerin aus der letzten Predigt, „und uns zu Gott bekehren –“
„Sollen?“ rieb sich der Alte von der Halbinsel mal wieder an seinem Reizwort. „Allein – umkehren und werden wie die Kinder, das –“
„Davon hat der Herr Pfarrer nichts gesagt“, behauptete sich die Besucherin als Geißlein gegen den bösen Wolf. „Wir sollen die Gebote halten und –“
„Immerhin also auch das 4.“, fand der Alte einen Brückenkopf, „aber alle Gebote zu halten, das hat angeblich selbst jenem reichen Jüngling nicht gereicht. Folglich
hat dir dein Pfarrer sicher auch geraten, außerdem zu verkaufen, was du hast, und es den Armen –“
„Nein, nein, nein“, wies Donna Pilgerin diese Vermutung entschieden zurück, „der Herr Pfarrer hat uns nur aufgezählt, was wir tun sollen; und wenn wir das umsetzen,
wären wir immer auf der richtigen –“
„Umsetzen!“ griff der Alte auf. „Vom Sollen zum Dürfen und vom Nicht-Sollen zum Nicht-Brauchen, ja, das –“
„Ihr verdreht ja einem das Wort im Munde!“ schimpfte die Besucherin, nicht ganz emanzipiert. „Ich muß sagen, da warnen sie ja zu recht vor –“
„Aber zum Recht will ich doch gar nicht hin“, deutete der Alte etwas hinein, was gar nicht gemeint worden war, „ich will zur Barmherzigkeit, und da warnt mich niemand
hin, sondern es zieht mich dorthin unverdiente Liebe“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger Mann, der war einst als Findelkind vor dem Tor eines Waisenhauses abgelegt worden. Und da dies am Xavertag geschehen und der Knabe irgendwie fremd aussah, war er auf den Namen Xalander getauft worden. Die Erziehung war
streng, doch ab dem Zeitpunkt wirkungslos, als der Knabe diejenige Überlebensregel entdeckte, die für alle strengen Erziehungshäuser gilt: Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern auf das,
bei dem du erwischt wirst. Aber die Kindererziehung ist heute nicht unser Thema, sondern uns interessiert der Weg, den Xalander gegangen ist, nachdem er mannbar geworden war und das
Waisenhaus verlassen hatte.
Endlich war er frei! Vor allem frei von den täglichen Ermahnungen: was er alles zu tun und zu lassen habe. Allein – grenzenlos ist diese Freiheit auch draußen
nicht; denn wie sagte es schon jener hohe Würdenträger: Alles hat seinen Preis! Willst du etwas haben, dann mußt du dafür etwas geben,
und selten stimmen beide Werte überein.
Noch schwieriger wird’s, wenn du selber gehabt wirst, also besessen bist. Wer täte dich da freikaufen wollen, wenn du’s selber nicht kannst?
Eigentlich war Xalander nicht das, was gerne ruftötend als „schlechter Mensch“ in Umlauf gesetzt wird – von andern. Nö, er köpfte keine Blumen, trat keine Käfer tot
(jedenfalls nicht mit Absicht), und wer ihn um Hilfe bat, dem half er, so gut er’s konnte. Und die Einschränkung hatte leider ihre Wurzel in einer
Habgier, die vom jungen Xalander Besitz ergriffen hatte; ganz besonders, sobald er eine schöne Eva erspäht hatte; und zwar eine neue.
Zuvor hatte er – ab der 1. Beute – immer jeweils eine alte. Mit der lebte, nein, rauschte er erst mal eine Zeitlang herrlich und
in Freuden, bis sich Abnutzungsspuren nicht mehr leugnen ließen, die Tiere, deren Namen beide Seiten in Umlauf brachten, immer größer wurden und die Augen Ersatzbedarf
bemerkten. Auf zur Pirsch! Auf zur Jagd! Und schon bald war die nächste Beute auf dem Wege, zur Trophäe zu werden.
Nö, Gewalt tat Xalander niemandem an; und anfangs war’s schwer zu sagen, wer in diesem Spiel die Angelschnur hielt und wer am Haken hing. Jedoch – auch an
Xalander ging die Zeit nicht vorüber, ohne ihre Gaben anzuheften. Mehr und mehr erhärtete sich bei ihm die Ansicht, er sei nicht nur Jäger oder Angler, sondern müsse auch was bieten.
Und wenn Männer angeblich nur das Eine wollten, dann wollten Frauen, ab einem gewissen Alter, immer nur das andere: nämlich eine sichere Finanzierung all ihrer Ausgaben. Vermutlich weißt du
besser als ich, ob da auch heute noch was Wahres dran ist.
Da aber Xalander nichts geerbt hatte und sich im Waisenhaus auch keine nützlichen Beziehungen hatten knüpfen lassen, ging er keiner weiteren Anglerin an den Haken,
sondern dieses Mal auf den Leim. Nein, keiner schönen Eva, sondern jenen strahlenden Herren, die vielversprechend vorgeben, Glück verkaufen zu können. Nein, nicht die Räuber von der
Bank; die verhelfen dir wenigstens noch zu einem kleinen Vermögen, nachdem du ihnen dein großes anvertraut hast; nein, die Herren vom Spielkasino nehmen dir alles und zuweilen
zusätzlich das, was du noch nicht hast; und das alles in völlig reinen Westen und mit gewaschenen Händen. Kurz: Xalander gewann anfangs hin und wieder wenig, verlor aber bald sein
ganzes Vermögen und gewann – allenfalls Schulden hinzu.
Nun, wer Sorgen hat, der hat auch Likör. Xalander begann zu trinken, um
sich zu berauschen, und wurde bald zu einem streunenden Kater, dem keine schöne Eva mehr schöne Augen machte.
Allein – da war doch noch jene Hestia. Die hatte anscheinend ein Herz für streunende Kater; zumindest für diesen
einen. Sie holte ihn in ihr Haus, päppelte ihn wieder auf, und – wie ward’s ihr gedankt? Xalander sprang ihr davon, entpuppte
sich wieder als jagender Don Juan, bis er wieder verkatert von Hestia aufgegriffen werden mußte; und so weiter.
Beim 7. Mal war das Aufpäppeln nicht bedingungslos. Und da das Katzenvolk behörtlich viele beeindruckende Musiker hervorgebracht hat, wurde es Xalander zur –
„Aber was hat das jetzt alles mit Buße und Bekehrung zu tun?“ konnte sich Donna Pilgrim nicht länger
zurückhalten.
„Eigentlich nichts“, mußte der Alte zugeben, „aber mit dem Leben viel. Denn da Xalander wirklich eine musikalische Begabung hatte, wurde sie durch die neue Aufgabe
zur Kellertreppe – nach oben. Nicht zum Olymp; denn von da geht’s bekanntlich nur bergab; und deshalb achtete Hestia sehr darauf, daß sich Xalander nicht in die Knechtschaft des
Beifalls und der Kritiker begab. Und alle 3 Monate gab’s in den ersten Jahren dennoch einen Rückfall in alte Abhängigkeiten. Aber dann pflegte Hestia Mut zu machen: Wer 10mal gefallen ist, muß folglich bereits 9mal wieder aufgestanden sein; also wird er das 10. Mal gewiß auch noch –“
Aber die Besucherin hatte sich umgewandt und war inzwischen gegangen, als wollte sie lieber büßen und ihre Kellertreppe abwärts gehen.
© Stiftung Stückwerken, *23.+25.11.2023, freigegeben am 26.11.2023
Qouz-Note: 2
***
MamM 1.212 Wie aber wandelt der Tod?
„Geht Ihr eigentlich noch zu Beerdigungen?“ verbarg Donna Trendina ihre Erwartung nicht. „Bestimmt
nicht gerne; nicht wahr? Ich auch nicht. Das ist alles so trostlos, und der Tod lauert bereits, wer der nächste –“
„Trauerfeier ist nicht gleich Trauerfeier“, hütete sich der Alte von der Halbinsel vor
pauschalen Meinungen, „insbesondere stößt es mich ab, wenn sie mit Verlogenheit und Heuchelei gewürzt –“
„Mir machen sie jedenfalls angst“, wollte die Besucherin lieber reden denn zuhören. „Und wenn der Trauerredner
selber nur noch aus Haut und Knochen besteht, dann ist’s mir, als grüße mich der Tod bereits siegesgewiß –“
„Der Tod als menschliches Gerippe?“ griff’s der Alte auf. „Merkwürdig, wie sich dieses Bild eingenistet hat! Eigentlich sogar
widersinnig. War der Tod einmal ein lebendiger Mensch? Weshalb zerfallen
seine Knochen nicht? Und solch ein Wesen sei stärker denn der stärkste Mensch? Denn dieser muß zu Staub –“
„Es ist schon unheimlich“, fühlte sich Donna Trendina bestätigt. „Am besten ist’s, wir denken gar nicht über
den Tod nach; oder?“
„Jein“, blieb der Alte auf Abstand, „denn unser Erdenleben hat nun mal ein Ende –“
„Steht sogar in Eurem Buch hier“, überraschte die Besucherin, „und daß wir’s bedenken sollen; aber ich kann
mir nicht helfen: Glücklich macht das nicht! So, nun wißt Ihr, warum ich nicht zu Trauerfeiern fahre. Aber eines hätt’ ich noch gerne von Euch erfahren: Wie stellt eigentlich Ihr Euch den Tod vor?“
„Als mein Geschöpf?“ schmunzelte der Alte, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß – der hieß Queckolder, und den beschäftigte deine Frage bereits von Kindesbeinen an: Welches
Wesens ist der Tod?
Auch Queckolder wuchs mit Bildern und Märchen auf, die den Tod als Gerippe zeigten; grinsend und mit
Sense. Aber als des Kronprinzen Großvater im Sterben lag, hatte Queckolder kein Gerippe an der Tür warten gesehen. Und als die
Königin den letzten Atemzug machte, war ihr Sohn zugegen gewesen, aber er konnte nicht bestätigen, daß sie von einem Gerippe abgeholt worden sei.
Nun war er selber König und hatte jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, dem Tode zu begegnen. Bereits das 1.
Todesurteil, das ihm zur Unterschrift vorgelegt wurde, gab ihm zu denken. Wer war dem Verurteilten jetzt der Tod? Ein unsichtbares Gerippe? Oder der sichtbare Henker? Wenn aber der Tod nur eine Einbildung war, dann diente er als Sündenbock für den Tötenden. Den tötenden Menschen. Und wer war an diesem Töten zu einem notwendigen Teil
mitschuldig? Derjenige, der das Todesurteil durch seine Unterschrift rechtskräftig machte! Also? Also verweigerte König Queckolder von nun an jedem Todesurteil die
Unterschrift.
Damit hatte Queckolder Lunte gerochen. Es drohte gerade ein Krieg, und wer sich davon einen Vorteil versprach,
riet dem König, Waffen zu kaufen und Söldner und dann nach der Devise zu handeln: Angriff sei die beste Verteidigung.
„Verteidigung?“ fragte der König. „Vor welches Gericht?“
Das Wort verstanden die Ratgeber nun nicht, voran der
Kriegsminister. Doch bevor diesem eine Entgegnung eingefallen war, da war er bereits durch den König des Amtes enthoben und zum neuen
Friedensminister ernannt. Denn die Zeit und das Geld, welche Waffen und Söldner kosten täten. sei viel besser eingesetzt, den Frieden
zu schaffen und zu stiften. Dieses Ziel werde zwar auch mit jedem Krieg vorgegeben, doch nie erreicht. Weshalb nie? Weil Krieg nur das schaffen könne, was er gelernt habe, nämlich
Krieg. Und so sei’s auch mit dem Frieden.
Eine sonderbare Ansicht. Allein – während seiner Ausbildung hatte Qeckolder manches Schlachtfeld besuchen
müssen. Den Tod hatte er dort nicht gesehen, aber Tote und Sterbende. Und
wer hatte dafür eine notwendige Mitschuld? Derjenige, der Kriegserklärung und Marschbefehl durch seine Unterschrift rechtskräftig
gemacht hatte!
Ach ja, so, wie bei Hinrichtung und Krieg, gab’s noch viele Bereiche, wo Tote und Sterbende anzutreffen waren, aber kein wartendes und auch kein handelndes
Gerippe. Aber handelnde Menschen! Auf den Chausseen. In den Werkstätten und Fabriken. Aber auch Menschen, die selbst Hand an sich
legten. Und dann die Unglücksfälle und Katastrophen! Eine
Sisyphosarbeit? Sisyphos sei angeblich ein glücklicher Mensch gewesen; der
König aber wurde mit der Zeit schwermütig. Wie das?
Die Früchte vom Baume der Erkenntnis machen eben nicht glücklich. Wenn Queckolder den Sensenmann als
Einbildung abtat, dann sah er mehr und mehr die eigene Mitschuld an all’ dem Sterben. Und seine Erfolglosigkeit! Denn eigentlich konnte er gegen das Sterben allenfalls einzelne Schlachten gewinnen und ein wenig Zeit, aber endgültig siegen konnte er
nicht.
Mit diesen lastenden Gedanken ging der König eines Abends am Strand entlang. Die Sommergäste waren längst
abgereist. Aus den Lüften war das Abschiedskonzert der Kraniche zu hören, Sehnsucht dem Strand und dem König hinterlassend. War das Leben eine Reise? Aber wohin?
Von ferne wehte der Klang einer Abendglocke herüber. Den Tag ausläutend? Die Nacht einläutend? Feierabend? Zu dieser Jahreszeit war es draußen eigentlich für jedes Tagwerk bereits zu dunkel.
Und daß ein Dorf oder gar eine Stadt dort drüben liege, davon war dem König nichts bekannt. Aber zumindest mußte dort drüben eine
Kapelle sein. Deshalb beschloß der König, auf den Glockenklang zuzugehen.
Die 1. Sterne waren am Himmel zu gewahren, kein Mond schien. Und als der König einen Tann erreichte, kündigten
nicht nur die Sterne ihre Begleitung auf, sondern auch die Glockenklänge. So ward dem König der Gang fortan wie ein Tunnel; und da er keine Blendlaterne mitgenommen hatte, mußte er es seinen Füßen überlassen, den richtigen Weg zu ertasten. Nun ja, auch wenn’s kein Gebirgssteig war, sondern eben, so war’s dennoch beschwerlich; und der König mußte seine Hände schützend vor sein Gesicht halten. Aber immer, wenn
er umkehren wollte, war’s ihm, als nehme er Glockenklänge wahr, und er faßte neuen Mut. Endlich erspähte er vor sich ein Licht, das ihn
noch wackerer ausschreiten ließ. Und dann stand er vor der Kapelle. Er
öffnete vorsichtig die Türe, trat ein und gewahrte einen Tisch, wie zu einem Abendmahl –“
„Aber was hat das alles mit dem Tod zu tun?“ konnte sich Donna Trendina nicht länger zurückhalten.
„Mit einem Gerippe gar nichts“, mußte der Alte zugeben, „aber mit einem Tunnel und Feierabendglocken sehr viel und mit einem einladenden Tisch voller Früchte von dem
Baume des –“
Jedoch – wieder hatte eine Besucherin das glückliche Ende nicht abwarten wollen und war vorzeitig abgereist und grußlos.
© Stiftung Stückwerken, *6.1.2024, freigegeben am 19.1.2024
Qouz-Note 3
***
MamM 1.213 Der Zaubergriffel
„Was meint Ihr, Herr, eh –“, Donna Bollermann war jedoch zu sehr in Fahrt, um sich mit Nebensächlichkeiten aufzuhalten, „was ich mit diesem –, diesem
Waschlappen mitgemacht –“
„Hast du denn keinen andern“, nahm’s der Alte von der Halbinsel wörtlich, „mit dem du dich
–?“
„Ich bin doch keine Ehebrecherin!“ entrüstete sich die Besucherin. „Nein wir werden uns jetzt erst einmal trennen, und in einem Jahr wird dann die Scheidung –“
„Ach, du sprachst von deinem Eheliebsten“, war auch der Alte nicht frei vom Täuschen.
„Eheliebsten? Pah, daß ich nicht lache!“ tat es Donna
Bollermann dann auch nicht. „Liebe? Ja, er meint ja, ohne mich nicht leben
zu können. Vollständig unselbständig dieser Mann. Eigentlich schon
hilflos. Na, der wird sich noch umgucken! Seine Strümpfe kann er künftig
selber –“
„Kann er’s denn?“ witterte der Alte Widersprüchlichkeit.
„Eben nicht!“ verneinte die Besucherin. „Hab’ alles ich
machen müssen; oder unsere Zugehfrau. Aber die wird er sich ja künftig
allein nicht mehr leisten können. Möcht’ nicht wissen, wie schnell der vollkommen verwahrlost –“
„Aber du hast ihn doch mal geliebt; oder?“ verstand’s
der Alte nicht.
„Geliebt?“ Donna Bollermann lachte bitter. „Es muß wohl
Mitleid gewesen sein. Oder eher: Bemutterung. Aber es war alles
vergeblich. Muß wohl schon durch seine Mutter verdorben worden sein: Söhnchen hier, Söhnchen da; und schlafe, mein Prinzchen, schlaf –“
„Hat er denn überhaupt keine guten Seiten?“ fragte der Alte.
„Nö“, brauchte die Besucherin nicht zu überlegen, „sonst täte ich mich von ihm ja nicht scheiden lassen;
oder?“
„Ich kenn’ deinen Mann nicht“, wich der Alte aus, „aber vielleicht –“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger König, der hieß – der hieß Florestan. Klingt jetzt nicht nach Schwergewicht und
Tiefgang, sondern eher nach Leichtfüßigkeit. Ich will ihn jetzt nicht schlechtmachen, allein – daß auch andere Mütter schöne Töchter
haben, schien ihm nicht verborgen geblieben zu sein.
Nicht daß er jetzt andern Frauen nachgestiegen wäre, dazu hast du ja als König kaum Gelegenheit; wenn’s
standesgemäß zuzugehen hat. Jedoch – bei Staatsempfängen zeigte sich Florestan der weiblichen Ausprägung der Herrscherhäuser von einer
ganz besonders liebenswürdigen Seite. Und hinterher, unter 4 Augen, wußte er gegenüber Feya stets
ausnehmend von den anderen Frauen zu schwärmen. Das Einnehmen für diese förderte das bei Feya, seiner Eheliebsten, ganz und gar nicht. Kurz und gut: Der Lack in dieser Ehe war ab, und was darunter zum Vorschein kam, war alles andere als wetterfest.
„Dann geh doch“, schlug Feya eines Abend vor, nachdem wieder ein Besuch abgereist war und den König schwärmend zurückgelassen hatte. „Nimm dir eine Auszeit und reise durch die Welt. Und wenn du eine Frau gefunden hast,
mit der du den Rest deiner Erdentage verbringen willst und kannst, dann komm mit deiner Zukünftigen zurück, und ich werde den Platz hier räumen und euch nicht im Wege stehen.“
Der König war erleichtert über solch eine geräuschlose Lösung und soviel Verständnis. Wenige Tage später
reiste er ab. Dazu erhielt er von seiner Gemahlin sogar noch ein Reisegeschenk: einen sonderbaren Griffel. Der nütze sich nie ab, und damit könne der König alles zeichnen, was ihm in Sinn oder Herz komme. Interessant!
Nun ja, erst einmal steckte Florestan den Griffel achtlos ein, aber schon bald erinnerte er sich dieses Werkzeuges. Freilich – in Reichen, die von einem glücklichen Herrscherpaar regiert wurden, brauchte sich der König gar nicht umzuschauen; aber es gab genügend Herrscherinnen, denen der Gatte abhanden gekommen war. Auch gab
es Regentinnen, die noch keinen Mann abbekommen hatten, aber 1. Wahl wären die nicht gewesen. Dann schon eher eine blühende
Prinzessin. Jedoch – ich greife vor.
Erst einmal geriet Florestan an die Angel einer Witwe. Der schien er gerade recht zu kommen! Wie die ihn anschmachtete! Dieses Leuchten in den Augen! Diese bewundernden Blicke! Als Florestan nach dem 1. Besuch wieder allein war,
entsann er sich seines Geschenks. Er nahm also sein Notizbuch zur Hand, kramte jenen Griffel aus seinem Gepäck, und – hast du nicht
gesehen, war die Herzogin abgezeichnet! Und genau getroffen! Ja, so hatte
Florestan seine Gastgeberin im Sinn!
Allein – nach dem 1. Besuchstag folgten weitere Besuche; und wenn Florestan hinterher seine Zeichnung wieder
zur Hand nahm, entdeckte er mehr und mehr Abweichungen zwischen den aktuellen Eindrücken und seiner 1. Zeichnung. Die Herzogin schien
in ihm nur einen Prinzgemahl zu sehen, der stets hinter ihr zu gehen hatte. Verwunderlich war das nicht, denn Florestan gab sich auf
seiner Reise nicht als König aus, sondern nur als Prinz. Jedenfalls – ihm war’s bei der Herzogin nicht mehr ganz geheuer, und er reiste
heimlich ab und über die Grenze.
Er mußte noch einige Grenzen überqueren, bis er in ein Land und an einen Hof kam, wo er sich wieder an seinen Griffel erinnerte. Dieses Mal hatte er sich was Jüngeres ausersehen: eine Prinzessin im blühenden Alter!
Na ja, du kennst das sicherlich von den Obstbäumen: Gut geblüht, das heißt noch lange nicht: gut gefruchtet.
Deshalb kam es ihm nach seinem 1. Besuch auf dem Schlosse in den Sinn: Zeichne mit deinem Griffel mal, wie die Prinzessin als Königin aussehen sollte. Gedacht, gezeichnet! Jedoch – wer mich kennt, ahnt schon –
„Ich ahne jedenfalls“, konnte sich Donna Bollermann nicht länger zurückhalten, „daß Ihr mal wieder deutlich vom Thema –“
„Ich bin doch noch gar nicht fertig“, versuchte der Alte sich zu rechtfertigen. „Wenn Menschen etwas sollen,
geht’s immer schief. Weil’s eben nichts Natürliches ist. Jedenfalls
entwickelte sich jene Prinzessin überhaupt nicht so, wie’s der König mit seinem Griffel für sie vorgezeichnet hatte. Irgendwann war das
Maß voll, und Florestan reiste heimlich ab. Wohin? Nach Hause! Denn irgendwie sehnte er sich nach jemandem, mit dem er sich über seine Erfahrungen aussprechen konnte. Und zuhören, ja, das konnte Feya. Nachdem er bei ihr seine Gedanken ausgeschüttet
hatte, bat sie um jenen Griffel und zeigte nach wenigen Augenblicken dem König, was in ihrem Herzen war. Florestan staunte. Das war er nicht, wie er war, auch nicht, wie er sein sollte, sondern wie er sein könnte; und das mit Liebe. Ob er so werden wolle? Und bevor er antworten konnte, gab sie ihm Griffel und Papier; nun sei er an der
–“
Allein – die Besucherin war inzwischen gegangen – ohne Zaubergriffel.
© Stiftung Stückwerken, *11.1.2024,
freigegeben am 19.1.2024
Qouz-Note 2-
***
MamM 1.214 Kleemenz
„Wißt Ihr“, meinte es Don Lupino verneinend, „ich gefalle mir in der letzten Zeit oft selber nicht –“
„Du bist inzwischen in das entsprechende Alter gekommen“, versuchte der Alte von der Halbinsel
zu trösten, „da –“
„Das ist es ja eben!“ fand der Besucher keinen Trost.
„Ich hab’ meinen Zenit längst überschritten. Über was soll ich mich noch freuen? Darüber, daß ich von Jahr zu Jahr mehr Fehler mach’? Über mein Doppelkinn, meinen
Buckel, mein Spiegelbild? Daß meine Schritte kürzer und langsamer –“
„Niemand soll etwas“, rieb sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort. „Du kannst das Altern nicht
aufhalten; aber du darfst über dich selber lachen. Kannst du –?“
„Lachen?“ bitterte Don Lupino. „Heulen könnte ich!
Und kann selbst das nicht. Es ist ja nicht nur mein Leib, der zerfällt.
Mehr Kummer macht mir, was die Pfaffen Seele nennen. Da gibt’s keinerlei positive Entwicklung. Eher das Gegenteil! Ihr solltet mich mal fluchen hören! Also, ich gebrauch’ da inzwischen Wörter, die – die wären mir früher nicht über die Lippen gekommen. Überhaupt: mein Jähzorn! Wie soll das alles noch werden?“
„Nichts soll“, versagte der Alte bei diesem Wort Nachsicht, „aber es wird alles gut.“
„Mit welchem Recht könnt Ihr das behaupten?“ brauste der Besucher auf, ehe er’s selber gewahrte. „Da, da seht Ihr’s ja selbst. Ach, ich trau’ mich gar nicht mehr unter die
Leute. Nee, ich halt’s da lieber mit meinen Namensvetter: Wenn ein Wolf merkt, daß es mit ihm zur Neige geht, dann verläßt er das Rudel
und zieht sich in die Einsamkeit zurück.“
„Tscha“, kommentierte es der Alte erweiternd, „aus manchem großen Sünder wird
im Alter ein frommer Klausner. Allein – du hast mich nach einer Rechtfertigung meiner
Zuversicht gefragt“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein Prinz, der – der hieß Klemens; sogar ein Kronprinz! Doch weil er sich von Kindesbeinen an alles andere denn sanftmütig erwies und obendrein noch eigenwillig, schrieb er sich, sobald er’s konnte:
Kleemenz.
Ja, ja, wär’ ich sein Vater gewesen und jemand hätte mir dumm geschwätzt, Kinder seien ein Geschenk, dann hätte ich gekontert, ob ich dieses Geschenk irgendwo umtauschen
dürfe. Kleemenz war laut, aufsässig und stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht, soweit dieser kurzfristig genug war, um vom Prinzen
überblickt und erfaßt zu werden.
Und so einer war dazu ausersehen, einmal König zu werden? Unmöglich! Der Vater sah’s anders; wenn auch seufzend. Jetzt konnte er noch manches ausbügeln, was der Sohn zerknittert hatte, oder dessen Gewissen aufwecken. Aber hätte der Vater erst einmal abgedankt, was hätte dann noch fruchten können?
Jedoch – der König wollte seine Hoffnungen nicht sterben lassen und auch nicht beerdigen, sondern entschied sich für die Schwimmschule kürzester Dauer: Hinein mit dir ins Wasser und dann sieh
selber zu, wie du oben bleibst. Der König schickte also seinen Sohn auf Reisen, sobald dieser volljährig geworden war. Ins Ausland! Zu Fuß und mit Kleidern und Papieren eines einfachen
Wandersmannes. Mit etwas Handgeld zwar, doch ohne Wechsel.
Allein.
Bildungsreise wurde das damals genannt; und Bildung wäre wo zu erwerben? In den großen Städten! So ist’s noch heute herrschende Meinung. Seltsam, daß dort aus der Bildungsreise schnell einen Lümmelreise wird.
Zechen und feiern bis tief in die Nacht: Was kümmert uns die Nachtruhe anderer Menschen! Die werden’s ja
früher auch nicht anders getrieben haben; oder? Sind’s denn reiche oder
sind’s arme Menschen, die dort wohnen müssen, wo oft die Nachtruhe gestört wird? Und ist’s wirklich sicher, daß auch diese früher über
die Stränge geschlagen haben? Aber über so etwas denkst du im Rausch nicht nach. Und verkatert auch nicht; denn dann mußt du dich ja selber bemitleiden.
Kleemenz war jedenfalls voll in seinem Element und setzte in der fremden Stadt fort, was er auch in der Residenzstadt seiner Heimat getrieben hatte. Ja, er entwickelte es zu einem Hintertreiben weiter. Pläne hintertreiben? Nein, alles, was als glückliche Ehe galt. Etwa Flirten mit verheirateten
Frauen? Nö, eigentlich viel schlimmer und verheerender. Kleemenz streute
falsche Gerüchte über die Untreue von Eheleuten. Tscha, was hilft dir als Ehepaar das Bollwerk des Vertrauens, wenn es heimlich
untergraben wird? Unschuld läßt sich in der Regel nicht beweisen; und den
Urheber der Nachrede kannst du meistens nie ermitteln und somit auch nie zur Rede stellen.
Vielleicht hat es dich eben gewundert, als ich von nur einer fremden Stadt berichtet habe, nicht von mehreren.
Nun, Kleemenz war gleich in der 1. großen Stadt hängengeblieben, und Tage und Nächte vergingen ihm wie im Rausch; und zwar derart, daß
es ihm rückblickend war, als hätte er sie überhaupt nicht gelebt. Aber diese rauschenden Feste waren auch der entfernteren
Vergangenheit wie ein Bleichmittel. Wie ist die Zeit vertan!
Zeit ist endlich; das wurde Kleemenz erst bewußt, als er aus dem Ballsaal geworfen wurde, weil er Zeche und
Spielschulden nicht mehr bezahlen konnte. Und in der Gosse landete! Und
niemand wollte sich seiner erbarmen. Die Zeit des Feierns war zu Ende!
Auch die Zeit für ihn in jener fremden Stadt. Also wanderte er aufs Land, wo’s zwar keinen Bettelvogt gibt,
die Bauern Kost und Logis jedoch nur gegen harte Arbeit gewähren. Wollte der Prinz nicht verhungern, mußte er sich als Knecht
verdingen: auf dem 1. Hof, dann auf dem 2. Hof, dann – bei Frau Nette; einer Gärtnerin. Was war das für eine Plackerei und Schinderei! Umgraben, pflanzen, jäten, gießen,
düngen, ernten, und das eigentlich während des ganzen Jahres; denn der Garten war groß und gegen kalte Winde gut geschützt.
O weh, womit habe er so etwas verdient! seufzte er einmal, er habe doch gar nichts verbrochen.
„Nein?“ fragte Frau Nette widersprechend. „Und was ist
das hier?“
Damit führte sie ihren Gehilfen vor eine Wand, an der lauter sonderbare Bilder hingen. Die zeigten das Wirken
des Prinzen in jener Stadt. Menschen hatte er durch seinen nächtlichen Lärm das Leben verkürzt, andern durch seine üble Nachrede die
Ehe zerbrochen, und immer wieder hatte er andern Zeit gestohlen; sogar sich selber. Ob dies durch ein sich mehr und mehr leerendes Stundenglas am unteren Rand der Bilder –?
„Eben! So weit bin ich auch“, konnte sich Don Lupino nicht länger zurückhalten: „Niederschmetternde
Diagnose; aber nirgendwo Heilung!“
„Joa“, sah’s der Alte zuversichtlicher, „wenn einer nichts mehr hat, dann müssen ihm Gaben eben geschenkt werden. Und dafür Aufgaben, die dir Freude machen, und Raum zum Teilen. So auch bei
Kleemenz. Und als ihm Frau Nette auch noch jene Frucht gab, welche den Augen die rechte Ansicht von den –“
Allein – auch dieser Besucher hatte nicht bis zum guten Ende bleiben wollen.
© Stiftung Stückwerken, *18.-19.1.2024, freigegeben am 26.2.2024
Qouz-Note 3-
***
MamM 1.215 Nach diesen schönen Tagen
„Wir haben am Sonntag auch dieses – dieses Kinderlied gesungen“, wußte Donna Freudenaug zu berichten, „ich sing’ es sehr gerne. Doch dann hab’ ich gegen Ende gesungen: nach diesen schönen Tagen; aber da hat mich mein Enkel angestoßen und gezeigt, das heiße: nach diesen Erdentagen. So steht’s im Gesangbuch. Und jetzt bin ich richtig verunsichert. Bin ich denn schon so –“
„Nein“, versuchte der Alte von der Halbinsel zu beruhigen, „nicht du bist durcheinander, sondern
diejenigen sind’s, die an dieses Kinderlied Hand –“
„Aber es steht doch so drin“, nahm’s die Besucherin nicht an.
„Leider“, mußte der Alte zugeben, „seit 20 Jahren; aber im Original heißt es so, wie du es gesungen hast. Ich weiß auch nicht, was und wer die geritten hat, ein Kinderlied zu entfreuen. Es
ist nicht das einzige in –“
„Aber was soll ich denn jetzt singen?“ war Donna Freudenaug genauso schlau wie
vorher, aber auf höherer Warte.
„Niemand soll etwas“, rieb sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort. „Wenn du alleine singst oder mit
deinen Enkelkindern, dann halt dich an das, was in deinem Herzen lebt. Und in der Kirche? Dazu kenn’ ich dich zuwenig; auch nicht deine Banknachbarinnen. Mach’s auch da, wie’s in deinem Herzen lebt; ich denke, dir wird niemand etwas
Destruktives –“
„Macht Ihr das auch so?“ forschte die Besucherin.
„Ach, ja“, seufzte der Alte, doch lächelnd, „ich stifte schon genug Unruhe. Von den 400 Liedern unseres
heutigen Gesangbuches kann ich kaum 10 von Herzen mitsingen, über 50 gar nicht (wegen ihres unchristlichen Textes oder wegen ihres grauenhaften Tonsatzes),
und bei den andern schweig’ ich, wenn ich Text oder Tonsatz nicht mit meinem Gewissen vereinbaren –“
„Ist das nicht sehr ketzerisch?“ wandte Donna Freudenaug ein. „Also, wenn ich mich in der Kirche umgucke, da singen sie alle, als wär’s – als wär’s ein Sängerwettstreit.“
„Eben!“ schmunzelte der Alte. „Und dein »ketzerisch«
ehrt mich sogar, und Ketzer bilden eben nur eine kleine Minderheit. Allein – das mit dem Kinderlied läßt mir keine Ruhe“, und er begann
zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger Mann, der – der hieß Ander. Von Mutter und Vater wußte er nichts. Sie seien tot, war ihm immer wieder gesagt worden. Aber niemand kannte ihr Grab, und
auch über die Todesumstände war nichts Sicheres bekannt. Dennoch brauchte Ander nicht zu darben; irgend jemand sorgte für ihn.
Das mochte auch an einer besonderen Begabung liegen. Soweit Ander nämlich zurückdenken konnte, war sein
liebster Zeitvertreib: auf seiner Geige zu spielen. Während andere mißmutig Tonleitern übten, als wollten sie alle Töne zu Grabe
tragen, spielte Ander, als täten ihn die Klänge wie eine Lerche hoch in die Lüfte tragen. Und selbst wenn seine Geige klagte, war’s
nicht niederdrückend, sondern gleich einem starken Arm, der aufrichtet und aufhebt. Ja, in seiner Geige fand Ander großen Trost, so daß
es ihn nicht bekümmerte, wenn er in den Ferien zu den wenigen im Internat gehörte, die dableiben mußten. Wie ich bereits sagte: Irgend
jemand sorgte für Ander, aber ein Zuhause, wo ihn liebe Eltern erwarteten, hatte der Junge nicht. Sein Zuhause war die Musik und blieb
es auch, als seine Internatszeit zu Ende ging.
Eigentlich traf sich das gut; denn so konnte er sein Zuhause immer mitnehmen, selbst wenn er auf Reisen
ging. Und das tat er nun auch und lange. Alle Welt wollte diesen Geiger
hören, dessen Spiel starre und trübe Augen wieder wacker zu machen wußte und kalte Herzen aufwärmte.
So kam er eines Tages auch in ein Residenzstädtchen, in dem irgend etwas zu fehlen schien. Irgendein
Klang; aber welcher? Das Rasseln der Fuhrwerke? Die machten hier auf den Gassen genausoviel Lärm wie anderswo. Die Vögel? Nun ja, dem geübten Ohr des Musikers fiel da schon ein Unterschied auf: Hier war das Repertoire dürftiger, aber immerhin: Auch hier sangen die
Vögel. Die Kinder? Ja, das war’s: die Kinder! Kein Kinderlachen war hier zu hören, kein Kindersingen, noch nicht einmal der Lärm von ausgelassenen Kinderspielen.
„Gibt es hier keine Kinder?“ fragte Ander bei nächster Gelegenheit den Herbergswirt.
„Doch, doch, der Herr“, antwortete der Wirt, „aber dat sind allens Stubenhocker.“
„Wie das?“ wunderte sich der Geiger.
Das sei 'ne lange Jeschichte; aber wenn’s den jungen Mann int'ressiere?
Und da dieser nickte, fuhr der Wirt fort. Anjefangen habe alles, als ihnen ihr König plötzlich abhanden
gekommen sei. Etwa 20 Jahre sei dat wohl her. Da hätten sie von eenem Tag auf den andern 'nen Reichsverweser bekommen. Und der habe
irgendwann – also, dat sei bestimmt ooch schon 3 Jahre her; – eh, der habe anjeordnet, alle
Kinderschuhe einzuziehen. Basta! Ein Grund sei dafür nicht anjejeben
worden. Da hätten alle Kinderschuhe abjejeben werden müssen, selbst die auf den Speichern oder die als Tinnef auf Regalen oder in
Schränken oder an den Pfoten der Stofftiere überlebt hätten. Tscha, da hätten die Kinder nur noch die Schuhe der Erwachsenen
jehabt; aber die seien viel zu groß, so daß sie, die Kinder, darin außer Haus jar nicht hätten loofen können. Aber wozu ooch? Die Zeit der unschuldijen Kinderspiele sei vorbei jewesen. Ooch die Schulzeit. Seitdem heeße es: arbeiten; und dat von Kindesbeenen an. Und Singen? Nee, keene Kinderlieder nich’, sondern Arbeitslieder! Nur 'ne eenzije Gruppe von
Kindern habe passende neue Schuhe bekommen; und zwar die Kinder, die se unter die Soldaten jesteckt hätten. Aber dat seien keene neuen Kinderschuhe jewesen, sondern eben Soldatenstiebel. Und
nun wisse der junge Herr, weshalb hier seit 3 Jahren keene Kinder mehr lachten, sängen oder lärmten. Na ja, dat habe auch sein Jutes:
Die Jäste hätten hier mehr Ruhe; und in der Jaststube hätte schon vorher keen Kind wat zu suchen jehabt. Aber wenn er’s recht bedenke: Zumindest an den Ruhetagen fehle irjend etwas. Aber er
könne eben nicht alles haben; entweder es regne, oder es scheine die Sonne; beides –
Aber es gibt einen Regenbogen, dachte Ander, hatte genug gehört und ging auf sein Zimmer. In der Nacht lag er lange wach; aber dann: Träumte er? Oder wachte er? 2 Bären traten an sein Bett, der eine heiße Bimbor, aber das R sei stumm, und der andere Alex, und die brummten eine sonderbare Melodie. Und diese Melodie möge er, Ander, morgen unter den Fenstern –
„Und was hat das alles mit meinem Kinderlied zu tun?“ konnte sich Donna Freudenaug nicht länger
zurückhalten.
„Auch eine Geige kann singen und Klänge geben, wo diese ausgegangen sind“, rechtfertigte sich der Alte.
„Am nächsten Morgen tanzte jedenfalls bald die ganze Stadt auf den Gassen, die Kinder sogar barfuß und mitsingend. Und selbst der Reichsverweser wußte nicht, wie ihm geschah: Ob er wollte oder nicht, er mußte einfach in den Kerker hinabsteigen und 2 Gefangene,
eine Frau und einen Mann, freilassen. Und diese 2 Gefangenen, ob sie wollten oder nicht, konnten sich einfach nicht rächen, sondern
–“
„Das ist mir zu hoch!“ gestand die Besucherin ein und ging grußlos hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *25.1.2024, freigegeben am 27.2.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.216 Nachtmeister Stropp und das Unrecht im Amt
„Was ist eigentlich ein Serienmörder?“ wollte unser Bruhno wissen. „Ist das ein industriell hergestelltes –?“
„Das Produkt einer mit Fleiß betriebenen Ruftötung“, antwortete unser Stropp. „Wollten wir Unrecht mit Unrecht
vergelten, so könnten wir’s sogar Rufmord –“
„Aber ein Serienmörder ist auf jeden Fall ein Mörder“, wollte der kleine Bär festgehalten wissen.
„Nein“, widersprach unser Nachtmeister. „Es gibt keine Mörder. Oder wir sind alle –“
„Aber wer einen Mord begangen hat“, folgerte die Lernkraft, „der muß doch einen Namen –“
„Da ist schon die Voraussetzung fragwürdig“, wandte unser Igel ein. „Was ist Mord? Früher wurde darunter ein vorsätzliches Töten verstanden, –“
„Dann wären also auch Soldaten Mörder“, dachte unser Bruhno weiter.
„Sie sind so auch schon genannt worden“, gab unser Held zu, „allein – hat’s einen einzigen Krieg verhindert?
Kehren wir zum Mord als einem mehrdeutigen Begriff zurück. Zum Vorsatz kamen später auch noch niedrige Beweggründe als notwendige
Voraussetzungen hinzu. Jedoch – was sind niedrige Beweggründe? All’ diese Überlegungen unterstellen etwas, was meistens
verschwiegen wird: 1., daß sich Warum-Fragen hinreichend beantworten ließen; 2., daß sich Beweggründe gewichten ließen; und 3., daß es eine Alleinschuld gebe. Von diesen 3 Unterstellungen halte ich
keine für wahr, deshalb gibt es für mich keinen Alleinschuldigen und rückschauend weder Mord noch Mörder.“
„Dann wäre somit unser Beruf völlig überflüssig“, maulte der kleine Bär, „oder?“
„Wir können kein einziges Verbrechen ungeschehen machen“, redete unser Stropp nicht um den heißen Brei herum.
„Und ob Strafe ein Ausdruck von oder wenigstens ein Mittel zu mehr Gerechtigkeit ist, also – die Tür wollen wir jetzt nicht aufmachen.
Aber wenn du und ich dazu beitragen, daß ein einziges Verbrechen gar nicht erst –“
„Herr Nachtmeister! Herr Nachtmeister!“ versuchte sich
eine Stimme Gehör zu verschaffen. Mit Erfolg!
„Was gibt’s, Herr Paruvotti?“ fragte unser Igel. „Ihr
seid gar nicht auf Tournee?“
„Bleibe im Lande und nähre dich redlich“, wurde Herr Kohlmeise biblisch. „Aber das ist es ja gerade, weswegen ich hier bin: An meinem Stammfutterplatz lungert in der letzten Zeit ein großer Vogel herum. Viel größer als ich; ja, sogar noch größer als ’ne Amsel; aber keine Krähe, die tät’ sich ja im Sprechgesang üben. Nee, dieser Fremde singt
überhaupt nicht. Richtig unheimlich! Und einen stechenden Blick hat der,
als kenne er keine Barmherzigkeit nich’. Ich und meine Vettern haben richtig Angst und trau’n –“
„Kann Angst jemals richtig sein?“ schien unser Held heute auf den Pfaden des großen Vielosovierers Mecki Immerfroh
zu wandeln, besann sich aber dann seine Amtes: „Kommt jener Fremde meistens nachts? Oder –? Ach so, nachts –“
„Meistens am frühen Morgen“, antwortete Herr Paruvotti. „Aber danke für das Stichwort. Da müßte auch endlich mal eine Amtsperson etwas dagegen tun. Schon seit Montag wird
immer wieder unsere Nachtruhe durch lautes Trompeten –“
„Ach, die Kraniche“, lachte unser Nachtmeister. „Uns stören sie eigentlich die Tagruhe, aber dann denk’ ich:
Es sind ja Herolde des Frühlings; jedenfalls in den nächsten Wochen. Nee,
Herr Paruvotti; dagegen was zu tun, das könnt’ ich nicht übers Herz bringen. Könnt Ihr nicht die Klänge aufgreifen und daraus ein fröhliches Frühlingslied –“
„Aber doch nicht des Nachts!“ fühlte sich der Vogel unverstanden. „Es ist doch immer das gleiche: Brauchste mal einen Staatsdiener, dann –“
„– wird er sich das morgen früh mal angucken“, ergänzte unser Nachtmeister. „Wo war das noch mal?“
„Morgen früh wird’s etwas länger“, versuchte unser Stropp seine Eheliebste wenig später behutsam vorzubereiten. „Kannst ruhig schon mal zu Bett –“
„Ach so!“ zeigte sich Frau Struppe verstimmt. „Mein
Göttergatte findet nicht mehr den schnellsten Weg nach Hause, und ich soll dabei ruhig –“
„Vielleicht kann ich die Überminuten ja irgendwann abfeiern“, versuchte es der Gatte mit Hoffnung als Arzneimittel.
Allein – wir wollen Ehestreitigkeiten nicht auswalzen; und wenn sich beide Seiten ein kindliches Herz bewahrt
haben, begründen jene keine chronischen Leiden. So auch hier.
Wir eilen also geschwind zum nächsten Morgen, an jenen Stammfutterplatz, treffen dort unseren Nachtmeister, seine Lernkraft und den
Waschbären Wastel und – jenen geheimnisvollen Vogel, aber keinen einzigen Hinweis auf ein belastetes Gewissen. Im Gegenteil!
„Ach, Kollege Stropp“, wurden unsere 3 Freunde begrüßt und sortiert. „Was willst du denn hier? Endlich mal lernen, Verbrecher zur Strecke zu bringen und auszumerzen?
Was? Wie? Hahaha!“
Einen sympathischen Eindruck hinterläßt solch eine arrogante Jovialität bei unseren Freunden bekanntlich nicht.
Übte sich unser Igel in diplomatischer Zurückhaltung, so rutschte es dem kleinen Bären hinaus: „Und du da oben, du kannst meinem Lehrherrn noch nicht mal das Wasser
–“
„Bürschchen“, drohte der Fremde, „werd nicht frech! Ich habe hier Polizeigewalt und Gerichtsgewalt und kann
dich auf der Stelle –“
„Auch die Befugnisse des Scharfrichters?“ mischte sich unser Held blitzschnell ein.
„Selbstverständlich!“ tappte der Fremde in die gestellte Falle.
„Pfui! Hinrichten ist schreiendes Unrecht!“ widerte so
etwas unseren Nachtmeister bekanntlich an.
„Unrecht?“ lachte der Fremde. „Hier ist Herr
von Schergewski das Recht; und der bin ich! Verstanden?“
„Nö“, liebte unser Stropp die Wahrheit. „Von unserm Friedensrichter könnt Ihr dieses Recht nicht haben, denn
der achtet wenigstens auf ordentliche –“
„Was schert mich euer Friedensrichter?“ spottete der junge Falke verneinend. „Ich hab’ meine Privilegien vom Königshaus –“
„Wer sich aufbläht“, kommentierte es unser Igel später zu Hause, „der verplappert sich schneller. Wir haben
ihn also reden lassen, und dabei kam heraus, daß er sich für einen Kriegsherrn halte, der uneingeschränkt Kriegsrecht anwenden dürfe.
Auf welcher Grundlage? Auf Erpressung! Denn er hatte Zaunkönigs gedroht,
ihnen sonst mit seinen scharfen Fangdolchen zu Leibe zu rücken. Und am Futterplatz liege er auf der Lauer, um bereits
Majestätsbeleidigungen ausfindig zu machen und mit dem Tode bestrafen –“
„Aber das ist ja ungeheuerlich!“ entsetzte sich Frau Struppe. „Kannst du denn dagegen gar nichts –“
„Wir können ihn lediglich vertreiben“, schränkte unser Held ein. „Unser Wastel hat ihn bereits verschreckt,
aber fliegen kann er ja nicht. Doch in der Nähe wohnt der Schlendertünnes, und der hat uns
geraten, mal dem Krähenvolk einen Tip zu geben; ansonsten könnte ich diesen irrsinnigen Falken mal zu unserer nächsten Vegetariermesse
einladen. Vielleicht kommt er da auf einen anderen Geschmack. Wünschen
wir’s ihm in zuversichtlicher Hoffnung!“
© Stiftung Stückwerken, *2.-3.2.2024, freigegeben am 28.2.2024
Qouz-Note 3
***
MamM 1.217 Haltbare Brücken
„Ach, ja“, ließ Donna Seinunger ihre Augen versonnen in die Vergangenheit schauen, „es war wieder sehr schön. Und zum Schluß haben wir gesungen: Nimm dir all mein Gut und Geld, –“
„Ist das nicht inzwischen eingeschränkt worden auf allen Überfluß?“ gehörte der Alte von der Halbinsel bekanntlich zu den schärfsten Kritikern aller môdernen Neuerungen.
„Mag sein“, war’s der Besucherin nicht wichtig, „ich hab’s aus dem Kopf gesungen –“
„– und nicht aus dem Herzen?“ war der Alte anscheinend am Morgen mit dem falschen Bein
aufgestanden.
„Doch, doch“, widersprach Donna Seinunger energisch, „das ist ja gerade das Besondere in unserer Kirche: Wir singen alle Lieder mit Inbrunst und aus dem –“
„Und wer hat nun all dein Gut und Geld angenommen?“ konnte der Alte seine Skepsis nicht unterdrücken.
„Na, niemand“, war’s der Besucherin eine sehr dumme Frage, „es ist ja dem HERRN geweiht, und dann darf ich’s aus seiner Hand –“
„Ach so“, tat der Alte erhellt, „deshalb die prächtigen Kutschen vor der Kirche – Und alle dem lieben Gott –“
„Seid Ihr etwa neidisch“, argwöhnte Donna Seinunger, „weil Ihr Euch keine Kutsche leisten –?“
„– und dem HERRN weihen könnt?“ ergänzte der Alte.
„Nö. Ich bin dankbar, daß ich überhaupt keine Kutsche brauche.“
„Na, das sehen wir in unserem Frauenkreis ein bißchen anders“, hielt die Besucherin dagegen. „Ihr habt Euch in
den letzten 4 Jahren sehr selten gemacht in unserer Kirche. Das sieht nicht danach aus, als hättet Ihr’s praktiziert: All meine Zeit, Seel’ und Leib ich allein dem HERRN verschreib’.“
„Richtig!“ gab der Alte zu. „Und ich hab’s noch nicht
einmal versprochen; denn das Gute in mir bedarf nicht solcher Versprechen, und dem Bösen täten sie die Sünden vermehren“, und er begann zu
erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß – der hieß Siebenwört; frag mich jetzt
nicht, was sich sein Vater bei diesem Namen gedacht hat. Gleiches gilt anscheinend auch für den Schwiegervater; denn der hatte seiner Tochter den Namen Aphrothippe gegeben. Aber
die Namen hatten die beiden Kinder – selbstverständlich erst im passenden Alter – nicht davon abgehalten, den Ehebund miteinander zu schließen. Sie hatten also vor Gott und der Welt öffentlich gegenseitige Treue gelobt und in allen Verhältnissen einander beizustehen und in Liebe
miteinander den Lebensweg zu gehen; jedenfalls das zu wollen. Und das
Engelchen in ihnen hatte dazu laut und vernehmlich ja gesagt; das Teufelchen in ihnen hatte geschwiegen.
Nun war aber Aphrothippe eine sehr schöne Frau von Gestalt und Siebenwört nicht der einzige Mann auf Erden, ja, noch nicht einmal der einzige König. An Freiern hatte die Schöne keinen Mangel gehabt, und ob Siebenwört der beste Ehemann für sie war, – welcher Mensch vermag das auf Erden zu
beantworten? Jedenfalls – auf Aphrothippe schien die Rolle der Penelope gut zugeschnitten
zu sein; allerdings mit ungewissem Ausgang. Und dieses Ungewisse machte
Siebenwört mehr zu schaffen denn seiner Eheliebsten.
Irgendwie fühlte er sich als Mond, der seine Sonne umkreiste und nur ihr seinen Schein zu verdanken habe. Und
– eben nicht der einzige Mond! Also? Also fing der junge Ehemann an, zu
schenken. Jedes Jahr mehr, gemessen in Talern und Dukaten. Und als er den
Thron erbte, erst recht. Nicht seinen Untertanen, sondern eben seiner Sonnengöttin. Anscheinend kannten die damals noch keine gemeinsame Ehekasse, oder, vielleicht sogar und, der Reichskämmerer war nur auf den König vereidigt
worden.
Tscha der Kämmerer! Der betreibt keine Münze und auch keine Notenpresse, sondern verwaltet nur das, was ihm
gegeben wird. Wenn aber der König von Jahr zu Jahr seine Ausgaben für Geschenke erhöhte, dann –? Dann mußte er auch für höhere Einnahmen sorgen. Und wie? Mehr Banknoten drucken? Nee, dieser Schuß wäre nach hinten losgegangen und hätte die
Preise steigen und das Volk verarmen lassen. Also? Schulden
machen? Die sind nicht umsonst zu haben und müssen irgendwann zurückgezahlt werden, verlangen Zinsen und – fordern
Kreditwürdigkeit. Nun hat zwar ein König äußerst viel Würde, aber jeder Kredit hebt die Schale jener Würde höher und höher, bis diese
ein sehr luftiges Ansehen gewinnt und niemand mehr gewillt ist, etwas auf die Schale der Schulden zu legen. Die Folgen? Schlaflose Nächte!
Also? Also verstärkt sich die Neigung, diese Nächte nicht im Bett zu vergrübeln, sondern am Spieltisch zu
verübeln. So – leider auch Siebenwört. Wer aber gewinnt auf Dauer am
Spieltisch? Die Bank! Die wurde zwar durch das Königliche Schatzamt
besteuert, aber dies ist bekanntlich nur ein Bruchteil dessen, was sie zuvor den Spielern abgenommen hat. Somit ward der Spieltisch dem
Königsschatz nicht zur erhofften Quelle, sondern zu einem zusätzlichen Abfluß. Was nun?
An Ratgebern gebrach es dem König nicht; vor allem unter den Direktoren der Wechselbanken. Und wer gewissenlos mit Nahrungsmitteln spekuliert, hat kaum noch Skrupel, mit Menschen zu handeln. Nein, dem König wurde jetzt nicht empfohlen, auf Sklavenjagd zu gehen; nö, äußerst
harmloser: Untertanen als Soldaten auszuleihen. Nee, nicht umsonst, aber Leihen hört sich schöner und harmloser an denn
vermieten.
O weh! Schulden, Spielsucht, Soldatenhandel, da rast ein Zug unwohl ungebremst auf den Abgrund zu! Wer kann da noch die Notbremse ziehen? – Nur eine
Königin! Und Aphrothippe war eine Königin, und zwar eine resolute! Sie gab ihrem Gatten kurzerhand dessen
Eheversprechen zurück; denn wenn er seine Versprechen nicht halten könne, dann möge er’s mit dem Halten mal ohne Versprechen
versuchen.
In einer Räuberbande? Nein, in Siebenwört wohnte ja nicht nur ein Teufelchen, sondern auch ein Engelchen, und
das riet dringend davon ab, eine Wechselbank oder eine Versicherungsgesellschaft zu gründen. Freilich – bei Tisch und Bett war er von
Aphrothippe getrennt, aber nicht von der Königin Augen und –
„Aber was hat das jetzt alles mit jenem Lied zu tun“, konnte sich Donna Seinunger nicht länger zurückhalten, „und damit, sein Leben ganz dem HERRN zu –“
„Tscha“, ließ der Alte ein nachsichtiges Lächeln mit einfließen, „wenn dir oder mir das Halten wichtiger wird denn das Versprechen und ich in meinem Herzen mehr auf das
Engelchen höre, dann baut es mit Brücken zu Herzen, über die ich geben kann, was ich habe, und über die das andere Herz mir geben kann, was es hat, mir aber mangelt. Und seltsam: Je mehr über diese Brücken ausgetauscht wird, desto haltbarer –“
Jedoch – wieder war eine Besucherin vorzeitig gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *9.2.2024, freigegeben am 29.2.2024
Qouz-Note: 4
***
MamM 1.218 Tierhaltung – anders
„Stimmt das“, wollte sich Donna Sofata vergewissern, „Ihr wäret ein Wege-, Wegetoller; oder wie
das –“
„Ein Wegetoller?“ rätselte der Alte von der Halbinsel. „Ja, hin und wieder bin ich schon etwas verwirrt; liegt wohl an meinem –“
„Nein“, schloß die Besucherin die Verwirrtheit des Alten damit nicht aus, „ich mein’ so einen, der kein Fleisch nich’ ißt.“
„Ach, du meinst Vegetarier“, konnte der Alte weiterhelfen. „Nö, nicht immer, aber wohl an den meisten Tagen im
–“
„Aber warum?“ konnte es Donna Sofata nicht begreifen.
„Selbst Jesus hat mit einer Schweinshaxe –“
„Einem Lamm“, verbesserte der Alte. „Aber du hast recht: Von den 3 orientalischen Weltreligionen läßt sich
kein allgemeines Verbot –“
„Na, also!“ fühlte sich die Besucherin bestätigt. „Schon
im Rechtswesen sind Tiere lediglich Sachen, hab' ich mal gehört. Und unser Herr Pfarrer meint, es stehe schon in der Bibel: Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise.“
„Nach der Sintflut!“ schränkte der Alte ein. „Vor der
Austreibung aus dem Paradies, im Schöpfungsbericht, ist nur vom Kraut und den Früchten der Bäume die Rede als Speise für Tiere und –“
„Herrschet über alle Tiere! hab’ ich im Kinderunterricht gelernt“,
ließ sich Donna Sofata nicht beirren, „und wer herrscht, ist sou-, souterrain –“
„Souverän“, verbesserte der Alte nachsichtig. „Selbst ein Souverän kann an das Recht gebunden sein. Und an Gesetzmäßigkeiten.“ Und er begann zu erzählen:
Am beliebtesten sind wohl die Märchen, welche eine Brautwerbung zum Thema haben. Also will ich’ auch dieses
Mal entsprechend einkleiden. Es wär’ einmal ein Prinz, der – der hieß Florio. Das klingt nicht nach Stubenhocker oder Erbsenzähler, sondern eher nach Luftikus. Wen wundert’s, daß er sich in eine Prinzessin verknallte und an nichts anderes mehr denken konnte, als diese als seine Braut
heimzuführen. Nun ja, ist so eine Redensart und übertreibend, aber letztendlich wanderten seine Gedanken immer wieder dorthin,
wenn er ihnen freien Lauf ließ.
Allein – was hilft der schönste Köder, wenn er einen Haken tarnt! Und der trat bei Prinzessin Bratella zutage, nachdem sie sich auf ihres Vaters Königsthron gesetzt hatte: Das Reich versank im Chaos! Es
kam sogar so weit, daß sie sich in ihrem Schloß verbarrikadieren mußte und dem ihre Hand versprach, der sie aus dieser mißlichen Lage erlöse und das Land wieder zur Ruhe bringe. Was war geschehen?
Das fragte sich Florio auch und wanderte in jenes Land. Und kaum hatte er die Grenze überschritten, sah er
auch schon die Bescherung: Die Tiere, die bisher unter den Menschen gelitten hatten, waren nicht nur in den Ausstand getreten, sondern – hatten den Spieß umgedreht.
Im zoologischen Garten saßen keine Löwen, Tiger oder Affen hinter Gittern, sondern sie spazierten belustigt an den Käfigen vorbei, in denen ihre früheren Wärter zur Schau
gestellt wurden. Sehr beliebt war dabei die tägliche Menschenfütterung;
natürlich mit Fleisch, aber nicht von Tieren. Und das alles eingebettet in erzieherische Maßnahmen: Fleisch als Belohnung für besondere
Kunststückchen; Fleischentzug als Strafe für Ungehorsam oder Scheitern.
Auch auf den Bauernhöfen hatte sich vieles verändert. Den Pflug zogen keine Pferde oder Rinder, sondern Bauer
und Knecht. Im Kuhstall – Nein, da sträubt sich jetzt alles, denn das zu erzählen, das wäre nicht mehr jugendfrei. Jedenfalls ging es dort sehr zugig zu, wie wir’s ja von Rinderställen heutzutage gar nicht mehr anders kennen. Und zu fressen gab es Stroh genug, das in lange Tröge gelegt wurde; dahinter standen
dann Tag und Nacht die Menschen, mit ihren Köpfen eingezwängt. Die Hühnergefängnissse waren zu Menschenzuchthäusern umgewidmet worden:
jeder Mensch in einer kleinen Einzelzelle, nur durch Drahtgeflecht von den Nachbarn getrennt; und unter sich ein festes Eisengitter für
die Notdurft. Freilich – wer in diesen Zuchthäusern als Knäblein geboren wurde, hatte anfangs nur sehr geringe
Überlebenschancen. Wobei wir bereits bei einem entscheidenden Denkfehler etlicher Tiere angelangt sind: Menschen legen nämlich keine
Eier! Aber sie wissen, Schokoladeneier herzustellen, erinnerte sich ein alter Hahn, und siehe da: Einige Menschen hatten’s nicht
vergessen und konnten die andern unterweisen, und schon bald konnten sich die ersten Tiere ihren Feierabend mit Schokoladeneiern versüßen; und es wurden immer mehr.
Aber auch in den Städten gab es große Veränderungen. Am wenigsten einschneidend für Katzenfrauchen; denn die bekamen allenfalls ein Glöckchen um den Hals. Bisherige Hundehalter mußten da schon mehr
umdenken. Sie wurden 3mal am Tage ausgeführt, mußten dann draußen ihr Geschäft verrichten, und wehe, sie waren nicht
stubenrein! Aber immerhin hatten sie noch ein bißchen Auslauf. Wer jedoch
einen Vogelbauer besaß, einen bisher bewohnten, mußte nun ins Innere umziehen, ja, und das Singen lernen.
Tscha, und im Wald? Auch da ging’s nun anders herum. Den Jägersleuten wurden alle Waffen abgenommen, und dann wurden sie waidtierisch gehütet: also am Ausbrechen gehindert, im Winter gefüttert und
außerhalb der Schonzeiten gehetzt, gejagt und zur Strecke gebracht – in einem sogenannten fairen Wettkampf.
Als Florio das nach und nach alles entdeckte – natürlich immer unter Lebensgefahr –, war er entsetzt: Das war ja hier Mord und Totschlag! Aber anscheinend alles Rechtens. Kein einziges Tier wurde zur Verantwortung
gezogen! Ja, die Tiere prahlten sogar mit ihren Untaten, jagten nach neuen Häftlingen für ihre Anthropos und Zuchthäuser und schmückten
sich mit Jagdtrophäen.
O weh! Was konnte Florio da ausrichten? Augen
auf! Und Verbündete suchen! Denn siehe da: Nicht alle Tiere hatten sich an
dem Aufstand beteiligt. So hatten viele Vögel gar nichts gegen die Menschen, solange diese nicht rücksichtslos in ihren Kutschen über
die Chausseen rasten. Und die Schafe hatten keine Lust, ihren Hirten zu weiden, sondern wollten alles beim alten belassen. Florio zog also nach und nach Erkundigungen bei allen Gegnern des Aufstandes ein und bei allen –
„Aber Ihr zeigt es ja selber“, konnte sich Donna Sofata nicht länger zurückhalten: „Wenn der Mensch nicht mehr über die Tiere regiert, entsteht das –“
„Diese Folgerung ist gar nicht so abwegig“, gab der Alte zu, „doch das Rad wieder zurückzudrehen – hätte das wirklich einen dauerhaften Frieden gebracht? Die friedliebenden Tiere hatten da bessere Vorschläge. Sicher, es gab auch den
Vorschlag, die anderen Tiere uneins zu machen und gegeneinander aufzuhetzen. Aber vor allem Rotkehlchen und Igel warnten überzeugend
davor, weil es alles nur noch schlimmer mache. Nein, entwickelten sie ihre Strategie, erstlich müßten Tiere und Menschen in Freiheit
leben können, zweitens partnerschaftlich auf Augenhöhe, und drittens hätten sie von einem Nachtmeister gehört, der Gemüse-Obst-Messen veranstalten wolle. Und wenn dort Tiere und Menschen auf einen neuen Geschmack kämen, dann wäre alles Jagen und Schlachten –“
Doch das hörte die Besucherin schon nicht mehr; sie war gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *16.2.2024, freigegeben am 1.3.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.219 Zauberhafte Demenz
„Habt Ihr das auch gelesen?“ zeigte sich Donna Fähnerich mitteilend: „Wer heute geboren wird, hat dann
mindestens 120 Jahre vor –“
„Herzliches Beileid!“ ließ der Alte von der Halbinsel eine Antwort
offen. „Nee, so viele Jahre, das tät’ ich nicht –“
„Braucht Ihr ja auch gar nicht“, sah’s die Besucherin als Trost an. „Aber es zeigt den ewig Gestrigen mal
wieder: Es wird immer –“
„Immer? Alles?“ zweifelte der Alte sehr.
„Und wie weit die Wissenschaft inzwischen ist“, überrannte Donna Fähnerich die Zweifel.
„Jaha“, lachte der Alte, „von einem Irrtum zum nächsten.“
„Das hört sich ja fast so an“, argwöhnte die Besucherin, „als sehntet Ihr Euch in das Zeitalter des Sonnenkönigs –“
„Der?“ griff’s der Alte auf. „Nee, mit dem möcht’ ich
nicht tauschen. Und ich will auch nicht behaupten, früher sei alles besser –“
„Na, also!“ fühlte sich Donna Fähnerich bestätigt. „Ihr
gebt also zu, daß alles –“
„Nö“, eselte der Alte, „das hab’ ich nicht gesagt und sag’ es auch nicht. Manches ist angenehmer und bequemer
geworden, das räume ich gerne ein; jedoch – sehen die Menschen glücklicher aus?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger König, der – der hieß Waltherr; also schon vom Namen her: ein herrschender
Herr. Kein Wunder, daß er bereits vor der Thronbesteigung an strengen Richtlinien arbeitete, wie er sein Volk regieren müsse. Ja,
du hast richtig gehört: Die meisten Herrscher meinen herrschen zu müssen. Und diese Rechtfertigung richtet sich nicht nur nach außen,
sondern auch gegen das eigene Gewissen. Allein – wie regierst du ein Volk am besten?
Eine Königin wäre zu ihrer Fee gegangen, zu ihrer guten Fee, und hätte dort Rat eingeholt. Waltherr jedoch
ging zum KD Murkski, einem gewaltigen Erzzauberer, um sich dort seine Pläne absegnen zu lassen.
Ein gewandter Diplomat war dieser KD Murkski nun nicht, denn er fegte erst einmal alle königlichen Pläne vom Tisch: Nein, nein, so bekomme der junge Herr König sein Volk
niemals in den Griff und verausgabe sich. Nein, ihm sei deshalb zu raten, ein paar Rechte und etwas Macht abzugeben. Nicht an alle, sondern es reiche, einen Kaufmann, einen Handwerker und einen Arzt mit Sondermacht auszustatten. Ja, am besten mit einem kleinen Zauberstäbchen. Hier – hier seien 4: Davon könne er
den längsten für sich behalten und die andern 3 verteilen.
Der junge König war derart verblüfft, daß er dem Erzzauberer die vernichtende Kritik nicht übelnahm und dankbar und hoffnungsfroh mit den 4 Zauberstäben auf sein Schloß
zurückkehrte. Noch in der Nacht wurden die 3 künftigen Unterzauberer ausgewählt, und bereits am nächsten Abend konnten sie ihren
Zauberstab in Empfang nehmen. Und nun?
Kaufmann Glattzkes liebstes Kind war schon immer –? Der
Ersatzbedarf!
„Was hilft es mir“, jammerte er bei seinen Lieferanten gerne, „wenn ich eure Erzeugnisse verkaufe, die aber viel zu lange halten? Ein Herd 20 Jahre! Ein Sessel 10 Jahre! Ein Rasiermesser 5 Jahre! Viel zu lang ist das!“
Doch nun mit seinem Zauberstab konnte er dem Abhilfe verschaffen: Ein Herd war künftig bereits nach 10 Jahren unbrauchbar, ein Sessel nach 4 Jahren, ein Rasiermesser nach
366 Tagen; und wenn’s ein Schaltjahr war, hielt’s eben 367 Tage. Und du darfst nicht vergessen: Jede neue
Anschaffung kostet den Kunden viel mehr denn die frühere.
Meister Holzeisen machte seinem Namen alle Ehre, war also nicht nur Schreinermeister, sondern kannte sich auch bei Metallen gut
aus. Sein liebstes Kind waren Kutschen, die ohne Pferde rollten, ja, am besten noch nicht einmal einen Kutscher benötigten. Was könnte das für ein Reisevergnügen geben! Nun, mit dem Zauberstab keine unlösbare
Aufgabe, – dachte der Meister. Und mährsächlich: Schon bald ging kaum noch jemand zu Fuß. Wer’s aber dennoch tat, lebte freilich gefährlich und oft nicht lange. Denn Kutschen
flitzen lassen, das konnte der Meister, aber dafür Gassen zu verbreitern, dazu war sein Zauberstab zu schwach. Außerdem – das Fahrwerk
der Kutschen bestand bald aus so vielen Rädchen und Riemchen, die alle irgendwie miteinander verbunden waren, daß bereits der Ausfall eines winzigen Teilchens die ganze Kutsche bockig
machte. Und das dann auch tat, als der Meister begann, mit Kaufmann Glattzke gemeinsame Sache zu machen.
Und Dr. Knörsch, der Arzt? Auch der setzte seinen Zauberstab tüchtig
ein. Mit großem Erfolg! Gut, Lehrjahre
sind keine Herrenjahre, und auch der Umgang mit einem Zauberstab muß gelernt werden. Also, anfangs kamen Sargschreiner und
Totengräber durchaus auf ihre Kosten. Aber das sind Dienste, die mehr im Hintergrund ausgeübt werden. Spektakulärer waren bald die großen Heilungserfolge! Allein – was hilft jedoch ein
Zauberstab bei Patienten, die sich ihre Krankheit nur einbilden?
Aber es kam noch schlimmer! Die 3 kleinen Zauberstäbe entwickelten ein Eigenleben und wollten sich nicht mehr
beherrschen lassen, sondern selber herrschen. Sogar über Kaufmann, Meister und Arzt! Nu’ kommst du! –
„Ich hätt’ die 3 Zauberstäbe wieder eingesammelt“, nahm’s die Besucherin wörtlich, „und zurückgegeben.“
„Und der Gewinn des Kaufmanns?“ hielt der Alte dagegen.
„Die geweckte Kutschierlust der Menschen, die’s Gehen verlernt hatten? Und die Erwartungen der Patienten? Trotzdem hast du eine wichtige Gewährsfrau: die gute Fee. Denn die verschaffte sich
eines Tages Zutritt zum Thronsaal und stellte den König streng zur Rede. Ob er sein Volk völlig verwahrlosen lassen wolle? Am besten, er hätte jene Zauberstäbe nie in Empfang genommen! Wo denn sein Zauberstab
sei? Ach, hier? Und schon war dieser kurz und klein zerbrochen. Und wenn er’s gut mit seinem Volke meine, dann versuche er es künftig mal mit Dienen.
Das war auch bitter nötig. Denn auf den Gassen und Chausseen standen plötzlich alle Kutschen still, Patienten schrieen vor Schmerzen,
weil Operationen nicht beendet werden konnten, ja, und die Rasiermesser waren mit einem mal völlig fassungslos. Da gab’s viel
aufzuräumen, zu verpflastern und zu verarzten. Und plötzlich kam der Frühling! Mit seinem Singen und Klingen. Mit seinen Farben. Mit seinen Lüften und Düften. Und Ostern! Als hätte die Fee –“
Doch dem guten Ausgang hatte die Besucherin einen kräftigen Februarschauer vorgezogen und war zu ihrer Kutsche gehetzt.
© Stiftung Stückwerken, *22.2.2024, freigegeben am 2.3.2024
Qouz-Note 3-
***
MamM 1.220 Lauter Wettstreit
„Erst haben die Männerstimmen eine Strophe gesungen“ berichtete Donna Mücklein vom Sonntag, „und dann die nächste Strophe
alleine die Frauenstimmen; und beim nächsten Lied wieder so. Ist das jetzt
’ne neue Liturgie?“
„Wenn, dann wohl nur ein neuer Bestandteil davon“, antwortete der Alte von der Halbinsel. „Ich denke, es war wohl nur künstlerische Freiheit.“
„Vom Komponisten?“ zeigte sich die Besucherin verunsichert.
„Nee“, lachte der Alte, „der muß es ohnmächtig zulassen. Mächtiger ist da zunächst ein anderer, der sich für
bedeutender hält.“
„Etwa der Textdichter?“ irrte Donna Mücklein umher.
„Der müßte schon ein paar Jahre tot sein, bevor er Künstler genannt wird“, war der Alte schonungslos, „und müßte einflußreichen Gelehrten Ehre spenden können, ist also
meist noch ohnmächtiger denn der Komponist. Nein, denk an die Dirigenten, die jedoch oft auch nicht souverän sind. Allein – hat dir die Bearbeitung denn gefallen?“
„Is’ mal was anderes“, gab die Besucherin zu, „aber meine Lieblingslieder –“
„War’s denn eine Verbesserung?“ hakte der Alte nach.
„Hat’s den Text faßbarer –“
„Das möcht’ ich eigentlich nicht behaupten“, ging Donna Mücklein auf Distanz; „den Text versteh’ ich ja
sowieso oft nicht.“
„Ja, ja“, seufzte der Alte, „die chorische Aussprache! Hauptsache, ich kann mit meiner Stimme
strahlen; überstrahlen!“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der – der hieß Paul-Adam; ein junger König. Und da er nicht von großer Gestalt war, verkürzte er diesen Namen noch zu PA.
Außerdem war’s bereits die Zeit, wo junge Leute ohnehin nicht viele Wörter in den Mund nahmen.
Selbstverständlich wurde er nach seiner Krönung gefragt, was denn sei Regierungsprogramm sei.
„Es möge Friede sein“, zitierte PA in seiner 1. Thronrede, „und darin, liebes Volk, will
ich dein Bestes suchen.“ Und da er nicht näher darauf einging, blieb’s mehrdeutig.
Am Abend danach ging der König suchend und sinnend an den Bildern seiner Ahnen vorbei: Denen, die sich in kriegerischer Rüstung
zeigten oder mit Feldherrnstab, zollte er keine Hochachtung, sondern Mitleid. Nee, jener Handwerk war für ihn nicht
erstrebenswert. Ob diese Wahnsinnigen nun drüben Angst vor denen hatten, denen sie Lebenszeit geraubt hatten? Glücklich schauten sie schon hier auf den Gemälden nicht aus; auch nicht
ehrlich.
Aber es gab auch Vorfahren mit weicheren Zügen. Woher kam’s? Auf jeden Fall hatten diese in Friedenszeiten auf dem Thron gesessen. Mehr dazu mußte
in den Annalen stehen. Aha, „Förderin der Musen“, stand da oft zu lesen; oder „Förderer der Künste“. Ob
dies das Beste war? Gab’s eigentlich noch das KHO? Das Königliche Hof-Orchester? Tatsächlich, im Etat war’s noch immer als Posten aufgeführt.
Also beschloß PA, dieses KHO unter seine Fittiche zu nehmen.
Märchenkennerinnen ahnen jetzt wohl schon was, vor allem, wenn ihnen Der Zaunkönig im Bewußtsein ist. Zunächst fing alles harmlos an. Das KHO bekam einen neuen Dirigenten und der freie
Hand bei der Auswahl seiner Musikerinnen und Musiker und des Notenmaterials; freilich – sein königliches Vetorecht ließ sich PA nicht
abschwätzen. Auch nicht sein Vorschlagsrecht; denn er hatte sich schon von
Kindesbeinen einen eigenen Musikgeschmack gebildet.
In den ersten 3 Jahren ward auch artig vom Blatt gespielt; aber dann
kamen die 1. „Verbesserungsvorschläge“ von den Dirigierten: eine Kantilene für die Konzertmeisterin, etliche Schmettertakte für den Trompeter, und das Holz hätte sich gerne auch mehr Gehör
verschafft. Noch mehr rumorte es, als dem Orchester ein Chor angegliedert wurde. Der Einbau von Koloraturen für ein Sopransolo war ja wohl das mindeste, was verlangt werden konnte. Und ein Tenorsolo schmelze die Herzen.
Ganz aus dem Ruder lief’s jedoch, als zu Chor und Orchester noch ein Organist stieß: Wenn der sich aus der Begleitung in seine Improvisationen verirrte, war’s dem
Dirigenten ein Kreislerianum. Nun ja, Konzert bedeute angeblich Wettstreit. Gegen Ende solcher Konzertabende richteten sich die Operngläser aller HoraToren auf die Königsloge. Und da dort zuletzt nur noch das Schauspiel geboten wurde: Ägyptens König auf Samos (und davon der letzte
Abgang), leerten sich Ränge und Innenraum vorzeitig und blieben endlich leer; – bis auf?
Tscha, aber bis zu diesem „endlich leer bis auf“ gab’s einige Veränderungen. PA war nämlich zu seiner
Fee gegangen, seiner guten Fee, hatte ihr sein Anliegen und die gegenwärtigen Entwicklungen geschildert und sie um Rat gebeten. Und mit
diesem ging er dann ans Werk. 1. wurden die Konzerte vom Abend auf den Nachmittag verlegt, und 2. wurden dazu auch die Kinder
eingeladen. Sogar Freikarten gab’s für sie. Am Ergebnis änderte das
zunächst nicht viel. PA spielte früher und früher Ägyptens König auf Samos, Innenraum und Ränge leerten sich entsprechend, aber nun kommt’s: Die Kinder blieben! Die fanden es richtig lustig, wie da jeder Darbietende sich zur Geltung zu bringen versuchte und einer gegen den andern spielte.
Das können wir auch! dachten die Kinder, kamen wieder und wieder und brachten mehr und mehr Spielsachen mit, denen
Lärm zu entlocken war: Quietscheentchen, Holzklötze, Rasseln, –
„Das wird ein schöner Lärm gewesen sein!“ konnte sich Donna Mücklein nicht länger zurückhalten, das Gegenteil
meinend. „Erbaulich war das bestimmt nicht. Und wär’ ich
da Spielerin oder Sängerin gewesen, ich wär’ bestimmt nicht mehr –“
„Das trat eben nicht ein!“ widersprach der Alte – sogar begeistert. „Du unterschätzt die Macht der Kinder. Sogar der Dirigent ließ sich durch der Kinder
Freude anstecken und fuchtelte ganz besonders wild mit den Armen. Flöten fingen an zu glucksen. Die Konzertmeisterin wandelte sich zu einer Stehgeigerin mit sinthaften und paganinischen Tonfolgen. Nur der Organist – Aber den müssen wir in Schutz nehmen, zumal zu ihm ein Lausbub hinaufgeklettert war, der – doch das verschweigt des Alten Vorsichtigkeit. Allein – Lachen befreit; sogar von der Lächerlichkeit des Geltungsstrebens und schafft Raum für – Begeisterung. Ansteckende Begeisterung! Und wenn diese Begeisterung Verstaubtes und Eingemottetes
neu belebt, hat sogar die Bearbeitung von Liedern ihren –“
Aber – mal wieder hatte eine Besucherin nicht bis zum Ende durchgehalten.
© Stiftung Stückwerken, *29.2.-1.3.2024, freigegeben am 11.3.2024
Qouz-Note: 3-
***
- MamM Titelverzeichnis
- MamM 0a bis 20
- MamM 301 bis 320
- MamM 321 bis 340
- MamM 341 bis 360
- MamM 361 bis 380
- MamM 401 bis 420
- MamM 441 bis 460
- MamM 481 bis 500
- MamM 601 bis 620
- MamM 621 bis 640
- MamM 641 bis 660
- MamM 681 bis 700
- MamM 801 bis 820
- MamM 821 bis 840
- MamM 841 bis 860
- MamM 861 bis 880
- MamM 881 bis 900
- MamM 1.001 bis 1.020
- MamM 1.021 bis 1.040
- MamM 1.041 bis 1.060
- MamM 1.061 bis 1.080
- MamM 1.081 bis 1.100
- MamM 1.101 bis 1.120
- MamM 1.121 bis 1.140
- MamM 1.141 bis 1.160
- MamM 1.161 bis 1.180
- MamM 1.181 bis 1.200
- MamM 1.201 bis 1.220
- MamM 1.221 bis 1.240
Jüngstes Update:
21.7.2025