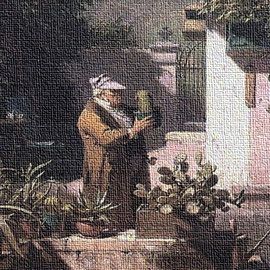MamM – Mährchen an meine Mutter Nr 1.121 bis 1.140
Überblick MamM 1.121 bis 1.140
1.121 Der Versöhnungsminister (*11.6.2021)
1.122 Der andern Last (*17.6.2021)
1.123 Dennoch Musik (*24.6.2021)
1.124 Der werdende Johann (*1.-2.7.2021)
1.125 Freie Bahn? (*9.7.2021)
1.126 Scheitern zu schreiten (*23.7.2021)
1.127 Die Prinzessin und der Bänkster (*29.7.2021)
1.128 Vom Geben und Annehmen (*6.8.2021)
1.129 Nachtmeister Stropp und der Fall Zürik (*12.+14.8.2021)
1.130 Was haben wir gesammelt? (*20.8.2021)
1.131 Wohl denen, die da wandeln (*26.8.2021)
1.132 Ein immer fröhlich' Herz (*2.9.2021)
1.133 Und den Kindern das Lachen (*9.9.2021)
1.134 Der Sämann des Bösen (*16.9.2021)
1.135 Seifried ohne Land (*23.9.2021)
1.136 Der sprechende Rabe (*8.10.2021)
1.137 Nachklingen (*14.10.2021)
1.138 Vom Wächter zum Hirten (*21.10.2021)
1.139 In Philipp Viellieb (*28.10.2021)
1.140 Unser Nikoklaus (*4.12.2021)
________________________________________________
MamM 1.121 Der Versöhnungsminister
„Sagt mal“. meinte es Donna Scheidemantel nicht wörtlich, „was ist denn nun richtig: Die einen predigen, die Sündenvergebung müsse immer
wieder neu verkündigt werden; die andern, es reiche, an das einmal gebrachte Opfer zu glauben?“
„Da mußt du den lieben Gott schon selber fragen“, kannte der Alte von der
Halbinsel einige seiner Grenzen, „und nicht einen irrenden Menschen.“
„Aber Ihr müßt doch da Position beziehen“, blieb die Besucherin beharrlich.
„Ist das keine Position: zu bekennen, etwas nicht zu wissen?“ wich der Alte weiterhin aus. „Beide Extreme haben ihr Für und Wider. Wird die Sündenvergebung immer wieder neu
verkündigt, dann paßt das besser zum Vaterunser, was ja eigentlich ein tägliches Gebet ist. Und – du kannst immer wieder einen neuen Anfang machen. Dazu ermuntert die andere
Haltung nicht; doch hat sie den Vorzug, daß niemand abhängig ist von einer Kirche; von kirchlichen Herrschern und deren Wahn und Bequemlichkeit. Vielleicht liegen die
Wahrheit und Gottes Wille mal wieder nicht im Entweder-Oder, sondern im Sowohl-Als-auch.“
„Damit setzt Ihr Euch aber zwischen alle Stühle“, ging’s Donna Scheidemantel wider ihre Natur, „und verlaßt jeglichen kirchlichen Schirm.“
„Bei aufkommendem Unwetter kann ich ja wieder zurückkehren“, griff der Alte das Bild auf, „doch wenn der Schirm auch Gottes
Sonnenstrahlen fernhält, dann ist’s wohl besser, auf diese Sonne zuzugehen“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hatte 3 Söhne. Selbstverständlich war der älteste Sohn dazu bestimmt, einmal
Krone und Reich zu erben; aber welcher Mensch kann schon die Zukunft voraussehen? Auch ein König kann das nicht, und deshalb ließ er alle 3 Söhne in den Grundzügen des Regierens ausbilden. Aber nicht nur das; mit Erreichen der Volljährigkeit durfte sich auch jeder Sohn ein
Ministeramt aussuchen und in dieses unter Anleitung des Königs hineinwachsen.
Da erwählte der Kronprinz sich das Amt des Kriegsministers, da er in vielen Historienbüchern gelesen hatte: Um als der Große in die Geschichte einzugehen, sei es eine
notwendige Voraussetzung, erfolgreiche Eroberungskriege geführt zu haben.
Nun ja, der Vater sah das etwas anders und begann bereits, sich Sorgen zu machen, doch da kam ihm der 2. Sohn unbewußt zur Hilfe: Der entschied sich nämlich für das Amt
des Schatzkanzlers und kam sich vor wie der Obermüller. Denn wenn der Obermüller das Wasser ableitet, dann dreht sich das Mühlrad der
Untermühle allenfalls im Winde.
Für den Kronprinzen hieß das: Womit kannst du Waffen kaufen, ein Heer ausheben und dieses versorgen, wenn dir der Schatzkanzler kein Geld bewilligt? Da mußte der älteste Sohn wohl doch den Tag abwarten, an dem er endlich den Thron besteigen durfte und mit Noterlassen regieren
konnte. Allein – erstlich war es noch nicht soweit, und 2. hab’ ich über Kriegs- und Geldherren schon in andern Mährchen genug
erzählt.
Viel interessanter ist deshalb, welches Amt sich der Clemens erwählte. Tscha, stell dir vor: Er wollte Versöhnungsminister werden. Na, wer ihm den Floh wohl
ins Ohr gesetzt hatte? Der Vater bestimmt nicht; und die Brüder auch
nicht; ja, die machten sich über den Jüngsten sogar lustig. Ein
Versöhnungsminister brauche keine Uniformen und auch sonst keine besondere Dienstkleidung, urteilte der Kriegsminister als Herr über die Zeughäuser. Und der Schatzkanzler ließ mitteilen, für einen Versöhnungsminister gebe es im Etat keinen Posten und somit auch weder Geldmittel noch Personal,
noch Amtsstuben; wer Luftschlösser bauen wolle, der müsse schon für sich selber sorgen.
Gestern ist vorbei, habe mal eine Landesmutter zu ihrem Wahlspruch erhoben, heute
lebe, und für das Morgen sorgt Gott. So mußte wohl auch Clemens
denken; denn er hatte zwar ein Amt, aber kein Einkommen, keine Bleibe und weder Helferinnen noch Helfer. Wo also hin? Willst du Bettler werden, dann bleib in der Stadt; so dich nicht der Armenvogt ausweist. Willst du aber überleben, dann zieh aufs
Land. Na ja, allzu weit brauchte Clemens gar nicht zu gehen, denn bereits vor den Toren der Residenzstadt fand er einen Garten, in dem
Garten eine Gärtnerin und in der Gärtnerin eine Meisterin und Lehrherrin.
Cordia war aber eine recht wunderliche Meisterin, die sich mit allem, was lebte, zu unterhalten pflegte, so, als –
ja, als wären’s Menschen; menschliche, eh, rücksichtsvolle. Freilich – ein
bißchen Erziehung tat auch den Gartenbewohnerinnen gut. Oder glaubst du, die Mühlwaus, also, die Wühlmaus weiß von Kindesbeinen an:
Wenn ich alle Wurzeln anknabbere, dann bring’ ich mich selber an den Bettelstab?
Nun hatte Clemens aber sein Amt keineswegs aus den Augen und aus den Sinnen verloren, und da traf sich jetzt verschiedenes gut. Er erlernte nämlich ebenfalls die Sprache der Tiere, Pflanzen und anderen Lebewesen, fragte diese um Rat und versuchte diese Ratschläge nach Feierabend
in der Residenzstadt umzusetzen.
So gab die Quelle zwar zu, daß sie mit ihrem Wasser Grenzen speise, aber bei gutem Willen wären diese Grenzen doch überbrückbar. Und dort, wo sie des Brunnenamtes warte, herrsche Trinkfrieden; vorausgesetzt, es sei
für alle Gäste genügend Wasser da; darauf müsse Clemens schon achten.
Die Gänseblümchen erzählten, auch sie hätten guten Frieden, weil sie eine Vereinbarung mit der Sonne getroffen hätten; diese möge nämlich um sie alle Tag für Tag herumwandern und ein jedes mit ihren lieben Strahlen bedenken; weshalb sie alle auch als Maßliebchen bekannt seien.
Und die Hühner meinten, wichtig sei, stets seinen Schnabel aufzutun und miteinander zu reden; was das
Spatzenvolk nur bestätigen –
„Und was haben Eure Spinnereien jetzt mit den unterschiedlichen Auffassungen zur Sündenvergebung zu tun?“ konnte
sich Donna Scheidemantel nicht länger zurückhalten.
„Eine gute Frage“, versuchte der Alte sich zurechtzufinden. „Also, wenn alle beim gemeinsamen Mahl Frieden
halten und guten Willens sind, Grenzen zu überbrücken, wenn alle miteinander reden, statt übereinander und durcheinander, und dabei das Zuhören nicht versäumen und wenn die Strahlen der lieben
Sonne jedes Herz erreichen: Na, dann wird schon alles gut werden. Bei Cordia und Clemens jedenfalls –“
Allein – dem Alten war die Zuhörerin mal wieder abhanden gekommen.
© Stiftung Stückwerken, *11.6.2021, freigegeben am 1.1.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.122 Der andern Last
„Und dann wollte er noch mich dafür haftbar machen“, entrüstete sich Donna Minna nicht wörtlich. „Schließlich gehörte auch ich zu diesem – diesem Verein; ja, so sagte er.“
„Und?“ half der Alte von der Halbinsel weiter.
Was und?“ hielt’s die Besucherin für überflüssig.
„Soll ich etwa meines Bruders Hüter sein und für so einen meinen Kopf –?“
„Niemand soll etwas“, hakte sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort fest. „Allein – zum Christen gehört’s
wohl dazu: –“
„Was?“ fragte Donna Minna.
„Für seine Nächsten einzustehen“, antwortete der Alte. „Und das fällt mir wohl am schwersten. Und wer weiß, wie leicht es am Karfreitag Jesus gefallen ist? Vielleicht war das damals seine schwerste –“
„Aber das ist doch nicht meine Aufgabe“, wies es die Besucherin von sich. „Ein jeder trage seine eigene Schuld
gefälligst selber. –“
„So?“ schien’s der Alte sehr zu bezweifeln.
„Außerdem wär’s ja Täuschung“, rechtfertigte sich Donna Minna, „ich sei für etwas verantwortlich, was ein anderer getan hat. Und in Eurem Buch da sagt’s Jesus selbst: Du sollst niemanden
täuschen.“
„Ja, das ist eine gute Lebensregel“, mochte der Alte sein Reizwort sogar in den Heiligen Schriften nicht: „Du brauchst
niemanden zu täuschen, sondern kannst aufrichtig viel besser leben. Das muß ich schon beherzigen; allein –“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß –, eh, der hieß Thomas; und zwar ein junger König, sozusagen noch ganz grün
hinter den Ohren. Das siehst du schon daran, wie er Respektpersonen begegnete. Vor allem dem hohen Gericht.
Jaha, als König sei es seine Pflicht, so meinte er, an den Prozessen vor dem obersten Gericht teilzunehmen.
Tscha, wenn er sich aufs Zuhören beschränkt hätte! Das hätte noch hingehen können; aber –
Gleich beim 1. Prozeß war es mit dem Zuhören schnell vorbei. Damals war Ehebruch anscheinend noch strafbar,
und deshalb stand eine Frau vor Gericht, die bei so etwas wohl ergriffen worden war. Der Mann anscheinend über alle Berge – von Justiz
und Polizei. Die Frau also alleine auf der Anklagebank; und nun stell dir
vor: Da steht doch der König auf und setzt sich zu der Angeklagten!
Was denn das zu bedeuten hätte? fragte der Richter. Ob
er etwa der Buhle dieser – dieses Flittchens hier gewesen sei.
Das nicht, antwortete der König, aber gewiß sei er mitschuldig; mitschuldig an dem, was dieser Frau hier zur
Last gelegt werde. Ja, vielleicht sogar weit mehr schuldig denn diese.
Wie denn das? konnte es der vorsitzende Richter nicht verstehen.
„Hab’ ich denn nie hinter den Mädchen hergepfiffen?“ fragte Thomas widersprechend. „Nie eine Frau wegen ihrer Schönheit bevorzugt? Schürzen gejagt und deren
Trägerinnen, als wären sie Freiwild? Und das aus den niedrigsten Beweggründen! Nämlich aus Habgier! Und dann meine Blicke! Hab’ ich mit ihnen nicht das, wessen diese Frau angeklagt ist, noch viel häufiger vollzogen? Frauen, ob nun verheiratet oder in festen Händen oder nicht, angeschaut, ihrer zu
begehren? Und wenn einem der König mit schlechtem Vorbild vorangeht, was ist da von den Untertanen zu erwarten? Wie schnell halten sie’s für eine neue Sitte und übernehmen diese!“
„Aber, Majestät, das Recht und Gesetz!“ wagte der vorsitzende Richter einzuwenden.
„Wird durch Sitten verändert“, ergänzte der König. „Das menschliche! Und droht, sich vom göttlichen Recht zu entfernen. Deshalb beantrage ich für mich die
derzeitige Höchststrafe; für die arme Frau hier aber Freispruch wegen zu geringer Mitschuld.“
Und als der vorsitzende Richter sich weigerte, seinen König zu verurteilen, kündigte Thomas an, die Angeklagte im Falle eines Schuldspruchs sofort zu
begnadigen. Und so kam’s denn auch.
Beim nächsten Prozeß war ein Jugendlicher des schweren Raubes angeklagt. Da die Indizien gegen ihn sprachen,
drohte ihm eine Zuchthausstrafe. Und wieder setzte sich der König mit auf die Anklagebank. Begründung? Wie oft habe er, Thomas, in seinem Leben schon Menschen wegen deren
materiellen Reichtums bevorzugt? Und andere geringgeschätzt, nur weil sie in keiner prächtigen Kutsche vorgefahren seien? Oder – eben nicht nach Geld gerochen hätten. Da müsse sich doch jeder junge Mensch
sagen: Haste nichts, dann biste nichts und wirst auch nichts! Kein Wunder, wenn dann ein
junger Mensch auf die schiefe Bahn gerate! Und wer sei daran schuld? Er,
der König! Doch auch hier sah’s das Gericht anders und verurteilte nur den jungen Mann; den aber der König so schnell wie möglich begnadigte.
Und dann der 3. Prozeß! Ein sogenannter Schwerverbrecher! Überführt des und angeklagt wegen mehrfachen Raubmordes und Gewalt gegen Frauen. Und
wieder setzte sich Thomas bald mit auf die Anklagebank. Begründung? Der
Angeklagte sei zum Soldaten ausgebildet und dann in den Krieg geschickt worden; und niemand habe ihn zur Rechenschaft gezogen für das,
was er da getan habe: Mord, Plünderung, Notzucht. So etwas bleibe aber nicht ohne Schaden für Wertvorstellung und Gewissen. Kein Wunder, wenn nach dem Krieg bedenkenlos fortgesetzt werde, was im Krieg nicht geahndet, ja, vermutlich sogar erwünscht gewesen
sei. Und wer sei dafür verantwortlich? Der König; denn als oberster Kriegsherr habe er alles billigend in Kauf genommen.
„Aber, Majestät, Ihr habt ja noch keinen einzigen Krieg geführt!“ hielt der vorsitzende Richter dagegen. „Dieser Kerl hier ist doch bereits unter eurem Großvater angeworben worden und hat dann vor allem die Kriege Eures Vaters mitgemacht!“
„Eben!“ sah’s Thomas nicht als Widerspruch. „Und wer ist
der Erbe? Hab’ ich mit dem Vermögen nicht auch die Schulden geerbt?“
„Also, solch einen König werdet Ihr in der Wirklichkeit bestimmt nicht finden“, hatte Donna Minna bis hierhin zumindest zugehört. „So was – so was täte ja das ganze Rechtswesen auf den Kopf stellen! Die Richter
wären arbeitslos und die Zuchthäuser –“
„Das befürchteten die Richter damals auch“, ging der Alte weiter, „und bedrängten den König sehr, entweder alles zu belassen wie unter seinem Vater und dessen Vätern oder
abzudanken. Ihre Furcht sei unbegründet, versuchte Thomas zu beschwichtigen, denn Richter brauche es weiterhin. Die müßten doch entscheiden, was recht und was unrecht sei. Nur dürften sie über
keinen Menschen mehr den Stab brechen, sondern jedem von der schiefen Bahn herunterhelfen. Und das auf Augenhöhe! Denn wir sind alle Übeltäter, Übelredner und Übeldenker. Am besten aber sei es, wenn
Verbrechen von vornherein verhindert – Aber da hab’ ich mich bei der Hitze wohl verausgabt. Adieu!“ Und er geleitete die Besucherin hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *17.6.2021, freigegeben am 12.1.2024
Qouz-Note: 2+
***
MamM 1.123 Dennoch Musik
„Mit dem Verein will ich nichts mehr zu tun haben!“ klang Donna Breitner
entschieden. „Die sind alle bei mir unten durch.“
„So?“ schien sich der Alte von der Halbinsel zu wundern. „Vielleicht kommen sie ja von oben zurück.“
„Ich finde das überhaupt nicht lustig!“ zürnte die Besucherin. „Verstanden?“
„Nö“, mußte der Alte zugeben. „Ich hab’ mich mit denen ja auch gar nicht eingelassen.“
„Seid froh!“ ließ Donna Breitner eine Gönnerlaune jedoch vermissen. „Die haben mich dermaßen enttäuscht, –“
„Dich von deinen überzogenen Erwartungen heruntergeholt“, ergänzte der Alte. „Deshalb sei auch du –“
„Ha“, fand’s die Besucherin jedoch noch immer nicht lustig, „wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu –“
„– kann ihn mit Humor besser tragen“, sah’s der Alte anders. „Enttäuschungen sind tatsächlich nichts
Erfreuliches, aber sie machen freier, – solange sie nicht in Verbitterung einmauern. Schau: Du willst mit jenen nichts mehr zu tun
haben – wie eine Spaziergängerin, die einen bestimmten Weg nie mehr gehen will, nur weil sie dort einen giftigen Fingerhut hat blühen gesehen. Der wird aber bald verblüht –“
„Nee“, war sich Donna Breitner dessen gewiß, „die ändern sich nie! Das ist so die Art des ganzen
Hauses. Die sind und bleiben alle –“
„Bist du sicher, daß du eine prophetische Gabe hast?“ zweifelte der Alte sehr und begann zu erzählen:
Heinrich – der Seefahrer; der Heilige; der Löwe; ich will dir heute von Heinrich dem Wanderer
erzählen. Also, es wär’ einmal ein König, der hieß Heinrich. Ein junger
König; denn er saß und stand noch nicht unter der Regentschaft einer Eheliebsten und – wollte das ändern.
So hatte er gehört, daß Ingrun, die junge Königin von Tristonesien, einen Bräutigam
suche. Nun gibt’s sicher viele junge Frauenzimmer, die einen Bräutigam suchen; und das war damals nicht anders. Aber Ingrun von Tristonesien, die war – genau die
Richtige für unsern Heinrich; davon war dieser nämlich fest überzeugt, sobald er ihr Bild gesehen hatte. Und da er seitdem oft von ihr träumte, wurde er desto gewisser. Allein – eine
vergleichbare Gewißheit fehlte jener Königin, so daß sie zu einem Wettbewerb aufgerufen hatte: Wer als 1. sie zum Lachen bringen könne, dem wolle sie ihr Herz schenken, na ja,
einräumen.
Nun, diese Hürde mußte erst einmal genommen werden, doch Heinrich war sich seines Sieges gewiß. Denn
wes das Herz voll ist, des geht der Kopf über. So war er nämlich auf den Gedanken gekommen, die Königin mit Musik und seinem Gesang zu gewinnen. Heutzutage täte ein König einfach ein Symphonieorchester mitnehmen; doch
damals? Mehr als 7 Musikanten wollte Heinrich nicht aufbieten, und – er wollte auf Schusters Rappen reisen. Folglich durften die Instrumente nicht schwer sein, sondern mußten in jeweils einen Rucksack passen und auch über mehrere Stunden tragbar
sein.
Das aber waren die Namen der 7 Begleiter: 1. Schneckhus mit seinem Altholz; 2. Yowanni mit seiner Stegleier; 3. Oblomski mit seiner Tromke;
4. Blasius mit seiner Ziehflöte; 5. Hurliwitz mit seinem Dynamiko; 6. Probsten mit
seinem Basso; 7. Lämmle mit seiner Fiedeline. Und dann ging’s los!
Am Abend des 1. Tages gab es Streit mit Schneckhus. Der hörte einfach
nicht zu, wenn der König mit ihm redete; ständig blies er in sein Altholz, als müsse er alles Leid dieser Erde beklagen. Da wurde es Heinrich zu bunt, und er wünschte Schneckhus auf den Mond; und im Nu
waren Altholz und dessen Spieler verschwunden.
Am nächsten Tag traf es Yowanni; denn dem König war aufgefallen, wann
unterwegs die Stegleier gezupft und angeschlagen wurde: nämlich immer, wenn eine Schürze, ein Rock oder ein Kleid in Hörweite war. Der
täte ihm womöglich sogar noch die Königin streitig machen, argwöhnte Heinrich und wünschte auch ihn auf den Mond; und hui! waren
Stegleier und deren Spieler verschwunden.
Am 3. Tag stieß es dem König übel auf, daß Oblomski bisher noch keinerlei Hilfsbereitschaft an den Tag gelegt hatte, sondern sich
immer nur bedienen ließ. So wurde auch der Tromkespieler mit dessen Instrument auf den Mond gewünscht.
Am 4. Tag wurde Blasius auf diese Wunschreise geschickt.
Warum? Weil er von morgens bis abends damit prahlte, wie gut er die Ziehflöte spielen könne und daß der Sieg allein ihm zu verdanken
sein werde.
Hurliwitz traf die Verbannung auf den Mond am 5. Tag. Er war eben ein
Meister am Dynamiko und wußte mit seinem Spiel sogar die wilden Tiere zu besänftigen, und zwar derart, daß sie Raub und Mord vorübergehend vergaßen. Das ließ schon früh den Samen der Eifersucht in des Königs Gemüt fallen, und am 5. Tag fruchtete er in jener schlimmen Verwünschung.
Am nächsten Tag folgte ihm Probsten mit seinem Basso, denn er hörte einfach nicht auf, den König zu kritisieren. Tscha, einmal ist die Quittung eben voll, und dann wird sie überreicht.
Blieb nur noch Lämmle übrig. Der hatte aber das Pech, daß ihm der König unterwegs die Bogenstange zerbrochen
hatte. Zwar war’s nicht aus Absicht, sondern aus Ungeschick geschehen, der Bogen konnte auch bald ersetzt werden, aber – aber jedes
Mal, wenn des Königs Blick auf Lämmle fiel, mußte Heinrich an dieses Ungeschick denken; und am 7.
Tag war’s eben ein Mal zuviel.
Plötzlich gingen dem König die Augen auf, und er gewahrte, daß er nun völlig ohne Gefährten war. Wie konnte er
jetzt noch den Sieg erringen? Waren die Gefährten wirklich so unerträglich gewesen? Nee, er hatte wohl alles falsch –
„Dann sollte er sich eben neue Musiker suchen“, konnte sich Donna Breitner nicht länger zurückhalten.
„Um sich dann an deren Aber zu stoßen?“ folgerte der Alte. „Nee, besser ein Dennoch zu einem alten Aber denn ein neues Aber. Heinrich machte
wohl einen so jämmerlichen Eindruck, daß es das Herz des lieben Mondes rührte. Und als dieser das nächste Mal wieder ganz groß über die
Morgenberge stieg, da brachte er die 7 Musiker mit, und es ward ein großes Versöhnungsfest gefeiert. Und dann ging’s mit Riesenschritten zu Ingruns Schloß; und obwohl die Sonne schon
längst untergegangen war, wurde derart lustig aufgespielt, daß – ja, daß die Glühwürmchen vor Freude zu tanzen anfingen. Und die
Königin öffnete das Fenster ihrer Schlafkammer, schaute und hörte hinaus; und als es ihr war, als begleite dort unten eine Kapelle morgens um 7 einen jaulenden Kater am Kurbrunnen, da lachte sie und –“
Doch beim Alten war nur noch er selber übriggeblieben, der hätte mitlachen können. Also tat er’s auch und dennoch.
© Stiftung Stückwerken, *24.6.2021, freigegeben am 4.3.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.124 Der werdende Johann
„Was haltet Ihr eigentlich von diesem Johannes dem Täufer?“ fragte Don Bangemann.
„Das, was die Bibel über ihn berichtet“, antwortete der Alte von der Halbinsel,
„so es wahr ist.“
„Soll ich das jetzt als Zweifel auslegen?“ benutzte der Besucher das bekannte Reizwort.
„Niemand soll etwas“, griff’s der Alte auch sofort auf. „Und niemand soll richten –“
„Aber bei dem hier ist’s doch eindeutig“, fühlte sich Don Bangemann angesprochen. „In Eurem Buch da steht:
Der Kleinste im Himmelreich ist größer denn Johannes. Folglich kommt dieser nicht ins Himmelreich.“
„Sicher?“ war sich der Alte da nicht. „Für alle
Ewigkeit? Auch nicht, sobald er kleiner geworden ist in seinen Augen?“
„Wollt Ihr Jesum etwa einen Lügner schelten?“ entrüstete sich der
Besucher. „Oder Euch sogar gegen die Lehraussagen der heiligen Kirche auflehnen? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, daß in unserer Kirche gepredigt wurde: Der Johannes hätte sich besser vernünftig angezogen und statt
Heuschrecken Fisch oder ein Wurstbrot gegessen, ja, und wäre Jesu nachgefolgt, statt sich in die Politik –“
„Jede Kirche hat ihre Duckmäuser“, widersprach der Alte nicht, „denen der Täufer ein Dorn im Auge sein muß.
Und sein Scheitern dient ihnen als Alibi, auch seine guten Seiten abzulehnen.“
„Ihr seht doch selbst, was aus einem asketischen Leben folgt“, hielt Don Bangemann dagegen: „Zweifel und Abkehr von Gott! Und wenn Ihr mich fragt: Ihr seid auf dem gleichen Weg, und zwar in die gleiche –“
„Ich bin aber kein Prophet“, lachte der Alte, „und daß ich kein Elia bin, merke ich an manchen Regentagen;
allein –“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein Königssohn, der hieß Johann, auch wenn er nicht der Größte war, von Müttern geboren. Nein, er war zwar dort, wo sein Namensvetter vor dessen Ende angekommen war: in weichen Kleidern
und in der Könige Häusern; aber er ging diesen Weg nicht Richtung
Ende.
Nächte in Samt und Seide! Die Damen in glänzender Seide, die Wirkung eines lächelnden Gesichtes
unterstreichend; die jungen Männer in weichem Samt, Biegsamkeit verratend, wo Gesicht und Haltung Strenge und Herrscherbewußtsein
vorgeben. Und die Pfeile fliegen hin und her, entpuppen sich aber in Richtung Samtträger oft als Harpune. So auch das, was Treulinde abgeschossen hatte.
Wie ich das behaupten kann? Nun, nach jenem Abend erschien SIE auf keinem Ball mehr, aber unser Johann begann,
SIE zu suchen. Ja, er wollte und mußte SIE unbedingt wiedersehen! Also zog
er Erkundigungen ein und erhielt schließlich die Nachricht, die Prinzessin sei in ihre Heimat abgereist. Und wo lag diese
Heimat? 7 Länder weiter; falls du’s exakt brauchst, dann nimm die Finger: den Daumen für das Nachbarland und den Zeigefinger der
andern Hand für Heidelindes Heimat. Und nun auf: Wir reisen mit unserm Johann!
Tscha, wer weiche Kleider trägt, der fährt selbstverständlich in einer prächtigen Kutsche. Macht ja auch mehr
Eindruck. Leider auch auf Gemüter, die der Habgier zugeneigt sind. Und
davon gab’s im 1. Land bereits genug. Das war nämlich das Reich der Zwerge. Und hast du nicht gesehen, hingen schon etliche von ihnen an den Köpfen der Kutschpferde und lenkten diese in eine große Höhle. Wer aber fürchtet sich schon vor Zwergen? Wenn es aber so viele sind? Jedenfalls hielt es Johann nicht für ratsam, den Zwergen sein wirkliches Reiseziel zu anzugeben. Doch so konnten sie ihm auch nicht helfen, hielten ihn gar für einen Spion und sahen sich deshalb im Recht, ihm Kutsche und Pferde
abzunehmen. Und als der Prinz lange nach Sonnenuntergang zu Fuß die Grenze erreichte, da klagte in der Ferne eine Flöte.
Jenseits der Grenze war das Land der Riesen. Und als Johann am nächsten
Tag den 1. Einwohnern begegnete, da befiel ihn eine große Angst; denn weiche Kleider sind halt keine Rüstung. Die Frage, er wolle doch nicht etwa zur Prinzessin Treulinde, verneinte er deshalb.
Jedoch – die Riesen mochten zwar einfältigen Denkens sein, für Unwahrheit hatten sie aber ein besonderes Gespür. Und so fühlten sie
sich voll berechtigt, dem Prinzen dessen prall gefüllte Geldkatze abzunehmen und ihn zu zwingen, ihr Land bis zum Tagesanbruch verlassen zu haben. Und wieder klagte am späten Abend in der Ferne die Flöte.
In Seeland, wohin Johann nun kam, lebten die Menschen vom Fischfang, denn hier gab’s viele Seen, die miteinander durch Flüsse und
Kanäle verbunden waren. Freundlich nahmen Fischer den Prinzen in einem Boot auf; doch als er wieder übervorsichtig sein Reiseziel geheimhalten
wollte, fuhren sie ihn auf dem kürzesten Weg zur Grenze. Und da er kein Fährgeld entrichten konnte, fühlten sie sich berechtigt, ihm
die Kleider abzunehmen und ihn in Lumpen weiterziehen zu lassen. Und wieder klagte am Abend die Flöte in der Ferne.
Johann kam nun nach Wüstenland: ohne Brot, ohne Wein, ohne Salz. Nun
darfst du dir Wüstenland nicht als einen großen und weiten Sandkasten vorstellen. Es gab auch felsige Flächen und Felsbrocken, die
gegen die sengende Sonne schützen konnten; aber diese Felsbrocken wanderten nicht mit, so daß Johann vor allem in der Nacht
weiterwanderte. Das war nicht ungefährlich, denn es lauerten auch trügerischer Treibsand und brüchige Salzdecken. Aber vor diesen Gefahren warnte dann jene Flöte, die nun nicht mehr klagte, sondern kurz nach Sonnenuntergang sogar aufmunternde Klänge
fand. Und wenn Johann nach seinen nächtlichen Wanderungen erschöpft hinter einem Felsbrocken niedersank und am Nachmittag von seinem
Schlaf erwachte, fand er jedesmal Brot, Früchte und Wasser vor, ja, beim 1. Mal sogar einen wärmenden Mantel – gegen die kalten Nächte.
Auch schien ihm, während er schlief, jemand regelmäßig Nägel und Haare zu schneiden und den Bart zu scheren, daß er nicht zu sehr verwilderte. Und das fast 7
Jahre –
„Aber was hat das jetzt alles mit Johannes dem Täufer zu tun?“ konnte sich Don Bangemann nicht länger
zurückhalten.
„Gute Frage!“ schien der Alte Zeit gewinnen zu wollen.
„Dem Täufer fehlte etwas; aber wer weiß, vielleicht hat er’s inzwischen erhalten. Jedenfalls begann es gegen Ende der 7 Jahre in Wüstenland zu regnen, so daß Johann nun bei Tageslicht wandern konnte und aus der Wüste
hinausfand. Und schneller eilte sein Fuß, und der Prinz verheimlichte sein Ziel nicht mehr und ließ sich den kürzesten Weg
weisen. Und Treulinde? Hatte sie etwa 7 Jahre gewartet? Oder hatte sie inzwischen einen andern geheiratet? Kann denn Liebe
sterben? Und an der mangelte es wohl damals dem –“
Aber der Alte war mal wieder allein.
© Stiftung Stückwerken, *1-2.7.2021, freigegeben am 5.3.2024
Qouz-Note: 3+
***
MamM 1.125 Freie Bahn
„Mit so was sollte kurzen Prozeß gemacht werden!“ schien sich Donna Niethnagel auf die
Bank der Richterinnen zu setzen.
„Sollte – soll“, grollte der Alte von der Halbinsel ob seines
Reizwortes. „Niemand soll etwas. Und dann noch: so was? Ist dieser Mensch zu einer –“
„So was ist für mich kein Mensch mehr!“ ereiferte sich die Besucherin.
„Sondern ein Stück Vieh?“ fragte der Alte.
„Noch nicht mal das!“ urteilte Donna Niethnagel. „Bei
soviel Schuld, die der auf sich –“
„– die ihm angelastet worden ist“, stellte der Alte richtig. „Ist wirklich jeder dessen schuldig, wessen er
schuldig gesprochen wird?“
„Sicher!“ gehörte die Besucherin dennoch nicht zu denen, die noch an den Weihnachtsmann glauben. „Wozu haben wir Richter?“
„Das frag’ ich mich manchmal auch“, nahm der Alte die Frage nicht als rhetorisch. „Um die Schuld anderer zu
sammeln und einem Sündenbock aufzubürden?“
„Blablabla!“ kommentierte Donna Niethnagel. „Der Täter
ist schuld und damit basta!“
„Allein schuld?“ fragte der Alte verneinend. „Schuld
setzt eine freie Entscheidung voraus. Wer ist aber völlig frei? Frei von
seiner Vergangenheit? Denk nur an jenen Schuster Wilhelm. Frei von seinen
Erbanlagen? Da fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Ob’s in der Literatur zu
selten behandelt wurde? Frei von der Stufen Reihenfolge? Du kannst die 7. Stufe in der Regel
nicht vor der 1. –“
„Ich kann doch springen“, glaubte die Besucherin mit dem Bild dessen Grundlage zerstören zu können, „oder mich mit einem Seil hochschwingen.“
„Und wer das nicht hat oder nicht kann?“ hielt der Alte dagegen. „Oder wer’s nicht weiß? Oder wem’s nicht einfällt? Und dann die Freiheit von Gesetzmäßigkeiten. Auch psychologischer Art. Entschlossenheit und Nachsicht; Eifer und Geduld; Jäger und Sammler; reimt sich das in einem Menschen?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der –, der hieß Freidank. Der hatte ein großes Reich; und um es besser verwalten zu können, war es in 7 Provinzen gegliedert. Nun war es
aber in jenem Reich Sitte, daß zwar jede Provinz ihre Gerichte hatte, aber kein Urteil ohne Zustimmung des Königs rechtskräftig war; sofern es zu einem schweren Verbrechen ergangen
war. Dazu zählte alles, was zumindest mit Haftstrafen von einem Jahr geahndet werden konnte. Du kannst dir sicher vorstellen, daß schon aus Zeitgründen manches Urteil ohne genauere Untersuchung bereits in des Königs Kanzlei abgezeichnet
wurde; bei besonders hohen Strafen jedoch pflegte der König alles näher in Augenschein zu nehmen.
So auch, als kurz nach seiner Thronbesteigung den König aus einer entlegenen Provinz die Kunde erreichte, ein junger Mann sei wegen Raubmordes zum Tode verurteilt
worden.
Der König ließ gleich am nächsten Morgen anspannen, schnallte sich seine Geldkatze um für die Zeche in den Wirtshäusern, und los ging die Reise. Na ja, wer mich kennt, ahnt bereits: Weit ging es so nicht! Ein Stein kam ins Rollen,
erreichte den Weg des Königs und kam dort zu liegen – genau nach dem Vorderrad der Kutsche und genau vor dem Hinterrad. Ein Schlag, ein
Krachen, und die Schutzengel hatten alle Hände voll zu tun, den König vor Tod und Verletzung zu bewahren. Die Kutsche jedoch war
fahruntüchtig. Nun ja, von so etwas läßt sich ein junger Mann nicht aufhalten. Der Kutscher wurde mit dem einen Pferd zurückgeschickt, einen Wagner zu holen, und auf dem andern Pferd setzte der König die Reise alleine
fort. Das muß schon ein sehr friedliches Land sein, wo ein König ohne Leibwächter reisen kann; oder ein sehr blauäugiger König.
Tscha, wer gerade durch ein Hindernis aufgehalten worden ist, der schaut beim Weiterreiten vor allem nach unten; das ist selbst dann gefährlich, wenn er nicht eines so gesegneten Haupthaares ist wie jener berühmte Kronprinz. Es war aber in der Nacht ein ergiebiger Regen niedergegangen und Ästen und Zweigen zu einer schweren Last geworden. Und hast du nicht gesehen, schwebte unser Freidank schon zwischen Himmel und Erde, und das Pferd galoppierte reiterlos von dannen.
Da mußte unser Freidank seinen Weg auf des Schusters Braunen fortsetzen, ohne daß diese bereits sattsam zugeritten worden waren. Was machst du deshalb? Richtig: Du suchst nach Abkürzungen! Auf den ursprünglichen Weg kannst du ja notfalls immer noch zurückkehren, denkst du.
Denkste, Frieda! Anfangs mag’s ja noch so aussehen, aber dann führt deine Abkürzung hinab und der ursprüngliche Weg zur Höhe, und
plötzlich werden beide durch steile Felswände voneinander getrennt. Langsam dämmert es dir, daß aus deiner Abkürzung ein Umweg zu
werden droht.
Oder gar ein Abweg? Also versuchst du, das zu korrigieren, und wählst eine Abzweigung. Und schon bist du auf dem Holzweg, landest auf einem Holzplatz und mußt dann etwas machen, was kein Wanderer gerne tut: umkehren.
Tscha, nun mußt du aber umdenken; denn was auf dem Hinweg rechts lag, liegt nun linker Hand. Jedenfalls kam Freidank zwar endlich aus dem Bergwald hinaus, aber wo er nun war, wußte er nicht.
Vor ihm lag eine weite Wiese, und Freidank wanderte durch dieses freie Land und wanderte und gelangte endlich an einen Waldrand. Doch der kam dem König irgendwie bekannt vor; und es fand sich, daß er im Kreis
gegangen war.
Was kann da noch helfen? Ein Führer? Wenn’s aber
ein Mann ist, der das Rauben zu seinem Gewerbe gemacht hat? Freidank fiel jedenfalls so unter jene Gewerbetreibenden und – war bald
einer von ihnen. Wie das? Ein König? Die oberste Instanz eines Reiches? Raub einem Menschen 7 Nächte lang den Schlaf, laß
ihn hungern und gib ihm Drogen, dann brauchst du ihn nur noch auf einem Raubzug mitzunehmen und dabei mitmachen zu lassen, und schon bald kannst du ihn sogar allein auf Raub
ausschicken.
So wurde Freidank eines Abends ohne Begleitung losgeschickt, eine Waldkapelle auszurauben, die durch etliche großzügigen Stiftungen angeblich reich mit Silber, Gold und
Edelsteinen ausgestattet sei. Doch kaum hatte Freidank die Tür jener Kapelle von innen geschlossen, da blieb er wie angewurzelt
stehen; denn im Schein einfacher Kerzen erglänzten auf dem Altartisch Brot und Wein. Das fiel ihm derart ins Herz, –
„Und was hat das alles mit jenem Kerl und seiner Schuld zu tun?“ konnte sich Donna Niethnagel nicht länger
zurückhalten.
„Das hängt von deinen Brücken ab“, antwortete der Alte rätselhaft. „Freidank jedenfalls schüttete der
Priesterin jener Kapelle sein Herz aus, und sie nahm ihm ab seine Last, wies ihm den Weg, stärkte ihn und gab ihm den Segen. Und künftig rühmte sich in jenem Reich die Barmherzigkeit wider das Gericht. Freidank aber hatte jene Priesterin liebgewonnen; und weil sie ein Segen für das ganze Land –“
Aber die Besucherin war inzwischen gegangen.
© Stiftung Stückwerken, *9.7.2021, freigegeben am 6.3.2024
Qouz-Note: 3+
***
MamM 1.126 Scheitern zu schreiten
„Daß der noch nie jemand gesagt hat, daß sie nicht singen kann!“ klagte Donna Preisrichter.
„Ja“, war's dem Alten von der Halbinsel nicht fremd, „das hab' ich auch schon
manches Mal gedacht.“
„Und warum habt Ihr das ihr niemals gesagt?“ fragte die Besucherin.
„Gibt’s auf Warum-Fragen eine hinreichende Antwort?“ stellte der Alte verneinend in Frage. „Wäre der Nutzen größer gewesen denn der –“
„Für meine Nerven gewiß!“ war sich Donna Preisrichter sicher. „Dieses Gejaule! Diese falschen Töne! Da ist sogar mein Hund noch –“
„So ist’s halt bei uns Menschen“, ließ sich der Alte nicht aus der Ruhe bringen: „Irgendwann findet jeder seine Meisterin, und wir entdecken endlich, daß wir nicht nur
etwas besser können denn andere, sondern auch andere etwas besser können denn –“
„Also wäre es doch besser“, folgerte die Besucherin, „bei so etwas gar nicht erst seine Kräfte zu vergeuden, –“
„– sondern gleich die Flinte ins Korn zu werfen?“ ergänzte der Alte. „Ob dann überhaupt noch Korn geerntet werden könnte? Dem Korn täten die vielen
Flinten gewiß nicht gut. Ach, wer wollte da richten!“ Und er begann zu
erzählen:
Es wär’ einmal eine Prinzessin, die hieß – die hieß Pauline. Na, du ahnst wohl schon: Die war nicht dazu
ausersehen, Königin zu werden; eher ein österreichischer Köder mit Angelhaken. Und um da den größten Vorteil herauszuschlagen,
ward bei der Ausbildung Paulines nicht gespart. Freilich – das Kochen und Backen mußte sie nicht lernen, denn für Herd und Backofen war
sie nicht bestimmt. Auch nicht dazu, ihrem künftigen Gatten auf die Finger sehen zu können, derhalben ihr die Türen zu Soll und Haben
und Prozent- und Währungsrechnen verschlossen blieben. Und Schießen, Fechten und Ringen ward ihr auch nicht beigebracht.
Dafür aber das Malen. Nun ja, genauer: Pauline wurde zum Malen gebracht, aber nicht das Malen zu
ihr. Nee, sie konnte noch nicht einmal zeichnen. Natürlich: Mit dem Stift
oder der Feder übers Papier fahren, das konnte die Prinzessin schon; aber das war ja keine Kunst! Jedoch – das Gezeichnete zu deuten oder darin das Vorbild wiederzuerkennen, das konnte nur eine: Pauline! Dennoch waren die Zeichenlehrer stets voll des Lobes ob der Werke Paulines und rühmten – sich – bedeutender Fortschritte. So auch bei Paulines Werken mit Pinsel und Farben. Niemand wollte der Prinzessin
sagen, daß es ihr an einem Gefühl für Schönheit und Harmonie sehr gebrach. Und was Pauline mit Schlegel und Beitel vollbrachte, nun ja,
da ward hinterher von der Magd beim Aufräumen manches Mal Kunstwerk und Abfall verwechselt. Erst als Pauline heimlich Zeugin wurde, wie
des Gärtners Kinder die bildenden Künste der Prinzessin einstuften, tscha, da widmete sie ihre Kräfte anderem. Allein – eins von des
Gärtners Kindern nahm’s als Ermutigung, in den bildenden Künsten begabter zu sein denn die Prinzessin, und wurde ein geachteter und beliebter Künstler.
Fortan interessierte sich Pauline mehr für die Dichtkunst, zumal es von dieser hieß, sie küre sogar Fürsten.
Leider wagte aber kein Lehrer (auch keine Lehrerin), die Prinzessin auf den Umstand hinzuweisen: Dichten kommt nicht von Breiten! Und getret’ner Quark ziert keinen Divan! Die Folge: ein großer Papierverbrauch. Auch mit dem Reimen kam Pauline kaum
zurecht. Einen Vers, endend auf flach, verband furchtlos sie mit 'nem Vers, schließend
mit Tag. Oder sie wagte, gewiß zu
süß zu gesellen oder gar anweisen zu verreisen. Letzteres weist bereits auf eine weitere Schwierigkeit hin: der Rhythmus! Paulines Dichtkunstwerke holperten gewaltig, doch war sie keine schleichende Nikolausia auf sandiger Heide, wo dies Sinn gemacht hätte.
Kurz und gut: Pauline wurde eines Tages heimlich Zeugin, wie sich des Gärtners Kinder über der Prinzessin Entdichtungen lustig machten.
Da war’s vorbei mit der Dichtkunst – für Pauline; eines von des Gärtners Kindern nahm’s jedoch als Ermutigung, beim Dichten begabter zu
sein denn die Prinzessin, und wurde eine geachtete und geliebte Dichterin.
Pauline aber wandte sich nun der Musikkunst zu. Ein weites Feld! Wo anfangen? Am besten bei dem vielfältigsten Instrument, zumal es obendrein keine
Anschaffungskosten verursacht: die eigene Stimme. Freilich: Gesangslehrerin ist da nicht gleich Gesangslehrerin. Pauline hatte jedenfalls das Pech, einer Lehrerin in die Hände zu fallen, die alle Natürlichkeit ihrem Prokrustesbett anzupassen bestrebt
war; also dem der Lehrerin. Das deutsche S mußte wie das englische Th ausgesprochen werden, -ig grundsätzlich wie -ik sowie che- und chi- wie ke- und ki-. Überhaupt kam es nicht darauf an, verstanden zu werden, sondern darauf, aufzufallen und laut zu
sein. Und darin war Pauline äußerst erfolgreich. Ihr Gesang war einfach
einzigartig. Und da es der Prinzessin sowohl an dem absoluten als auch an dem relativen Gehör gebrach, war ihr Gesang stets
vielseitiger denn die jeweilige Partitur. Diese Vielseitigkeit übertrug Pauline auch auf andere Instrumente, an denen sie sich
versuchte. Sie brachte Akkorde zu Gehör und erfand Tonleitern, auf denen ihr niemand nachzuklettern vermochte. Tscha, und als sie sich auch noch an das Komponieren wagte, waren die Ergebnisse derart gewaltig, daß kein Musiker sie zu spielen
wagte. Und wieder war’s mit dem Zauber vorbei, als die Prinzessin heimlich des Gärtners Kinder belauschte, wie die sich über Paulines
Werke lustig machten. Doch erneut nahm’s eines von des Gärtners Kindern als Ermutigung, in der Musik begabter zu sein denn die
Prinzessin, und wurde eine gern gehörte Tonkünstlerin.
Pauline aber war mit ihrem Latein –
„Die hat’s wenigstens noch rechtzeitig begriffen“, konnte sich Donna Preisrichter nicht länger zurückhalten.
„Wenn jemand nicht begabt ist, soll –“
„Soll“, grollte der Alte mal wieder über sein Reizwort, „niemand soll nicht. Pauline jedenfalls ging zu ihrer
guten Fee; und diese riet ihr, sich nicht so wichtig zu nehmen. Sei es denn
wirklich so schlimm, wenn sich andere über uns lustig machen? Mach die Menschen glücklich, dann
machst du sie gut; und kommst dabei selbst zur Freude, auch wenn’s andere besser können; tscha, das war’s, was die Fee unserer Pauline mitgab. Und mit diesem Samen arbeitete
unsere Prinzessin künftig in ihren Gärten. Und selbst wenn sie die Erde inzwischen bereits verlassen hätte, blühen und fruchten diese
Gärten weiter. Braucht denn ein Garten dazu eine alles überragende Statue als Denkmal?“
Und der Alte geleitete die Besucherin hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *23.7.2021, freigegeben am 7.3.2024
Qouz-Note: 2
***
MamM 1.127 Prinzessin Montana und der Bänkster
„Ach, wißt Ihr“, meinte es Don Overflach nicht als Frage, „ich hab’ in meinem Leben niemanden umgebracht, meine Kinder sind alle gut
versorgt, und sollte das nicht reichen, kann ich mich in aller Bescheidenheit und Herzensdemut darauf berufen, ein treuer Kirchgänger zu sein. Sogar für die Orgel hab’ ich –“
„Endlich mal einer, der zugibt, was ihn an die Kirche bindet“, lobte der Alte von der Halbinsel. „Kirchgang und Spenden als Versicherungsprämie! Bei wem bist du eigentlich
versichert? Bei der Kirche oder beim lieben –“
„Euer Vergleich hinkt gewaltig!“ tadelte der Besucher. Trotzdem – wer
einmal die ewige Herrlichkeit erben will, muß dafür auch etwas tun!“
„Ja?“ zweifelte der Alte sehr. „Etwa den Erblasser
umbringen?“
„Spottet nur!“ meinte es Don Overflach nicht als Einladung. „Der reiche Segen Gottes beweist mir jedoch, daß ich auf dem richtigen Wege bin.
Dagegen Ihr – Also, wenn ich mich hier so umschaue, na, ja, Segen sieht doch anders aus –“
„Sprach der arme Lazarus zum reichen Mann!“ ergänzte der Alte. „Da hast du wohl recht. Aber ich hab’ da große Zweifel, daß die menschliche Elle der
göttlichen entspricht; zumal doch alles, was wir mit dieser menschlichen Elle messen, von Menschen stammt und – vergänglich ist.
Ich weiß nicht, mir wäre das zuwenig.“
„Höre ich da Euren Hochmut heraus?“ argwöhnte der Besucher. „Kein Wunder, daß Euch Gott noch nicht einmal mit irdischen Gaben segnet! Denn wer
darin schon nicht treu ist, dem –“
„– wäre es besser“, ergänzte der Alte, „damit gar nicht erst gesegnet worden zu sein“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal eine Prinzessin, die – die hieß Montana. Na ja, klein und schmächtig wird sie wohl nicht
gewesen sein; und eine Stubenhockerin auch nicht. Somit also auch weder
dafür bestimmt noch dafür geeignet, Tag für Tag auf einem Königsthron zu sitzen. Für so etwas gab’s eben ihren älteren Bruder, den
Kronprinzen. Nun versetz dich mal in unsere Prinzessin: Tag für Tag vor Augen, daß dein Bruder was Besseres ist. Tscha, und dann die Aussichten für jene Zeit, ab der er dein König ist. Da kann’s auf
dem Schloß für dich schon eng werden, und du denkst: Was Bess’res als hier findest du
überall.
Freilich – SIE hätte auch heiraten können; aber da kaufst du den Kater im Sack und weißt nie vor nachher, ob er als Geselle was taugt. Deshalb ging unsere Prinzessin, als sie
volljährig geworden war, zu ihrem Vater und ließ sich ihr Erbe auszahlen; ja, und dann ohne Segen davon! Der Vater ließ sie ziehen, denn – Nun, ich will nicht vorgreifen. Schicken wir
sie also einstweilen hinter die Bühne.
Zur gleichen Zeit wär’ nämlich ein gewisser Benton; der war durch sein Gewerbe zu großem Reichtum gekommen und
zu hohem Ansehen. Tscha, mit welchem Gewerbe kann dir so etwas gelingen? Na, du ahnst es
vermutlich: Benton war ein Bänkster geworden. Er hatte also ein ehrbares Bankhaus eröffnet und allen reichen Leuten versprochen, ihnen
zu einem kleinen Vermögen zu verhelfen; vorausgesetzt: Sie überließen ihm ihr
großes. Und wenn dein Geschäft in der einen Residenzstadt gut läuft, dann kannst du es auch in eine andere laufen lassen oder in eine
freie Reichsstadt. Und so kam es, daß auch unsere Prinzessin Montana von diesen Vermögenswundern erfuhr, sich angesprochen fühlte und
jenem Bänkster ihr Vermögen anvertraute. Nicht ihr ganzes Erbe, aber alle Taler, die sie nach dem Kauf eines Gartens übrigbehalten
hatte und für dessen Pflege nicht brauchte. Wahrscheinlich auch mit der Überlegung: Bring das Geld zur Bank, dann kann’s die niemand
rauben! Zumal sie’s dir dort ja auch als dein Guthaben bezeichnen und führen; also – etwas Gutes und etwas, was du hast. Angeblich!
Nun wird’s aber langsam Zeit, daß wir unseren Bänkster etwas besser verstehen lernen. Schließlich galt sein
Gewerbe ja als ehrbar, er hatte Erfolg, somit spricht nichts dafür, er sei ein böser Mensch gewesen. Allein – er hatte sein Gewerbe
bereits in jungen Jahren begonnen, und dabei hatte eine gewisse Beobachtung Patin gestanden: Die schönsten Wespen wurden von den kostbarsten Früchten angezogen. Ich hoffe, du verstehst das Bild. In der Umgangssprache: Haste nichts, dann biste nichts bei den Frauenzimmern. Wohnst du aber in einem teuren Palais und
kommst in einer prächtigen Kutsche vorgefahren und weißt obendrein noch fürstlich zu beschenken, na, dann kommen sie angeflogen. Die
Wespen! Keine Hummeln oder Bienen! Doch irgendwann kommt der Tag, da rufst
du aus:
Die Wespen sind zu viel’, zu groß,
ich werde sie wohl nie mehr los!
Es ist eben eine Illusion, daß Wünsche verschwinden, wenn du sie erfüllst; nein, sie werfen Junge, die noch größer werden denn die
Eltern. So auch bei Bentons Wespen! Er begann, Kosten einzusparen und eine
Filiale nach der andern zu schließen, aber auch da kannst du zum Zauberlehrling werden, und dann kommt’s zum großen Knall! Benton raffte eines Nachts alle Guthaben zusammen, die noch nicht zurückgefordert worden waren, und floh von dannen. Schon am nächsten Morgen stand’s in allen Zeitungen: Benton sei bankrott und mit unterschlagenem Geld untergetaucht.
Das las auch unsere Prinzessin Montana, und zwar mit großer Bestürzung; denn sie hatte jenem Bänkster bis zuletzt blauäugig vertraut. Zornig wollte sie sich auf den Weg zur Hauptniederlassung jenes Bankhauses machen, da pochte es zaghaft an das Gartentor. Sie öffnete, und zu ihren Füßen gewahrte sie eine Gestalt, die ohnmächtig zusammengesunken war: Benton!
Eigentlich hätte sie jetzt die Gendarmen holen müssen oder ihren ganzen Zorn an diesem Bänkster ablassen können, aber sie brachte es nicht übers Herz. Sie zog den Verletzten und anscheinend völlig Ausgeraubten in ihr Haus und pflegte –
„Aber das war doch ein schlimmer Verbrecher!“ konnte sich Don Overflach nicht länger zurückhalten. „Der muß strengstens –“
„Indessen klopfte noch jemand an das Gartentor“, fuhr der Alte unbekümmert fort. „Es war der bisherige König,
der von seinem Sohn zur Abdankung gedrängt worden war. Dieser neue Gast bestärkte seine Tochter darin, Benton gesund zu
pflegen. Denn, so fragte der Vater, seien sie denn besser? Sie hätten
bisher von Steuergeldern gelebt, und was sei das anderes denn Raub? Raub an den Armen! Denn die Reichen könnten sich an den Armen schadlos halten, aber die Armen an niemandem. Ja, der neue König wolle sogar Soldaten ausheben lassen und in den Tod schicken. Und
wozu? Damit er berühmt werde und in die Chroniken als siegreicher Eroberer –“
Doch da merkte der Alte, daß er wieder allein war und seine Ansicht über den Reichtum nicht von jedermann geteilt wurde.
© Stiftung Stückwerken, *29.7.2021, freigegeben am 8.3.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.128 Vom Geben und Annehmen
„Meiner Ansicht nach“, hielt Donna Pingelle für die allein richtige, „muß die Buße den größten Teil der Strafe ausmachen.“
„Hm“, hatte der Alte von der Halbinsel anscheinend eine andere
Sicht. „Und der kleinere Teil?“
„Abschreckung und Sicherheit“, mußte die Besucherin nicht lange überlegen. „Die Strafe soll –“
„Soll“, grollte der Alte ob seines Reizwortes. „Laß das Soll doch mal weg und die Strafe ebenfalls. Und setz für die Buße ein Zurück –“
„Aber der Straftäter muß doch zur Buße gedrängt werden“, hielt Donna Pingelle dagegen.
„So?“ zweifelte der Alte sehr. „Damit er bald erneut
umkehrt?“
„Nein, sondern daraus lernt“, stellte die Besucherin richtig, „und sich künftig vor der schiefen Bahn hütet.
Der Straftäter hat doch bewiesen, daß er’s nicht alleine kann. Also muß das Gericht ihm Beine –“
„Hat dem einen verlorenen Sohn etwa ein Gericht Beine gemacht?“ fragte der Alte verneinend.
„Er war ja noch nicht straffällig geworden“, sah’s Donna Pingelle nicht als Widerspruch. „Und an ihm könnt Ihr
zumindest sehen, wie wichtig die Umkehr ist. Der Vater ist ihm nur einen unbedeutenden Teil entgegengekommen. Ohne Umkehr keine –“
„Gut, daß Jesus in jenem Gleichnis keine genauen Kilometer- oder Meilenangaben gemacht hat“, zeigte sich der Alte dankbar, „sonst gäb’ es bestimmt etliche
Schriftgelehrten, die daraus ein kirchliches Gebot gemacht hätten oder eine juristische Richtlinie. Und ein Glück, daß Jesus zuvor das
Gleichnis vom verlorenen Schaf entwickelt hat, und vielleicht ahnst du jetzt, warum mir das Wort ZURÜCK lieber ist denn Buße“, und er begann zu
erzählen:
Es wär’ einmal ein Prinz, der hieß – der hieß Lützeljan, und der hatte eine große Schwester, die hieß – die hieß
Bettina. Wie ist das aber mit einer großen Schwester? Richtig! Sie weiß und kann alles besser und wähnt, sie sei die stellvertretende Mutter. Und
wie ist das mit einem kleinen Bruder? Richtig? Er will sich nicht
bevormunden lassen.
Da will sich der kleine Lützeljan ein Bilderbuch aus dem Regal nehmen, und die große Bettina will helfen, zumal das Buch in ihrer Reichweite steht. Aber der kleine Bruder will’s sich unbedingt selber holen, stapelt eifrig Kistchen und Kästchen auf einen Stuhl, steigt tapfer hinauf, und
bauz! liegt er unten, und das Geschrei ist groß.
Oder die beiden sitzen an der Mittagstafel, und der kleine Lützeljan lädt sich mehr und mehr auf seinen Teller; und als die große Schwester warnt und mahnt, erst recht. Gut, der Prinz ißt den
Teller zwar leer, aber anschließend ist das Bauchgrimmen groß und der Appetit 3 Tage lang winzig.
Oder Lützeljan brütet über seinen Hausaufgaben, Bettina will ihm helfen, aber lieber fällt er einige Stunden später erschöpft vom Stuhl, als diese Hilfe
anzunehmen. Eigentlich macht so etwas niemanden glücklich, dennoch –
Nun ja, irgendwann ist Bettina aus dem Haus und Schloß und glücklich verheiratet; irgendwann ist Lützeljan
volljährig; und wenig später sitzt er auf dem Thron seiner Väter. Sicher –
er hat Ratgeber, aber eigentlich weiß und kann er alles besser (aus seiner Sicht!), und schon bald
zeigt sich, wie er die Linsen zu lesen weiß: Wer die Meinung des jungen Königs bestätigt, wird
ausgezeichnet, wer ihr widerspricht, ausgemustert.
Opportunismus tut einer Regentschaft nie gut. Und als das Reich derart heruntergewirtschaftet war, daß dies
nicht mehr verborgen bleiben konnte, da ward der König aus Schloß, Stadt und Land gejagt und verbannt.
Gut, daß er jenseits der Grenze bald eine Schatzkiste fand! Er öffnete sie vorsichtig, nahm ein Kleinod heraus
und –
„Ich tät’ an deiner Stelle aber viel mehr mitnehmen“, riet eine fremde Stimme.
Überrascht drehte er sich um und gewahrte ein Mädchen. Na ja, wer mit einer großen Schwester aufgewachsen ist,
dem mangelt es nicht an dummen Sprüchen:
„Ich bin aber nicht wie du,
du dumme, blöde Kuh!“
sprach’s und ging von dannen, ohne sich umzuschauen.
Das Kleinod ward bald versilbert, und die Taler waren bald aufgebraucht; und als der Magen knurrte, da kam es
zu einer neuen Begegnung mit jenem Mädchen. Freilich – an Schönheit hatte es nicht gewonnen, sondern irgendwie an Traurigkeit. Aber Hoffnung keimte auf, als es dem verjagten König etliche Kleinode aus jener Schatzkiste anbot: Die gehörten ja dem König und es hätte ihm die
Schmuckstücke nur nachgetragen, und es täte sie an seiner Stelle annehmen.
„Ich bin aber nicht wie du,
du dumme, blöde Kuh!“
sprach Lützeljan brüsk und ging von dannen, ohne sich umzuschauen. Ob er noch die Worte gehört hatte: „Dann will ich sie auch nicht
behalten?“
Um zu überleben, ging Lützeljan schließlich unter die Räuber. Sein 1. Raubzug sollte der Überfall auf die
Postkutsche sein. Allein – als ihr Rollen und Rasseln bereits zu hören war, trat plötzlich jenes Mädchen vor den neuen
Räuber. Wie abgemagert es aussah und todtraurig! An seiner Stelle täte es
da jetzt nicht mitmachen, mahnte es.
„Ich bin aber nicht wie du,
du dumme, blöde Kuh!“
zürnte Lützeljan und gab dem Mädchen einen derben Stoß, daß es wie leblos niederfiel. Entsetzt sprang er von –
„Aber was hat das alles mit Strafe und Buße zu tun?“ konnte sich Donna Pingelle nicht länger
zurückhalten.
„Nichts“, antwortete der Alte provozierend, „wenn du keine Brücken baust. Jedenfalls – der Raubüberfall
verlief unglücklich – für die Post. Die Beute war für die Räuber derart reichlich, daß sie auch jenes Mädchen auf ein Lasttier
packten; vorsorglich, damit sie nicht verraten wurden, falls das Mädchen überlebte. Tscha, seine Lage war schon kritisch; da aber die Räuber vorerst nicht darben mußten,
genas es und ward dann als Köchin angestellt. Bei den Räubern! Menschen zu
bekochen, das mag ja was Gutes sein; wenn die aber ihre Kräfte dazu nutzen, andere Menschen auszurauben? Nun ja, die Gelehrten streiten noch immer darüber, wie der Mensch durch seine Ernährung beeinflußt wird. Mildtraut jedenfalls kochte so gut und reichlich, daß die Räuber viel zu träge wurden, neue
Verbrechen zu planen. Allein – Trägheit macht auch unvorsichtig, vor allem wenn das Mahl auch mit Rebensaft gewürzt wird. Und so kam ein Tag, an dem das Räubernest durch Gendarmen ausgenommen wurde; nur die
Köchin konnte unerkannt entkommen. Gut, daß die Kleinode, die sie einst weggeworfen hatte, bisher noch niemand gefunden
hatte! Mit ihnen kaufte Mildtraut ein Lasttier und Proviant und machte sich auf die Suche. Schließlich fand sie IHN, na, du weißt schon wen, am Rande einer Weide: völlig abgemagert und dem Tode auf der Schüppe. Da holte sie IHN, na, du weißt schon wen, herunter, lud ihn auf ihr Lasttier, und dann ging’s zurück. Auch jene Schatztruhe hatte bisher noch niemand anderes gefunden, und mit deren Inhalt –“
Allein – dem Alten war seine Zuhörerin mal wieder abhanden gekommen.
© Stiftung Stückwerken, *6.8.2021, freigegeben am 9.3.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.129 Nachtmeister Stropp und der Fall Zürik
„Endlich Feiermorgen!“ gönnte sich unser Stropp am Spätstücktisch Ruhe. „Die Last des Alters läßt sich nicht mehr verleugnen.“
„Aber dafür hast du ja mich“, gönnte Frau Struppe ihrem Eheliebsten Aufmunterung, „so können wir’s gemeinsam
tragen.“
„Dafür muß er aber auch Eure Last mittragen“, gönnte unser Bruhno seiner Nase, weise zu sein.
„Für einen Bären bist du aber ganz schön frech!“ bekam er’s prompt von der Igelin als Quittung.
„Immer noch besser denn häßlich“, versuchte unser Nachtmeister seinen Lehrjungen in Schutz zu nehmen, „und wo er recht hat, da –“
„– hab’ ich trotzdem recht!“ ergänzte die Eheliebste, bärbeißig verpackend. „Wann begreift ihr das endlich? Aber nun langt tüchtig –“
„Herr Nachtmeister, Herr Nachtmeister“, verschaffte sich eine Stimme Gehör, als gehöre sie einem Boten, der im Auftrage eines Herrn Shakespeare unterwegs sei, „du sollst
zu einer Leiche kommen; und zwar sofort!“
„Niemand soll etwas“, schien Frau Struppe beim Alten von der Halbinsel zur Schule gegangen zu sein, aber: „Es sei denn, ich
hätte es so angeordnet. Hab’ ich aber nicht, also sag deiner Leiche, mein Gemahl kommt weder sofort noch –“
„Um wen handelt es sich denn?“ versuchte dieser Gemahl ein weiteres Aufheizen zu verhindern. „Ach so, guten Morgen, Herr – Herr –“
„Eichwart“, war der Bote nicht inkognito unterwegs. „Der
Friedensrichter meinte, du solltest dir selbst ein Bild von allem machen, und hat mir ausdrücklich verboten, –“
„– mehr zu sagen“, kannte unser Igel zwar keine Pappenheimer, aber seine Obrigkeit. „Ich weiß, ich
weiß. Er hat wohl Angst, ich könnte die Ermittlungen sonst gleich einstellen.“
„Es wird doch Tag und Nacht an allen Enden gestorben“, fütterte die Igelin ihre Ablehnung, „was bemüht ihr da meinen berühmten Gatten? Ist er denn Bestatter oder Totengräber?“
„Ich hab’ meine Anweisungen“, rechtfertigte sich der Eichelhäher, „und wenn du denen nicht Folge leistest, wirst du schon sehen, was du davon hast. Also, ich geb’ dir jetzt Zeit bis –“
„– bis zum Sonnenuntergang“, beeilte sich unser Stropp, seine Tagesruhe zu retten. „Wo liegt die Leiche
überhaupt?“
Sie lag im Kühleborntal, und ohne Reittier wäre das überhaupt nicht zu schaffen gewesen. Also mußte mal wieder Wastel, der Waschbär, herhalten. Gerne wäre auch Frau Struppe
mitgekommen, aber eine mußte doch auf das Hauswesen aufpassen; und außerdem hatte sich Emma von Nowotny, die Schildkröte, zum Abendplausch
angesagt.
Nun ja, wenn eine solche Berühmtheit unterwegs ist wie unser Held, dann geht das nicht ganz reibungslos.
Schildkröten mußten begrüßt werden, Tonigel, Rosen, Stockrosen, Entengansschwan, Gänse, Erpel, Eibisch, Flockenblume, Tante-Elli-Blumen, Hortensien, Nachtkerzen, Yuccas und
Tausendschön. Ja, es mußte sogar etlichen grünen Pfählen Mut zugesprochen werden, endlich ihre Blüten der lieben Sonne zu
zeigen. Diese war also schon längst untergegangen, als die 3 endlich am Fundort der Leiche eintrafen. Zu spät für erste Ermittlungen?
Na, dann kennst du unseren Nachtmeister nicht! Erst einmal mußte die Leiche geborgen werden, denn darum hatten
sich weder der Häher noch sein Auftraggeber gekümmert. Das wäre wichtig gewesen? Und ob! Die Leiche lag nämlich in einem Brunnentrog. Wie leicht hätte sie in den Ausfluß treiben und für immer verschwinden können! Für
unsern Igel war’s zu gefährlich, sie da rauszuholen, aber für unsern Bruhno war’s ein Kinderspiel! Nun ja, gut war’s schon, daß ihn der
Waschbär an den Beinen festgehalten hatte, denn sonst wäre der Lehrjunge mährsächlich in den Brunnentrog hineingefallen. Nun, es ging
alles glücklich vonstatten, und schon hatte unser berühmter Ermittler das Opfer vor sich.
„Aber das ist doch Zürik!“ war die Identität bereits festgestellt. „Was wollte der denn in einem Brunnen?“
„Vielleicht schwimmen lernen“, hatte der kleine Bär eine Idee.
„Dann hätt’ ich mir aber ein flacheres Gewässer ausgesucht“, zeugte sein Lehrherr von seinem meisterhaften Einfühlungsvermögen.
„Oder er wollte trinken“, wartete unser Bruhno mit einer weiteren Mutmaßung auf, „und es hat ihn jemand hineingestoßen.“
„Nee“, konnte unser Stropp nicht beipflichten, „da gibt’s hier für Grashüpfer viel ungefährlichere Wasserstellen. Außerdem sind am Opfer keinerlei Spuren äußerlicher Gewalt feststellbar. Dennoch
glaube ich nicht an einen Unfall –“
„Mord?“ entsetzte sich der kleine Bär. „Aber dann müßte
doch jemand ein Motiv haben.“
„Eben!“ lobte der Lehrherr seinen Lehrjungen. „Du hast
den richtigen Punkt zum Ansetzen gefunden. Und haben wir erst das Motiv, dann finden wir auch den Täter.“
„Habgier, Erpressung, Eifersucht“, fing unser Bruhno an, aufzuzählen, was er kannte, „Rache, Bruderhaß –“
„Ach, da seid ihr ja wieder!“ freute sich anscheinen jemand über diese Begegnung. „Geht’s wieder gegen die Jäger? Ja, ja, dieses Ungeziefer –“
„Guten Abend, Meister Lustigfeld“, teilte und mehrte unser Igel die Freude, „schön, Euch lebend
wiederzusehen! Was macht die Schnapsfabrikation?“
„Na ja“, neigte der Hase – wie jeder Geschäftsmann – zunächst zum Klagen, „die Kirschernte war in diesem Jahr nicht besonders; aber wenn’s die Menge nicht macht, dann macht’s eben der Preis. Wollt Ihr mal ein
Schlückchen kosten, also als mein Gast?“
„Um uns schicker zu machen?“ konnte unser Nachtmeister sein Folgern nicht lassen. „Aber da kommt mir gerade
ein Gedanke!“
„Tscha“, erzählte unser Freund am nächsten Morgen am Spätstückstisch, „nun denkst du gewiß, wir hätten einen über den Durst
getrunken. Der Hase ließ seine Flasche auch mehrmals in unserer Runde kreisen, aber wir 3 haben nur genippt. Desto mehr konnte er selber laden, und desto lustiger wurde er und – vor allem desto lauter. Und schon kam eine Eichkatze zornig herbeigesprungen und hat sich über die Ruhestörung beschwert. Na, wir haben sie natürlich gleich eingeladen, mitzutrinken. Erst hat sie sich etwas
geziert, aber schon bald hat sie kräftig zugesprochen. Na ja, Alkohol löst bekanntlich die Zunge, so daß ich bald wie von ungefähr
fragen konnte, was sie alleine gegen uns 4 denn hätte ausrichten können. Und – ich hatte richtig geahnt! Sie fing nämlich nun an zu prahlen, sie hätte sich bereits heute morgen eines hartnäckigen Ruhestörers entledigt. Den hätte sie an dessen Eitelkeit harpuniert und hier zum Brunnenrand gezogen, damit er seine Schönheit im Spiegel bewundern könne. Ja, und dann hätte sie den Grashüpfer nur noch ein wenig zu erschrecken gebraucht; und schon sei’s mit der Ruhestörung für immer vorbei
gewesen.“
„Hoffentlich hast du mit dieser Mörderin gleich kurzen Prozeß gemacht!“ erwartete Frau Struppe.
„Mörderin?“ stellte unser Stropp in Frage und sein gutes Herz unter Beweis. „Wer ist ohne Schuld? Nein, sie wird heute abend hier ihr Canossa finden. Und nun wollen wir schlafen geh’n!“
© Stiftung Stückwerken, *12.+14.8.2021, freigegeben
am 14.1.2024
Qouz-Note: 3+
***
MamM 1.130 Was haben wir gesammelt?
„Also, dieser junge Pfarrer“, urteilte Donna Richelin, „wenn er überhaupt schon Pfarrer ist, na, der muß noch vieles lernen.“
„So?“ baute der Alte von der Halbinsel eine Brücke. „Zum Beispiel?“
„Na, das mit dem Segen“, mußte die Besucherin nicht lange überlegen. „Der alte Pfarrer hat jedesmal gebetet:
»HERR, segne auch die Opfergaben und deren Geber«. Aber dieser junge Spund vorgestern, der denkt an so etwas –“
„Ist ja auch sehr wichtig“, würzte der Alte mit Zweifel und Fragesalz: „die Bitte um materiellen –“
„Das braucht Ihr gar nicht so ironisch zu sehen“, stand Donna Richelin auf einer anderen Warte, „natürlich ist das wichtig! An Gottes Segen ist alles gelegen; so steht’s schon in der Bibel –“
„– wenn’s jemand als Widmung hineingeschrieben hat“, ergänzte der Alte, der Wahrheit dienend.
„Dann hat’s eben der alte Gottesmann schon gesagt“, gab sich die Besucherin nicht geschlagen. „Jedenfalls hat
uns unser treuer Herrgott in all den Jahren immer reichlich gesegnet; mich und meine –“
„Hast du das schon mal ausgerechnet?“ hakte der Alte nach.
„So genau nicht“, gab Donna Richelin zu, „aber am Anfang unserer Ehe hatten wir nicht viel, und heute haben wir ein großes eigenes Haus, eigentlich mehr auf der hohen
Kante, als wir brauchen, 3 Kinder, 7 Enkel, und soweit ich das sagen kann: Sie sind alle was geworden. Und wenn ich dem HERRN mehr
geopfert hätte, denn er uns gesegnet hat, dann wär’ ich bestimmt nicht reich geworden. Dagegen – wenn ich mich bei Euch hier so
umschaue, –“
„– dann siehst du kein großes Haus, keine hohe Kante und hörst auch kein Kindergeschrei“, ergänzte der Alte ohne Bedauern. „Tscha, hab’ ich also nicht geopfert? Hat mich Gott nicht gesegnet? Oder waren Opfer und Segen anderer Gestalt?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal eine Königstochter, die – die hieß Guldula, und die suchte jemanden, der einmal Herr über ihr
ganzes Reich sein könne. Nein, versteh mich jetzt nicht falsch: nicht Herr über sie selbst, sondern eben nur über ihr Reich und unter
ihren Augen und ihrem Zepter.
Nun ja, schau und hör dich mal um: Da gibt es solche und solche Herren. Die einen nehmen und
verschwenden; die andern sammeln und sind ein Segen. Und da Guldula eine
gute Landesmutter sein wollte, suchte sie einen Herrn nach dieser Art und nicht nach jener. Deshalb ließ sie verbreiten, sie wolle nur
dem Hand und Herz geben, also: Platz in ihrem Herzen einräumen, wer am besten gesammelt habe.
Das hörten auch die 3 Söhne eines andern Königs. Da sprach der älteste, er sei genau der Richtige, ließ einen
Esel mit einem Teil seines (sic!) Geldes beladen und hinter der Kutsche dreingehen, und los ging die
Reise! Gierwolf hatte sich nämlich die Zeit bis zu seiner Thronbesteigung
verkürzen wollen und sich auf Bankraub und Zusicherei gelegt. Ehrbar – dem Anschein nach! Was Bankraub ist, weißt du. Du gründest ein Bankhaus, stellst eine Lade auf und legst
eine Leimrute hinein; dann lädst du jeden Vermögenden ein, dir sein Geld anzuvertrauen. Am besten: für immer. Will er’s aber zurückhaben – oder ein Erbe –, dann hat er
jedoch nur Anspruch auf das, was er nicht mit dir geteilt hat; was also nicht an deiner Leimrute klebengeblieben ist. Du darfst selbstverständlich nicht vergessen, die Leimrute immer wieder von ihrer Last zu befreien und neu zu bestreichen. Ja, und Zusicherei bedeutet: Du sammelst Geld bei Schicksalsschlägen ein: Erdbeben, Hagel, Unfall und – und – und. Wohlgemerkt: bei; nicht: für! Also, immer, wenn irgendwo was Schlimmes passiert ist, schickst du deine Boten aus, Geld zu sammeln gegen Zusicherung. Natürlich dergestalt: zum nächsten Schaden etwas zuzuschießen; falls noch was übrig
ist und – du künftig noch mehr einsammeln kannst. Und auch da leistet dir eine Leimrute einträgliche Dienste. Kurz und gut: Schon als Kronprinz war Gierwolf sehr reich. An Geld und allem, was er
dafür gekauft hatte: Grundstücke, Manufakturen, eh, und Frauen! Und das wurde ihm nun zum Verhängnis. Und der Esel! Denn ein Esel geht nicht ständig hinterdrein. Folglich mußte Gierwolf oft eine Rast einlegen und, tscha, da er’s inzwischen so gewohnt war, die Puppen tanzen lassen. Für des Esels Dukaten. Er kam also nie in den goldenen Grund zu jener
Königstochter; und nach Hause auch nicht.
Da machte sich Ehrwolf, der 2. Königssohn, auf den Weg;
nicht in einer Kutsche, sondern hoch zu Roß. Er hatte sich darauf gelegt, Ehrungen zu sammeln. Jetzt nicht aus Bosheit, sondern nach dem Motto: Tu viel Gutes und rede darüber noch viel mehr; denn in der Zeit, wo du darüber redest, brauchst du nichts zu tun. Vor allem rede mit
den Zeitungsleuten, daß sie dir sammeln helfen und deine Schätze bewahren. Allein – wie ist es mit den hohen Rössern? Sie scheuen leicht, und dann liegst du in Schmutz und Staub, und das sammeln dir die Zeitungsleute auch. Wie bei Ehrwolf. Er kam nicht zu jener Königstochter und nach Hause auch
nicht.
Zuletzt machte sich Lastwolf auf den Weg. Zu
Fuß! 7 Tage hatte er für seine Wanderung unterstellt, aber daraus wurden 7 Jahre. Tscha, wenn du zu Fuß gehst, siehst du mehr am Wegesrand, bleibst häufiger stehen, und – meistens hast du auch mehr Freude. Da verfolgst du nicht den Gedanken, schöne Blumen zu pflücken und sie der Prinzessin mitzubringen. Das wäre doch Raub, und kommende Wanderer hätten weniger Freude. Nein, du besorgst
dir Leinwand, Pinsel und Farben, und dann malst du die Blumen. Und weil du dir auch Wasser holst, kannst du davon auch was an die
Blumen abgeben. Allein – wenn du malst, kannst du nicht weiterwandern. Auch
geht das nur, wenn draußen die Sonne scheint, vor allem am Morgen und am Abend. Und bei Regenwetter kannst du die Bilder auch nicht
mitnehmen, sondern mußt sie unterstellen. Bald war in jedem Dorf, durch das Lastwolf kam, ein Bild von ihm untergestellt. Und – ausgestellt! Denn die Herbergswirte versprachen sich was davon und gewährten
Lastwolf dafür sogar freie Kost und –
„Und was hat das jetzt mit dem Segnen der Opfergaben zu tun?“ konnte sich Donna Richelin nicht länger
zurückhalten.
„Kommt drauf an, was du gesammelt hast“, ließ sich der Alte nicht beirren. „Jedenfalls kam Lastwolf immer mehr
von seinem direkten Weg ab, weil auch in entfernteren Dörfern Herbergswirte mit einem Bild von ihm Ehre – nein, Gewinst einlegen wollten. Zu den gleichen Konditionen. Na, und dann malte Lastwolf eben ein neues Bild, brachte
es mit, stellte es aus, ließ sich ein Kinderstühlchen bringen, setzte sich dazu und hörte zu. Was er da alles an Leid
sammelte! Auch an Schuld! Geht das überhaupt? Ja, er nahm’s in seine nächsten Bilder auf; denn diese Bilder sammelten auch neue
Hoffnung. Wie im Fluge sammelten ihm die 7 Jahre vorüber, als wären’s einzelne Tage. Am letzten Tage aber, ja, der war am herrlichsten,
denn da kam ihm jemand entgegen – voller Staunen, was der Prinz alles gesammelt hatte. Und siehe,
es war ihr nicht die Hälfte gesagt –“
Doch nun merkte der Alte mal wieder, daß die Besucherin inzwischen gegangen war.
© Stiftung Stückwerken, *20.8.2021, freigegeben am 9.3.2024
Qouz-Note: 2+
***
MamM 1.131 Wohl denen, die da wandeln
„Wart Ihr am Sonntag auch in der Kirche?“ war Donna Sassewitz eher an einer
verneinenden Antwort interessiert. „Jedenfalls hat er gut gepredigt.“
„So?“ würzte der Alte von der Halbinsel
mit Skepsis.
„Es ging um die Psalmen“, ging die Besucherin von einem Nein aus, „genauer: die ersten beiden Verse –“
„– den 3. Vers leider unterschlagend“, seufzte der Alte.
„Und wir sollen die Gottlosen meiden“, fuhr Donna Sassewitz fort, „und die Sünder und die Spötter.“
„Und dann kommst du zu mir?“ wunderte sich der Alte. „Da
hat das Wort vom Sonntag aber wenig Frucht –“
„Wieso?“ kam die Besucherin nicht gleich mit. „Ach so,
ja – Es wird so manches über Euch geredet. Stimmt! Da hat sich am
Sonntag gewiß mancher bestätigt gefühlt, der Euch nicht mehr grüßt. Schon merkwürdig, daß Euch überhaupt noch jemand
besucht.“
„Des Nachts kommt doch noch die eine oder andere“, nahm’s der Alte gelassen, „unsere Kirchenmitglieder haben’s eben nicht so mit der Aufrichtigkeit. Aber es gibt ja noch die andern, die einen Durst haben nach Freude, Zuversicht und Frieden.“
„Macht Ihr eigentlich noch Hausbesuche?“ fragte Donna Sassewitz.
„Nein; aber das hat verschiedene Gründe“, antwortete der Alte. „Auf den 1. Blick eigentlich unchristlich; vor allem, wenn ich an das Gleichnis vom verlorenen Schaf denke. Allein – ich bin weder geweihter Priester noch gesandter Prophet,
sondern nur ein alter Mann“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß – der hieß Herzlieb; und dem waren die Märchen aus dem Orient anscheinend
nicht vergeblich erzählt worden. Er pflegte nämlich, die Provinzen seines Reiches regelmäßig zu bereisen; und zwar nicht in einer prächtigen Kutsche, auch nicht hoch auf stolzem Roß, sondern zu Fuß. Und da niemand in einem mit Staub und Kot behafteten Wandersmann den König vermutete, gewahrte er manches aus 1. Hand, was sonst verborgen
geblieben oder durch Stille Post zugestellt worden wäre.
Schon bei der 1. Wanderung! Da kam er nämlich nach Mockenstadt, der
Hauptstadt der Provinz Mockingen, und – sah die Einwohner einen sonderbaren Sport betreiben. Stell
dir vor, dort saßen auf den Bäumen an den Promenaden Menschen und blickten hinab. Und als Herzlieb dort vorüberging, da prasselte auf
ihn ein Gelächter herab, als wären’s Hagelkörner. Wohl dem, der da innerlich gefestigt ist! Nun, Herzlieb war’s anscheinend, denn er nahm keinen Schaden, sondern ging den Dingen nach. Und da stellte es sich heraus, daß in Mockingen kaum jemand seinem Tagwerk oder Gewerbe nachging, sondern tagsüber entweder furchtsam zu Hause
blieb oder zusah, unbemerkt auf einen Baum zu kommen. Eine Leiter brauchte er dafür nicht, sondern es reichte, an einen Baum zu treten
und sich aufzublasen. Tscha, dem Wohlstand dieser Provinz tat ein solches Verhalten großen Abbruch, und der König überlegte und
überlegte, wie er dem abhelfen könne.
Aus diesen Gedanken schreckte er erst auf, als er nach Eilenbürch kam, der Hauptstadt der Provinz Eilingen. Dort saß niemand auf Bäumen herum, sondern dort waren sozusagen alle und alles in
Bewegung. Die Stadt lag nämlich auf einem steilen Berge, an dem Treppen hinauf- und von dem Rutschen hinabführten. Und ständig waren die Einwohner tagsüber damit beschäftigt, hinunterzurutschen, auf den Treppen hinaufzusteigen, und das nur, um wieder
hinunterzurutschen. Und keiner hatte Zeit! Weder zu Gewerbe oder Hantierung
noch dazu, Kranke zu pflegen oder Alte zu besuchen. Ja, es fehlte oft sogar die Zeit, um sich satt zu essen. Entsetzt ging der König weiter, und es fiel ihm nichts ein, wie er diesen Bürgern hätte helfen können.
So kam er nach Wiegenschwert, der Hauptstadt der Provinz, eh, Irgendwo. Dort saß jeder, der etwas auf sich hielt, von morgens bis abends im – Ratssaal. Jaha,
eine sitzende Bürgerschaft! Und jeder von ihnen hatte vor sich ein kleines Tischchen, und auf diesem Tischchen stand ein
Spiegel. Nur war jeder dieser Spiegel etwas gedreht, auf daß in ihm sein Besitzer nie sich selbst sah, sondern stets andere
Ratsmitglieder. Und dann wurde debattiert. Über was? Tscha, wenn dort wenigstens schöne Frauen gesessen hätten! Aber dort saßen nur
Männer, in der Mehrheit, und Frauen, die alles andere als schön waren. Und nun kannst du dir gewiß ausmalen, daß dort vor allem über
Makel gestritten wurde, die sich in den Spiegeln schonungslos zeigten. Jeder kämpfte gegen jede; und was das für den Wohlstand eines Gemeinwesens bedeutet, brauche ich dir gewiß nicht näher darzulegen. Auch hier hätte der König gerne geholfen, wußte aber keinen Rat.
Ob ihm in seiner Residenz jemand raten konnte? Allein –als er zurückgekehrt war und sich seine Höflinge
genauer betrachtete, ward seine Hoffnung zunichte. Wenn du irgend etwas verbessern willst, dann darfst du keinen um Rat fragen, der den
Opportunismus praktiziert. Wenn du etwas verbessern willst, dann mußt du einiges anders machen, und dazu brauchst du Menschen, die
anders sind; auch wenn anders nicht immer besser bedeutet.
Mit dieser Erkenntnis trat der König an ein Fenster seines Arbeitszimmers und schaute hinab in den Schloßhof.
Dort war ein besonderes Völkchen aufmarschiert: in bunten Kleidern, mit fröhlichen Gesichtern und lustigen Bewegungen.
Vitaliener! Und schon wurden Instrumente hervorgeholt, und zum König hinauf stieg eine Musik und ein Gesang, das es –
„– überhaupt nichts mehr mit den Psalmen und der Sonntagspredigt zu tun hat!“
konnte sich Donna Sassewitz nicht länger zurückhalten.
„So?“ war der Alte anderer Ansicht. „Jedenfalls war’s
eine Freude, dem Treiben zuzusehen und zuzuhören, und sie fiel dem König tief ins Herz. Und was ins Herz fällt, wird zu einer Kraft,
und diese Kraft will tätig sein, ziehen und treiben. Und so kam es, daß 7 Tage später in
Mockenstadt ein Gelächter zu hören war wie nie zuvor. Aber kein Gelächter dauert ewig; tscha, und dann kam’s! Die sonderbaren Vitalienerinnen und Vitaliener spielten auf
und sangen und tanzten, daß nach und nach alle Baumsitzer herunterkamen und sich anstecken ließen. In Eilenbürch war’s nicht
anders. Wer konnte bei so etwas noch rutschen wollen? Und in Wiegenschwert
hielt’s auch niemanden mehr im Ratssaal. Und allen ging’s wie dem König: Es fiel ihnen ins Herz. Und dann geschah das Wunderbare! Zwar blieben jene Städte und Provinzen bestehen,
aber alle Mockenstädter, Eilenbürcher, Wiegenschwerter und wie sie sich alle sortiert hatten, wurden zu Landeskindern; und der
Wohlstand ward zu einem Wohlgang, da’s der Herzen –“
Aber unserem Alten war die Zuhörerin mal wieder abhanden gekommen.
© Stiftung Stückwerken, *26.8.2021, freigegeben am 10.6.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.132 Ein immer fröhlich’ Herz
„Wißt Ihr eigentlich, was über Euch geredet wird?“ fragte Donna Puste-Blum.
„Muß ich das wissen?“ bezweifelte der Alte von der Halbinsel sehr.
„Eigentlich dürfte ich Euch gar nicht mehr besuchen“, ließ die Besucherin nichts Gutes ahnen.
„Steht’s so schlimm?“ widersprach des Alten Lächeln seiner Frage.
„Wenn das alles wahr ist“, bestätigte Donna Puste-Blum, „dann ist es sehr schlimm.“
„An Gerüchten ist immer etwas Wahres dran“, fuhr der Alte in seiner Widersprüchlichkeit fort, „selbst wenn der Gerüchtekoch aus seinem eigenen Schrank würzt und die
Serviererin mit eigenen Haaren.“
„Eben!“ nahm’s die Besucherin als pauschale Zustimmung.
„Dann solltet Ihr Euch eigentlich schämen!“
„Tscha“, meinte es der Alte nicht als Zustimmung, „vor Gott hab’ ich dazu wirklich immer Grund und Anlaß und seh’s auch
ein; aber vor Menschen? Nee, unter Menschen kommt beim Sollen nie was Gutes
–“
„Also auch noch obendrein frech?“ neigte Donna Puste-Blum eher zu einem Ausrufezeichen. „Dann ist Euch tatsächlich nicht mehr –“
„– durch ein Sollen zu helfen“, ergänzte der Alte. „Wer etwas an mir auszusetzen hat, mag mir das offen
sagen; und dann kann ich dazu auch Stellung nehmen. Aber mich zu
verurteilen, ohne mich anzuhören, vermutlich sogar ohne Beweise, und hinzurichten, das ist weder christlich noch Brauch unter rechtschaffenen Heiden, sondern ungerecht und gottlos“, und er begann
zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger König, der hieß –, ja, der hieß Bärenherz. Kein Wunder, daß er kein süßwürzendes
Mundwerk hatte wie die Diplomaten oder eine gespaltene Zunge und auch kein Händchen und kein Pfötchen fürs hinterlistige Anschleichen.
Einem offenen Kampf ging er dagegen nicht aus dem Wege und wußte sich dabei stets siegreich zu behaupten.
Nun hatte der König aber 2 Beraterinnen: eine schwarze Fee und eine weiße Fee. Die weiße Fee hielt sich
auffallend zurück; ja, als denke sie: Laß ihn mal machen, und wenn er dich braucht, wird er sich schon melden. Die schwarze Fee war da ganz anders. Sie drängte den König dazu, bei Audienzen und in
Sitzungen mit seinen Kenntnissen zu strahlen und immer alles besser zu wissen. Sie lenkte seine Blicke auf die schönen Mädchen und
Frauen in Stadt und Land, und zwar so, daß dies nicht unbemerkt blieb, sondern als Gunst und Wertschätzung entgegengenommen werden konnte. Sie ließ ihn gar in der Kirche laut protestieren, wenn der Geistlichkeit ein Versehen unterlief; und wer weiß, ob diese Fee nicht sogar für dieses Versehen Patin gestanden hat.
Na, du ahnst es bestimmt schon: Beliebt machte sich der König so nicht. Und da ihm offen nicht beizukommen
war, wurden die Geschütze hinter seinem Rücken aufgefahren. Allen voran die Unglimpfkanone! Ein fatales Geschütz! Es wird mit Kugeln aus Kot und Schmutz geladen, die sich nach
dem Abschießen zerstäuben. Trifft dieser Staub einen Menschen im Rücken, merkt er selber das gar nicht, so daß du den Angriff mehrfach
wiederholen kannst, bis der ganze Rücken mit diesem Staub bedeckt ist. Und wenn’s dann regnet, verbreitet dieses – dieses Zeug einen
abstoßenden Gestank. Und selbst davon muß der Getroffene nichts merken, solange er keinen Rückenwind bekommt.
Tscha, und was waren das nun konkret für Kugeln und wo kamen sie her? Nun, auch ein König hat in der Kindheit
Lehrer gebraucht, und nicht von allen trennt er sich in gutem Einvernehmen. Da braucht später nur mal einer fallenzulassen, der König
sei eigentlich dumm und arbeitsscheu, und schon wird’s aufgegriffen und als Kanonenfutter eingesetzt. Oder eine Schürze fühlt sich vom
König nicht genügend umworben und bevorzugt. Die braucht nur fallenzulassen, der König sei ein wüster Schürzenjäger, schon wird’s
aufgegriffen. Und wenn dann jemand die königliche Kutsche dort gesehen hat, wo nachts die roten Laternen locken, na, dann wird’s mit
dem Schürzenjägertitel zusammengepappt, selbst wenn der König gar nicht in der Kutsche gesessen hat. Ja, und die sich bloßgestellt
gefühlte Geistlichkeit braucht nur fallenzulassen: Unruhestifter, Ketzer, Gotteslästerer. Und alle Kugeln trafen!
Direkt merkte der König davon erst einmal nichts. Freilich – immer weniger Untertanen baten um eine Audienz
bei ihm. Bei Sitzungen blieben immer mehr Stühle leer; und was bisher in
Aussprachen beigelegt werden konnte, blieb nun als schriftliche Forderung wie ein Bollwerk stehen. Und weil immer weniger mit dem König
sprachen, fehlten diesem immer häufiger wichtige Entscheidungsgrundlagen; ja, Landstände und Höflinge gingen sogar dazu über, die
Zugänge des königlichen Arbeitszimmers zu immer mehr Dienstwegen zuzuschütten und zuzuhecken. Auch die schönen Frauenzimmer schütteten
und heckten zu, nämlich den Zugang zu ihren Augen, und zeigten dem König nur doch die kalte Schulter. Und die Geistlichkeit? Die wandelte dem König dessen Abendmahlsgang zu einem Gerichts- und Schafottgang mit unverwandeltem Brot und Wein.
Es macht bestimmt nicht fröhlich, ausgegrenzt zu werden; und Bärenherz schlug das alles derart aufs Gemüt, daß
er gedachte, abzudanken. Mit gesenktem Kopf schritt er eines Abends durchs Schloßtor und durchs Tor seiner Residenzstadt hinaus und war
sich sicher, nie mehr zurückzukehren. Die Sonne ging in zärtlicher Röte unter, aber Bärenherz gewahrte es nicht. Der Mond bot einen freundlichen Abendgruß, aber Bärenherz gewahrte ihn nicht. Sterne
kündeten von Treue und Ewigkeit, aber Bärenherz gewahrte es nicht. Ja, er gewahrte noch nicht einmal die Gestalt, die da am Wegesrand
hockte und innig von Mond und Sternen das Abendlied sang. Kurzerhand stellte sie dem späten Wandersmann ein Bein, aber so, daß er sanft
fiel; und schon war eine Brücke gebaut, auf der in die eine Richtung der Kummer rollte und in die andere Richtung Trost.
Es sei töricht, sich selber zu betrüben, selbst wenn einem etwas angehängt werde, das so übel rieche wie hier beim Wanderer. Und schon hatte ihn die Gestalt zu einem Bach geführt, wo er sich und seine Kleidung waschen konnte. Gut, daß der Sommer noch eine Zulage ausgehandelt hatte, so daß sich Bärenherz nicht erkältete. Und dann ging’s ab in den –“
„Und was hat das jetzt alles mit Eurem schlechten Ruf zu tun?“ konnte sich Donna Puste-Blum nicht länger
zurückhalten.
„– Schäferkarren; natürlich sittsam!“ war der Alte noch
in vollem Lauf, ehe er antworten konnte: „Am besten: nichts! Der König jedenfalls ward schon im Morgengrauen wachgerüttelt, denn das
Tagwerk einer Schäferin fängt früh an. Und als die Sonne golden aufging, da ward der König gefragt, was er sähe. Weiße Schafe mit schwarzen Flecken, antwortete er, und ein schwarzes Schaf, bei dem helle Punkte leuchteten, als wären’s Edelsteine. Und in des Königs Herz zog Freude ein, und seine Augen blickten wieder wacker, und er gedachte, seine Amtsgeschäfte wieder aufzunehmen, doch
nicht allein, sondern –“
Jedoch – unserm Alten war die Zuhörerin mal wieder abhanden gekommen.
© Stiftung Stückwerken, *2.9.2021, freigegeben am 10.6.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.133 Und den Kindern das Lachen
„Und dann reißt sich doch die Kleine los“, berichte Donna Almuth, „rennt nach vorne und legt ihre Puppe auf den Altar –“
„Vielleicht das Liebste“, kommentierte der Alte von der Halbinsel, „was sie
außer ihren Eltern hat.“
„Na, da hättet Ihr mal den Herrn Pfarrer sehen und hören müssen! Das sei eine Entweihung von Altar und
Abendmahl!“ fuhr die Besucherin fort. „Mit ihr werde es noch ein schlimmes Ende
nehmen! Die Kleine begann herzzerreißend zu weinen, und der Herr Pfarrer drohte, erst weiterzumachen, wenn der Frevel beseitigt
sei. Da mußte die arme Mutter vor der stehenden Gemeinde Spießruten laufen und die Puppe zurückholen, während ich mich um die Kleine
gekümmert habe. Und dann hat der Herr Pfarrer nicht weitergemacht, sondern noch einmal von vorne mit der Aussonderung
begonnen. Ich sag’ Euch, das war ein Abendmahl, –“
„– bei dem Jesus noch einmal gekreuzigt wurde“, ergänzte der Alte, „und zwar nicht von dem kleinen Mädchen!“
„Das Ganze soll noch ein Nachspiel haben“, erzählte Donna Almuth: „Es heißt: Die Kleine soll Kirchen-, also Hausverbot bekommen.“
„Und Jesus spricht: »Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.«“, zitierte der Alte. „Wer’s somit dennoch tut, der ist nicht im
Reich Gottes. Wie damals die Hohenpriester und Schriftgelehrten! Ja, es ist schon traurig, wie unchristlich es oft in sogenannten christlichen Kirchen zugeht: Gebote statt Verbote und herzloses Hinrichten statt
beseelter Barmherzigkeit“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, dem ward noch im hohen Alter ein Thronerbe geschenkt; genauer: eine
Thronerbin. Da er aber ferne über Land verreisen mußte (Er hatte nämlich noch ein neues Reich
einzunehmen), ließ er sein Töchterlein in der Obhut seines – des Königs – Bruder zurück und ernannte diesen zum Reichsverweser.
Nun muß ich aber gleich am Anfang betonen: Dieser Reichsverweser war kein boshafter Mensch. Allein – wir alle
haben auch unsere Schattenseiten, und bei ihm war es – tscha, das Gefühl, berufen zu sein. Wozu? Das Reich nun 21 Jahre lang zu regieren und dann Thron und Reich seiner Nichte zu übergeben. Aus dieser Berufung folgte aber auch, den König nicht mehr in sein Land zurückkommen zu lassen, sondern fernzuhalten.
Wenden wir uns Liebeseel zu, der Kronprinzessin! Königin
hieß das Ziel, 21 Jahre weit war der Weg, und kein Abweg und kein Umweg sollten ihren Fuß verleiten. Von Anfang an! Was das heißt?
Eine Königin weint nicht, eine Königin lacht nicht, eine Königin zeigt sich stets selbstbeherrscht. Nach
Ansicht ihres Onkels! Den Widerspruch bemerkte er nicht: Findet ein Kind zur Selbstbeherrschung, wenn es durch andere beherrscht
wird? Nun, der Onkel wähnte mährsächlich, Zwang führe zum Ziel. Zwang,
immer eine Maske zu tragen, wenn andere Menschen in der Nähe waren oder ein Spiegel. Ein Alptraum, sich das vorzustellen! Auch wenn’s keine Gruselmasken waren, sondern lächelnde Fassaden, so waren sie aber wie Eisblumen, doch beständig. Und wehe, dieses Gebot wurde gebrochen! Oder es wurde sogar gelacht! Laß mich bitte über die Art der Strafen schweigen, sie könnten sonst nachgeahmt werden. Nur einer hielt sich nicht an dieses Gebot, aber nur heimlich: der dolle Dieter! Der sorgte dafür, daß Liebeseel das Lachen nicht verlernte und ihre Seele nicht verlor.
Es gab jedoch noch mehr Gebote. Onkel Kloppenburg
verfügte, daß seine Nichte stets eine weiße Weste tragen müsse und auch sonst weiße Kleidung. Und wehe, es zeigte sich darauf irgendein
Schmutzfleck! Eine Königin müsse stets makellos gekleidet sein, am besten: in reinem Weiß! Stell dir das mal vor: Du darfst als Kind nie hinfallen! Wie willst du da das
Aufstehen lernen? Gut, daß es dafür den dollen Dieter gab! Auch dabei:
alles heimlich!
Ja, und dann die Forderung Kloppenburgs: Eine Königin müsse stets Selbstsicherheit ausstrahlen; also den
Eindruck: alles besser zu wissen und besser zu können als andere. Erst recht im Krieg! Dazu bequemte sich der Onkel höchstpersönlich, seine Zinnsoldaten gegen die seiner Nichte kämpfen und – verlieren zu lassen. Und damit diese sich das Töten nicht zu Herzen nehme, ließ Kloppenburg zum nächsten Kriegsspiel alle Gefallenen wieder auferstehen. Doch eines Tages zerbrachen beim Gefecht einige Soldaten und standen nimmer auf. Da
tobte der Onkel und erkannte dem Zinngießer den Titel Königlicher Hoflieferant ab. Nur eine ahnte, daß den Zinngießer keine Schuld
traf; und einer wußte das.
Nun begab es sich aber, daß Liebeseel kurz nach ihrem 7er Geburtstag durch den Schloßpark wandelte, als ihr plötzlich ein Fremder in
den Weg trat. Der Mann musterte sie, schüttelte den Kopf, drehte sich um und verschwand wieder. Vergebens suchte die herbeigerufene Parkwache nach ihm; zumal die Beschreibung durch
die Prinzessin nicht sehr genau war: abgetragenes Schuhwerk, schäbige Kleidung, ein ältliches Gesicht mit vielen Falten. 7 Jahre später wiederholte sich das Ganze – mit gleichem Ausgang.
Endlich war Liebeseel 21 Jahre alt, setzte sich auf den Thron, regierte, und – es war entsetzlich! Stell dir nur vor: Immer mußt du etwas scheinen, was du gar nicht bist. Und um dich
herum lauter Masken, die stets etwas vorgaukeln, was nicht hinter ihnen steckt. Hast du diesen Maskenball verinnerlicht, dann mag’s
noch angehen; aber Liebeseel, – die hatte das nicht verinnerlicht. Und du
ahnst gewiß, wem sie das zu verdanken hatte.
Jedenfalls – kaum war der Kriegsminister dabei, einen Krieg anzuzetteln, da hielt Liebeseel nichts mehr in ihrem Schloß, und sie floh Hals über Kopf von
dannen. Aber einer wich nicht von ihrer Seite. Und der war es auch, der ihr
herbstliche Wanderkleidung gab und festes Schuhwerk und – ihr die Maske abriß; jenseits der Grenze. Und sich ebenso –
„Was hat das jetzt mit dem Kind und unserm Herrn Pfarrer zu tun?“ konnte sich Donna Almuth nicht länger
zurückhalten.
„– verwandelte“, war der Alte noch in vollem Lauf. „Kommt drauf an, wer wie die Weichen stellt. Und wie langsam der Zug rollt. Bei unsern beiden Wandersleuten war es schon die
Müdigkeit, die das Hasten und Hetzen verhinderte. Und der Hunger! Bereits
vor der Grenze hatten sie um Brot gebettelt, doch niemand von den Maskenträgern gedachte, seins mit den beiden zu teilen. Doch kurz
hinter der Grenze gesellte sich ein weiterer Wanderer zu den beiden, nachdem er der Königin ins Gesicht geblickt, gesucht und dann doch etwas gefunden hatte. Etwas, was ihn zuversichtlich lächeln ließ. Dann teilte er mit ihnen sein Brot und
gab ihnen von der Trauben Saft, daß die Kräfte reichten bis zur nächsten Herberge. Dort hatten die Königin und ihr jugendlicher
Begleiter in der Nacht einen ähnlichen Traum: Sie wanderten und wanderten; zurück; und ihre Füße wurden immer kleiner. Doch als die beiden erwachten und aufbrachen, da
ging’s vorwärts, und nach 7 Tagen waren sie in des Vaters neuem Reich. Und bald war Hochzeit, und
–“
„Ich hab’ Euch verstanden“, lachte die Besucherin, ließ sich hinausgeleiten und zitierte dabei aus den Evangelien den Lieblingsspruch unseres Alten.
© Stiftung Stückwerken, *9.9.2021, freigegeben am 11.6.2024
Qouz-Note: 2-
***
MamM 1.134 Der Sämann des Bösen
„Wer hat eigentlich das Böse geschaffen?“ wollte Donna Evaline wissen. „Gott?“
„Da mußt du ihn schon selber fragen“, schob’s der Alte von der Halbinsel
ab. „Vielleicht war’s auch der Mensch –“
„Wie das?“ hakte die Besucherin nach. „Die Schlange ist
doch von Gott geschaffen worden, denn so steht’s in Eurem Buch dort: das listigste Tier von allen, die Gott geschaffen
–“
„In meiner Bibel steht dort nur der Komparativ“, stellte der Alte richtig, „und die Schlange außerhalb der Tiere auf dem Felde, die Gott gemacht hatte. Allein – es ist müßig,
sich über Wörter, Berichte und Übersetzungen zu streiten. Und wie du weißt, bin ich kein Schriftausleger, sondern will lediglich
mitteilen, was mir eine Schrift gibt. Beim Bericht über den Sündenfall gibt’s mir heute eine Ahnung: Es kommt nichts Gutes dabei
heraus, wenn ich meine Eitelkeit oder das Prinzip der Unabhängigkeit über das der vertrauensvollen Liebe stelle.“
„Und wer will das?“ fragte Donna Evaline.
„Ich, wenn ich Mangel empfinde“, antwortete der Alte. „Das kann ein Mangel an Anerkennung sein, aber auch an
Freiheit. Wenn sich das dann zu einer Unzufriedenheit auswächst, dann könnte es irgendwann durch mein Vertrauen nicht mehr eingedämmt
werden. Dann wird daraus Flucht und Heimatlosigkeit und ständiger Argwohn.
Und dann ist’s kein großer Schritt mehr zur Handlungsmaxime: Werde Täter, bevor sie dich zum Opfer machen.“
„Ein Trost ist das bestimmt nicht, was Ihr Euch da zurechtgereimt habt“, kommentierte die Besucherin, „wenn Ihr’s von Euch auf alle Menschen verallgemeinert.“
„Hab’ ich das getan?“ verneinte der Alte. „Ich hab’
lediglich den Weg zurückverfolgt, wie Menschen das Böse erschaffen haben könnten. Aber kein Mensch muß auf diesem Weg bleiben“, und er
begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger König, der hieß – der hieß Schwarzenerd. Lange saß er noch nicht
auf seinem Thron, da breitete sich im Land das Gerücht aus: Der König habe ein schlimmes Verbrechen begangen. Dieses Gerücht drang
schließlich auch an des Königs Ohren, und siehe da: Schwarzenerd bekannte sich zwar nicht als alleinschuldig, aber als mitschuldig. Da
hätte das Volk gerne über seinen Regenten Gericht gehalten, aber das ging nicht; denn der König war der oberste Richter im ganzen Reich
und über ihm nur Gott. Mancher im Volk resignierte darüber, aber es gab auch Volkstribunen, die offen zur Rebellion
aufriefen; und es gab dunkle Gestalten, die sich berufen fühlten, einen Meuchelmord zu begehen. Und wenn du in die Menschheitsgeschichte blickst, siehst du immer wieder: Es bleibt nicht bei einer einzigen Tötung. Überhaupt: Welch ein Irrsinn, durch ein neues Verbrechen ein altes ausgleichen und Gerechtigkeit wiederherstellen zu wollen! Jedoch – was hilft es da schon, an Vernunft und Einsicht zu appellieren? Wollte
Schwarzenerd Bürgerkrieg und andere Tötungsdelikte verhindern, gab’s für ihn nur einen Weg: abzudanken und außer Landes zu fliehen, als wolle er Gott zum
Richter bestellen. Und das tat er auch bald.
Nun traf es sich aber gut, daß Morgenrot, das einzige Kind der Königin von Morgenreich, verbreiten ließ, auf ihren Bräutigam zu warten. Wer das sei, wisse sie noch nicht, wolle es ihm
aber hiermit anzeigen. Weil sich Schwarzenerd davon angesprochen fühlte, gedachte er, das Notwendige mit dem Nützlichen zu verbinden,
setzte sich also in seine Kutsche, und los ging die Fahrt! Kurz hinter der Grenze tat es aber einen heftigen Schlag, um Schwarzenerd
schien sich alles zu drehen, und dann wurde es dunkel vor seinen Augen.
Als er wieder erwachte, tat ihm sozusagen alles weh; doch sobald er seine Augen öffnete, war’s zu
ertragen. Wie das? Über ihn beugte sich nämlich ein lächelndes Antlitz und
sagte: Es wird alles wieder gut. Lautlos, nicht den Ohren! 3 Tage ließ sich Schwarzenerd nun pflegen, aber dann hielt’s ihn nicht mehr auf seinem Lager. Er solle und
müsse dringend fort; und weil ein Pferd den Straßenräubern entkommen war, schwang sich der abgedankte König hinauf und ritt
davon. Was aus dem lächelnden Antlitz werde, kümmerte ihn überhaupt nicht, denn bei genauem Hinsehen hatte die Kleidung der Pflegerin
nicht dafür gesprochen, daß diese aus einem edlen Hause stamme. Und wieder dauerte es nicht allzu lange, bis sich wieder etwas
drehte; und es war nicht das Pferd.
Als der Reitersmann, der nun noch nicht einmal mehr ein Königreich hätte anbieten können, wieder zu sich kam, war’s gleichzeitig zu jenem lächelnden Antlitz. Schwarzenerd wollte natürlich gleich fort, aber seine Pflegerin bat ihn, zu bleiben;
und sie tat’s mit einem Lächeln, daß er’s ihr nicht abschlagen konnte. In der Nacht hatte er einen Traum: Der Sämann des Bösen schreite
über sein, eigentlich Schwarzenerds, Land, und schwer falle der Same nieder, und Unkraut bedecke alles bald. Als Schwarzenerd dies am
nächsten Morgen seiner Pflegerin schilderte, konnte auch sie mit einem Traum aufwarten: Gutes sei auf jenem Land aufgegangen und emporgewachsen und habe alle Unkraut verdorren und zu Dung werden
lassen. Auch am nächsten und übernächsten Morgen wiederholten sich diese Traumberichte. Hatte das etwas zu bedeuten? Schwarzenerd ahnte da etwas, wollte es aber nicht
glauben. Deshalb entdeckte er seiner Pflegerin, was er Schlimmes getan und welch eine schwere Schuld er auf sich geladen
habe. Und davon könne er sich sein Leben lang nicht mehr befreien. Es sei
deshalb auch völlig sinnlos, weiter ins Morgenreich zu reisen, zumal er niemanden unglücklich machen wolle. Seine Pflegerin wollte ihm
auf diesem Wege der Resignation nicht folgen, sondern schlug einen anderen Weg vor. Eben weil er’s doch nun aus eigener Erfahrung
kenne, was es heiße, schwer an seiner Schuld zu tragen und sich selber aufzugeben, sei er doch der ideale König, einem ganzen Volk zu helfen. Er möge sich ihr nur anvertrauen, und sie wolle ihn den schnellsten Weg zu jener Kronprinzessin führen.
Endlich gab sich Schwarzenerd einen Ruck, sie wanderten los, und mährsächlich standen die beiden am Abend des 7. Tages am
Wassergraben, der das königliche Schloß umgab. Die Zugbrücke war bereits hochgezogen, und Herz und Mut des abgedankten Königs sanken
wieder sehr tief. Aber da hatte die Pflegerin bereits einen Kahn ausfindig gemacht. Sonderbar: Ob vor einiger Zeit jemand vom Schloß herübergerudert war? Doch zum
Überlegen blieb nicht viel Zeit, denn die Pflegerin drängte einzusteigen, solange es noch nicht stockfinster sei. Und wie sich
Schwarzenerd auf der Wanderung rührend um seine Pflegerin gekümmert hatte, so ergriff er auch hier gleich die beiden Ruder, seine Pflegerin aber bestimmte die Richtung. Nicht zum Schloßtor! Nein, sondern zu einer verborgenen Anlegestelle an der
Schloßmauer. Und kaum war der Kahn festgezurrt, da öffnete die Pflegerin mit einem Schlüssel ein kleines Pförtlein und bat –
„Aber was hat das alles mit meiner Frage zu tun?“ konnte sich die Besucherin nicht länger zurückhalten: „Wer hat
denn nun das Böse –“
„Ist das wichtig?“ verneinte der Alte. „Wichtig ist, daß
jener Traum der Prinzessin wahr wird. Bei Schwarzenerd war’s, als er Verantwortung –“
Aber der Alte war mal wieder allein.
© Stiftung Stückwerken, *16.9.2021, freigegeben am 11.6.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.135 Seifried ohne Land
„Die Spendenbereitschaft sei weiterhin ungebrochen“, berichtete Donna Messenschwab, „und daran sei zu sehen, daß der HERR weiterhin mit
seiner Kirche sei. Aber – was sagt Ihr als Kirchenkritiker dazu?“
„Kirchenkritiker?“, nahm’s der Alte von der Halbinsel nicht an. „Ich trenne und spalte die Kirche? Wie kann ich etwas spalten wollen, von dem ich gar nicht weiß, was es ist? Wer ist
Kirche? Und wenn es etwas ist, was Menschen dient und hilft, wieso sollte ich’s bekämpfen?“
„Aber es heißt doch“, rechtfertigte sich die Besucherin, „Ihr haltet Euch nicht an dem Haupt und widerstrebt der herrschenden –“
„Wie das?“ wunderte sich der Alte. „Ist das Haupt der
Kirche nicht mehr Christus? Daß ich aber etwas gegen das Herrschen habe, gebe ich gerne zu. Jedoch – offen ist mir noch niemand von den Herrschenden entgegengetreten; und daß
ich irgend jemanden von seinem Herrschaftsthron stürzen will, das kann mir noch nicht einmal hinter meinem Rücken vorgeworfen –“
„Dann eben konkret gefragt“, unterbrach Donna Messenschwab: „Ist’s recht, daß wir der Kirche den Zins geben?“
„Und welchen Zinsgroschen könnte sie mir zeigen?“ lachte der
Alte. „Die Antwort kannst du dir bereits denken: Der dienenden Kirche geb’ ich gerne, der herrschenden aber keinen Kreuzer“, und er
begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß – der hieß Seifried. Der war noch sehr jung und hatte weder Volk noch
Land. So kann’s gehen – im Mährchen! Also mußte er sich ein Volk suchen,
und das stell dir nicht so einfach vor. Geh nur mal in eine fremde Stadt, stell dich dort mitten auf den Marktplatz und sag den
Menschen, du wärest die neue Königin. Die werden dir was husten, die werden dich auslachen, die werden dich mit Schimpf und Schande zum
Tor hinausjagen. Nein, das mußt du schon geschickter anfangen. Und
Flugblätter in den Hauptstädten verteilen zu lassen, das hilft auch nichts. Nein, da mußt du dich schon selber aufmachen und erst
einmal umhören und umschauen.
So kleidete sich also Seifried wetterfest wie ein Wandersmann, wanderte los und kam nach – nach Affiën. Gleich hinter der Grenze fiel’s dem König auf, daß sich die Affiër mühten, alle das gleiche Aussehen zu haben: gleiche Schuhe, gleiche Kleider,
gleicher Haarschnitt. Wie das? Nun, die Schnur zu diesem Schlüssel fand
Seifried in der Hauptstadt. Dort waren große Plakate angeschlagen, die zeigten, wie ein rechter Affiër auszusehen hätte. In der jetzigen Saison! Denn war die Saison vorbei, wurden geschwind die alten
Plakate durch neue ersetzt. Und dann gab’s ein großes Gedränge beim Schuhmacher, bei der Schneiderin, beim Barbier; denn jeder wollte so schnell wie möglich wieder ein rechter Affiër sein; und nicht
aus der Zeit gefallen. Das trieb groteske Blüten! Wer kurz von Wuchs war,
ließ sich hohe Absätze anfertigen oder ging gar auf Stelzen; wer gut genährt war, schnürte sich den Bauch ein; und auf wessen Haut sich Falten zeigen wollten, der schmierte diese mit Schminke zu, als wolle er in einem Schauspiel auftreten. Schauspiel, das war wohl das treffende Wort für Affiën. Niemand war dort sie oder er
selber, sondern jede und jeder spielten die Rolle der rechten Affiërin und des rechten Affiërs. Nein, das war nicht Wesen von seinem
Wesen, empfand Seifried und wanderte weiter. Dabei kam er an prächtigen Landsitzen vorbei, und er ahnte, daß so mancher einen enormen
Profit aus diesem Affiërtheater zog.
In Danistan war das ganz anders. Hier gab es anscheinend keine großen
Landsitze, sondern alle Bürger wohnten in den Städten. Hinter hohen Mauern und festen Toren. In engen Gassen. Dicht gedrängt. Voller Argwohn ließ die Torwache den König ohne Land die Hauptstadt Danistans betreten, obwohl bereits die Wächter kaum den Blick
hoben. Überhaupt hielten die Danistaner die Augen meistens gesenkt; und
taten sie es nicht, so war’s mit einem scheelen Blick auf andere Menschen. Das größte Gebäude der Hauptstadt war nicht die Vogtei oder
das Rathaus oder die Kirche, sondern das Gericht. Dorthin führte Tag für Tag die Stadtwache Angeklagte hinein und Verurteilte wieder
heraus, auf daß an diesen die Strafe umgehend vollzogen werden konnte. Da hätte eigentlich jeder Danistaner in ständiger Angst leben,
ja, sein Dasein fristen müssen. In Angst, der Stadtwache angezeigt und von dieser abgeführt und vorgeführt zu werden. Sicher war vor so etwas niemand. Ob die Danistaner deshalb ihre besondere Taktik
entwickelt hatten? Welche? Na, ihre scheelen Blicke! Denn während du bei deinen Mitmenschen nach den dunklen Seiten suchst, kannst du’s nicht bei dir selber tun und hast auch keine Angst. Ja, durch rechtzeitiges Anzeigen kannst du sogar manchem zuvorkommen, der dir etwas am Zeug flicken wollte. Ach, was war Seifried froh, Hauptstadt und Land zu verlassen und endlich wieder frei atmen zu können. Nein, Wesen von seinem Wesen hatte er hier nicht gefunden.
So kam der König schließlich nach Paulaniën. Ei, wie ging es da lustig
zu! An den Wegrändern blühten wilde Blumen, an den Bäumen hing das reife Obst, und – nun ja, genau schienen es die Paulaniër mit dem
Ernten nicht zu nehmen. Auf den Stoppelfeldern hätte noch mancher Nachlese halten können, die Obstbäume waren nicht eingezäunt, und
niemand hatte etwas dagegen, wenn sich ein Wandersmann seinen Mundvorrat pflückte. Trotzdem schienen die Paulaniër nicht zu darben,
sondern waren zwar klein von Gestalt, aber kugelrund. Der Blick war offen, nahezu kindlich und frei von Verschlagenheit. Und immer zum Lächeln bereit. Zwar zunächst etwas schelmisch, wenn sie mit schiefem
Kopf zum Wandersmann aufschauten; war dann aber die Brücke gebaut und gefunden, was gesucht, dann zeigte sich ein breites Grinsen: Heh,
Bruder! Die Städte waren groß und weit und selbst die Stadthäuser von breiten Gärten umgeben. Die Kinder sangen ihre Lieder, wie sie’s verstanden, und auch die Alten hatten das Singen nicht verlernt. Und wie der König sich so umhörte und umschaute, da ging ihm richtig das Herz auf, und er fühlte sich zu –
„Aber was hat das jetzt mit dem Zins für die Kirche zu tun?“ konnte sich Donna Messenschwab nicht länger
zurückhalten.
„– Hause“, bremste der Alte ab. „Och, eh, viel!
Stell dir mal vor, du wirst Bürgerin eines Volkes, in dem’s vor Leben nur so sprudelt, tätest du da deinen Zehnten nicht gerne geben?
In Affiniën und Danistan aber wäre es vergeudet und wie ein Samenkorn auf steinigem Boden und unter Dornen und Disteln. Freilich – die
Affiniërinnen und Danistanerinnen müssen ja nicht ewig so bleiben; bestimmt kommen von ihnen mal einige nach Paulaniën, und es geht
ihnen dort das Herz auf. Ach, daß es allen –“
Aber unser Alter war mal wieder allein.
© Stiftung Stückwerken, *23.9.2021, freigegeben am 12.6.2024
Qouz-Note: 3-
***
MamM 1.136 Der sprechende Rabe
„Eigentlich ist es da ja ganz schön“, berichtete Donna Pen-Ybel von ihrer Matronenstube, „aber da erzählt doch neulich meine Tischnachbarin,
daß sie am Sonntag große Wäsche gehabt habe. Gehört sich das? Was sind das
für neue Sitten? In Eurem Buch da steht: Du sollst den Feiertag heiligen –“
„Tscha“, lachte der Alte von der Halbinsel und rieb sich dieses Mal nicht an
seinem Reizwort, „du! Nicht deine Tisch–“
„Ich hab’ noch nie am heiligen Sonntag gewaschen!“ brüstete sich die Besucherin. „Das käme mir nie in den Sinn!“
„Aber nun ist’s drin“, äußerte der Alte Mitleid. „Ja, ja, das Richten macht das Herz nicht
leichter. –“
„Aber das geht doch nicht!“ entrüstete sich Donna Pen-Ybel. „Wie kann ich mich einen gläubigen Menschen nennen und den –“
„– Sabbat nicht halten und heiligen“ ergänzte der Alte. „Und? Tust du es? Hast du noch nie am Samstag gewaschen oder Kartoffeln
geerntet?“
„Wer redet denn vom Samstag?“ schloß sich die Besucherin aus.
„Das Gesetz Moses“, antwortete der Alte. „Das Evangelium öffnet
aber eine andere Tür: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen.
Also? Also können wir aus dem Gebot eine Lebensweisheit machen: Du darfst einen Tag in der Woche heiligen und ausruhen von aller Arbeit
und dich freuen, und siehe, es wird dir dann bessergehen.“
„Ich glaube, Ihr seid da auf einem gefährlichen Holzwege“, warnte Donna Pen-Ybel. „Wer da abtut
von den Worten des Buches, bei dem wird Gott abtun vom Holz des
Lebens!“
„– schreibt der Seher am Ende der Offenbarung“, ging der Alte weiter. „Wer wollte es da wagen, diese Worte zu überliefern oder gar zu übersetzen? Schon
dieses eine Buch der Bibel läßt sich nicht verschlingen, ohne es in kleine Häppchen zu zerschneiden. Nee, mein Gott mag ein Gott der Ordnung sein, aber seine Strenge steht
nicht über seiner Liebe, und so will ich’s ihm lieber gleichtun“, und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der hieß – der hieß Anricht; ein junger König! Der wollte nur das Beste für sein Volk. Also fing er bereits bei den Kindern an und
erließ eine allgemeine Schulpflicht; also für alle Kinder ab 4 Jahren. Nun
ja, wer reich genug ist und sich einen Hauslehrer leisten kann, der braucht keine Schulpflicht zu fürchten. Dennoch lähmt’s die Flügel,
wenn etwas Freiwilliges in eine Pflicht verkehrt wird. Wer aber ein Hausgewerbe betreibt oder ein armer Kätner ist, der gibt seine
Kinder nicht gerne weg, selbst wenn er kein Schulgeld bezahlen müßte. Jedenfalls – du kannst dir gewiß denken, daß dem neuen Erlaß viel
Widerstand entgegengesetzt wurde. Angeblich wurden sogar Schulmeister verprügelt und Schulräume verwüstet. Der König verstand sein Volk nicht mehr. Nun hatte er aber einen alten Raben, der
sprechen konnte; und dieser Vogel nahm erst einmal seinen König in die Schule, nämlich die des Raben.
„Ist dir ein Berg zu steil“, empfahl das weise Tier, „dann mußt du ihn eben auf einer Serpentine zu ersteigen versuchen. Besser länger unterwegs, denn unterwegs gescheitert.“
In diesem Sinne hob Anricht die Schulpflicht alsbald wieder auf, sparte aber nicht an Geld und Einfällen, den Unterricht so fröhlich wie möglich zu gestalten. Und nutzbringend! Denn wenn du jemanden in der Familie hast, die oder der lesen und
schreiben und rechnen kann, dann bist du von deinem Zwischenmeister oder Gutsherrn nicht mehr so abhängig, und er kann sich nicht mehr bei dir alles erlauben. Und da ein fröhliches Kind hilfsbereiter ist und eifriger denn ein verdrossenes, sahen’s immer mehr Familien ein, daß der Schulbesuch nicht
schade, sondern die Wohlfahrt fördere.
Als nächstes wollte der junge König sein Volk von der Knechtschaft der Trunkenheit befreien. Also ließ er
kurzerhand und kurzenbeines die Herstellung, die Einfuhr, den Verkauf und den Ausschank aller sogenannten „geistigen“ Getränke verbieten und unter Strafe stellen. Na, da hättest du mal die Winzer, Brauer und Schnapsbrenner sehen und hören müssen, wie sie gegen diesen Unsinn (wie sie’s nannten) Sturm liefen! So viele Gendarmen, so viele Gefängniswärter und Zellen kann ein König gar
nicht aufbringen, um solch ein Verbot durchzusetzen. Wieder wußte der weise Rabe Rat.
„Sag mal“, erinnerte Kunert den König, „wie hast du eigentlich gelernt, daß die Herdplatte heiß ist? Hast du’s gleich geglaubt? Oder hast du’s selber ausprobiert? Na, nun weißt du, was du zu tun hast.“
Tscha, da sorgte der König überall im Lande für einen freien Ausschank dieser „geistigen“ Getränke. Freilich
hatte ihn der Rabe da auf ein gewisses Pulver aufmerksam gemacht, das der König heimlich in die Fässer und Flaschen geben lassen möge.
So kam’s, daß jeder Trinker nicht mehr über sich hinauswuchs, sondern sich bereits beim Trinken hundeelend fühlte und wie ein kleiner Mistkäfer vor den Hufen einer herangaloppierenden
Herde. Wer hatte da fortan noch Vertrauen zu Winzer, Brauer und Brenner?
Geldgierig wurden diese gescholten, Gauner, die aus dem Schaden anderer Menschen Profit ziehen wollten. Da mußte mancher auf Obstsaft
umstellen, und das Volk lebte gesünder, als es durch ein Verbot je hätte erreicht werden –“
„Aber seid Ihr da nicht reichlich naiv?“ konnte sich Donna Pen-Ybel nicht länger zurückhalten. „Und was hat
das mit dem Feiertagsgebot zu tun?“
„Als das Wünschen noch geholfen hat!“ lachte der Alte. „Da ging’s den Menschen besser. Allein – es gab noch etwas, was dem jungen König an
seinem Volk nicht gefiel: die Blicke der Männer! Kaum zeigte sich ein Rock oder eine Schürze auf Gasse oder Weg, galt’s schon als
Freiwild, und die Jagd war eröffnet. Es wurde gepfiffen, es wurde gerufen, und – in den Blicken der Männer lag lauter
Habgier. Nee, so was ist kein Segen für ein Volk! Also gebot der junge
König kurzerhand und kurzenbeines allen Frauenzimmern und Fräuleinkammern, nur noch als Mannsbild verkleidet außer Haus zu gehen; oder
eben gar nicht mehr. Na, da hatte der König aber was angerichtet! Nun kam
es sogar zu Handgreiflichkeiten, weil die Männer prüfen wollten, ob sie’s mit Beute oder mit einem Jagdrivalen zu tun hätten. Und es
ist nicht völlig auszuschließen, daß auch die Unsitte des Fensterlns auf diese Weise in die Welt gekommen sei. Da mußte der Rabe dem
König aber tüchtig ins Gewissen reden, bei wem dieser eigentlich hätte ansetzen müssen. Nämlich bei Anricht selbst! Wenn der König sich nicht selber beherrschen könne, wie wolle er da sein Volk leiten?
Er möge sich geschwind nach einer würdige Eheliebsten umschauen, auf daß er endlich wisse, daß Habgier keine Liebe sei, sondern was die Aufgabe der Liebe sei: nämlich die andere glücklich zu
machen. Und wenn es sich dann zeige, daß Liebe das Königshaus glücklich mache, ja, dann könne sich so etwas auf das ganze Volk –“
Jedoch nun bemerkte der Alte, daß er mal wieder allein war.
© Stiftung Stückwerken, *8.10.2021, freigegeben am 12.6.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.137 Nachklingen
„Und dann hat er’s einfach weggelassen“, berichtete Donna Sanftleben, „vermutlich hat er’s vergessen.“
„Wer? Was?“ versuchte der Alte von der Halbinsel sich zu orientieren.
„Na, der Herr Dekan gestern in der Kirche“, überforderte die Besucherin dennoch weiter. „Er – er hat bei der
Liturgie ’ne Abkürzung genommen, und nun ist er bestimmt am Boden zerstört. Ich hab’ auch versucht, ihn anzurufen oder ihm zu
schreiben, aber bei der Kirchenverwaltung will niemand mit der Adresse oder Fernsprechnummer herausrücken. Es hätte da zuviel Mißbrauch
–“
„Und das Kind wird mal wieder mit dem Bade ausgeschüttet“, folgerte der Alte.
„Und es gibt auch schon 1. Stimmen“, ging Donna Sanftleben weiter, „die behaupten: Gott rede nicht mehr durch ihn; das sei nun offenkundig –“
„– offenklatschhaft und offenverleumdet“, stellte der Alte richtig. „Das ist doch Quatsch! Wir sind nun mal Menschen und machen Fehler. Und wenn Gott so etwas auch in der
Kirche zuläßt, dann werden wir das Warum und Wozu in diesem Erdenleben wohl nie erfahren, und dennoch kann es uns etwas geben.“
„Und was?“ fragte die Besucherin.
„Mich bestätigt’s in dem Glauben“, antwortete der Alte, „daß Gott sich nicht in eine kirchliche Liturgie einzwängen läßt. Seine Liebe ist viel größer, seine Barmherzigkeit viel weiter. Und es zeigt mir, daß
noch nicht alles tot ist. Wir beide wissen: Traurigkeit führt zu nichts Gutem, schwächt die Kräfte und kann sogar töten. Deshalb wolltest du dem Dekan Mut machen. Das ist doch was Erfreuliches!“
„Aber –“, wollte Donna Sanftleben einwenden.
„– die Amtsschimmel der herrschenden Kirche haben dir den Weg verbaut“, griff’s der Alte auf. „Ist das nicht
ein weiterer Ansporn, für eine dienende Kirche zu kämpfen?“ Und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein König, der – der hieß Junghans; der war wirklich noch sehr jung. Seitdem er volljährig geworden war, hatte er erst 3 Jahre regiert, und schon ließ ihm der Zeremonienminister
den Beinamen der Große beilegen. Wozu? Na, vergleich nur! Mit was kannst du mehr Ehre einlegen: Wenn auf deiner Visitenkarte steht „Zeremonienminister von Junghans dem Unbekannten“ oder
„Zeremonienminister von Junghans dem Großen“? Ja, stell dir vor, dieser Geck wurde sogar beim König vorstellig und brachte 3 Bildhauer
mit. Die hatten Vorschläge für ein Standbild zu unterbreiten.
„Für wen denn?“ fragte der König.
„Für Euch, Majestät“, antwortete der Zeremonienminister, die Schmarotzer verschweigend.
Aber er sei doch noch gar nicht tot, wandte Junghans ein.
„Eben, Majestät!“ wandelte es der Zeremonienminister in Bestätigung. „Damit’s rechtzeitig fertig wird; denn solch ein Standbild ist keine Sache von ein
paar Tagen. Außerdem seid Ihr noch gesund und frisch, und so soll Euch die Nachwelt in Erinnerung behalten. Und – jetzt könnt Ihr noch auswählen, wie’s aussehen soll.“
Nun waren die Bildhauer einmal da, und so geruhte der König gnädigst, sie ihre Vorschläge unterbreiten zu lassen.
Der 1. wollte den König hoch zu Roß darstellen, wie er mit gezücktem Säbel nach vorne weise, um seine Leute anzufeuern.
„Ist das nicht reichlich verlogen?“ gab Junghans zu bedenken. „Welche Generäle ließen ihren König so voranziehen und in den sicheren Tod?“
Der 2. wollte den König überlebensgroß auf einem Feldherrnhügel darstellen, in der einen Hand den Feldherrnstab.
„Werd’ ich denn in meiner ganzen Regierungszeit nur Kriege geführt haben?“ zweifelte Junghans verneinend. „Bisher hab’ ich keinen einzigen geführt und gedenke, es so beizubehalten.“
„Da käme Majestät mein Vorschlag gerade recht“, beeilte sich der 3. Bildhauer und entwarf ein Denkmal, das den König auf dessen Thron zeigen werde.
„Sitzende Tätigkeit!“ kommentierte Junghans. „Als hätte
ich überhaupt nichts bewegt; noch nicht einmal mich selber. Aber, meine
Herren, vielleicht tu’ ich Ihnen unrecht, weil ich jetzt nur Ihre Zeichnungen sehe. Am besten, Sie lassen Ihre Entwürfe zu Stein
werden. Muß ja noch nicht alles ausgefeilt sein. Und dann wollen wir
weitersehen.“
Zuerst war das Reiterstandbild fertig und wurde im Schloßpark aufgestellt. Doch in der nächsten Nacht wehte
ein heftiger Sturm; und er wehte derart heftig, daß er Roß und Reiter umstürzte und in Stücke zerbrach.
Na, das soll mir nicht passieren! dachte der 2. Künstler, stellte seinen Feldherrn im Schloßpark auf und verankerte ihn so fest, daß ihm kein Sturm etwas anhaben
könne. Kein Sturm, aber ein Erdbeben! Denn das erschütterte das Standbild
derart, daß es in sich zusammenstürzte.
Wie gut, daß ich mir mehr Zeit gelassen habe! dachte der 3. Bildhauer und stellte den thronenden König (als Denkmal!) sturm- und erdbebensicher im Schloßpark auf. Jedoch – in der folgenden Nacht kam ein strenger Frost an die Herrschaft, derart streng, daß er das Stand- und Sitzbild in viele kleine Stücke
zersprengte.
Waren also Taler und Gulden zum Fenster rausgeworfen worden? Denn die 3 Bildhauer hatten sich ihre
Arbeit als Kunst vergüten lassen. Nein, der König ging nämlich zu seiner guten Fee, und die schickte ihm in der folgenden Nacht –
etwas; auf den 1. Blick: einen Traum. Der König blickte darin auf sein
Leben zurück, wie es hätte sein können; sein können, wenn er stets auf sein Herz gehört hätte. Da sah er sich vor – ja, halt dich gut fest – vor Landstreichern knien und ihnen die wunden Füße waschen und pflegen. Er sah sich mitten im Kreis von Kindern sitzen und zu ihnen aufschauen und sich mit ihnen freuen. Er sah sich unter jung und alt sitzen und allen zuhören, was sie auf dem Herzen hatten; manchmal sogar seufzen, weil er keine Hilfe wußte; doch ein Becher mit Wasser vom
Brunnen, ein Blick voll Mitgefühl und ein sanftes Streicheln waren immer zu Hand und Gesicht. –
„Aber was hat das jetzt mit dem Herrn Dekan zu tun und mit mir und mit der Kirche?“ konnte sich Donna Sanftleben
nicht länger zurückhalten.
„Irgendwie bahnen sich die Quellbäche der Moldau ihren Weg“, sann der Alte hörbar. Und – so könnte es doch
auch die Herzen der Herrschenden erreichen, daß sie eingedenk werden und sich zu Dienenden wandeln. Denn die Gelehrten sagen, kein Ton
verklinge ganz; somit auch der Heimatklang eines Lebens, der die Herzen erwärmt.“
Und er geleitete die Besucherin hinaus.
© Stiftung Stückwerken, *14.10.2021, freigegeben am 13.6.2024
Qouz-Note: 3+
***
MamM 1.138 Vom Wächter zum Hirten
„Was meint Ihr“, fragte Donna Zagenmeister: „Wird es unsere Kirchengemeinde in 10 Jahren noch geben?“
„Das weiß ich nicht“ schämte sich der Alte von der Halbinsel seines Mangels
nicht. „Ich weiß noch nicht einmal, ob es unsere Kirche in 10 Jahren noch geben –“
„Also stimmt es“, folgerte die Besucherin, „was die Leute von Euch reden: Ihr wäret ein Ketzer und Unruhestifter und tätet unserer Geistlichkeit in den Rücken
fallen.“
„Dann täte ich ihnen aber sehr dicht nachfolgen“, lachte der Alte. „Ist es nicht gerade das, was sie ständig
fordern?“
„Macht Euch ja noch lustig!“ wollte Donna Zagenmeister eigentlich das Gegenteil. „Gebt Gott die Ehre und seht eure Lehrer –“
„Gebt unserm Gott a l l e i n die Ehre“, stellte der Alte richtig. „Jedoch – wer’s zu lautstark fordert, scheint da einen Mangel zu befürchten. Ob er
meint, die Ehre könnte nicht für Gott und ihn selber reichen?“
„Euch ist wohl gar nichts heilig?“ war’s mehr ein Vorwurf denn eine Frage.
„Doch“, widersprach der Alte, „ich bet’s regelmäßig im Vaterunser. Aber daß Mensch ein Name Gottes –“
„Ihr macht mich noch ganz verbiestert!“ schimpfte die Besucherin. „Ich jedenfalls glaube, was in der Bibel steht: Die Pforten der Hölle werden meine heilige Kirche
–“
„Schon wieder etwas, das ich nicht als einen Namen Gottes kenne“, mangelte es dem Alten an Erkenntnis. „Freilich – da Gott noch keiner Kirche beigetreten ist, halt’ ich’s mehr mit dem Glauben, daß Gott seine Gemeinde nicht verderben läßt und sie zu erhalten weiß. Und sein Evangelium wird sich weiterhin
seinen Weg bahnen, wenn ich auch kaum glaube, noch 7.000 zu finden, die es predigen“, und er begann zu erzählen:
Die Schafe hatten anhörend Gesangstunde. Erst fing ein Kind an, seine Stimme zu erheben, dann die Frauen, dann
die Männer oder die es werden wollten, oder – Nun ja, auch Hammel sind nicht stumm.
Jedenfalls blickte der Hirte auf, um den Adressaten für dieses Konzert zu suchen, und fand ihn schnell: einen jungen Mann, der anscheinend völlig erschöpft niedergesunken
war. Der Schäfer sprach den Fremden an, gab ihm Milch und Käse, und allmählich kam wieder etwas Glanz in die Augen des jungen
Mannes.
Er heiße Freudlingen, machte sich der Fremde bekannter, und wolle einen Beruf erlernen.
„Wozu?“ hakte der Hirte nach.
„Weil – damit –“, druckste der junge Mann herum, „ich muß doch von irgend etwas leben.“ Er habe auch bereits
eine Lehre angetreten, jedoch – irgendwann habe er gemerkt, das sei nichts für ihn.
„Und was?“ ließ der Hirte sein Interesse nähren.
„Wächter – Wächter habe er werden wollen. Er sei nämlich in eine Stadt gekommen, und da sei das der
angesehenste Beruf gewesen.
„Wirklich?“ zeigte sich der Schäfer überrascht.
In jener Stadt sei es so gewesen, versicherte Freudlingen. Es sei schon eine besondere Stadt
gewesen. Mit hohen Mauern und engen, dunklen Gassen.
„Und da standen dann die Wächter Tag und Nacht auf der Stadtmauer und deren Türmen“, versuchte der Hirte sich das vorzustellen, „und blickten ins Land, ob sich ein Feind
–“
Nein, das sei gar nicht notwendig gewesen, stellte der junge Mann richtig. Es habe zwar auf dem höchsten Turm
der Stadt einen Türmer gegeben, aber das habe gereicht, da die Stadtmauer und deren Tore sicher und fest gewesen seien. Nein, die
meisten Wächter hätten ganz andere Aufgaben gehabt. Erstlich seien da die Gesetzgeber gewesen, die hätten ständig neue Vorschriften
ausarbeiten müssen, weil doch die 10 Gebote nicht alle Lebenslagen hinreichend regeln könnten und sich die Zeiten änderten. Dann habe
es die Gesetzeshüter gegeben, die seien Tag und Nacht durch die Gassen gezogen, um die Übertretungen festzustellen und die Übertreter –
„Etwa Spitzelunwesen?“ folgerte der Schäfer.
Nein, das sei gar nicht nötig gewesen; allenfalls vielleicht anfangs. Wenn die Bürger erst einmal an die Gesetze gewöhnt seien, dann täten sie von sich aus den Wächtern zuarbeiten und Übertreter anzeigen. Das liege so in der Natur der Menschen, sei ihm gesagt worden. Als er selber da
mitgezogen sei, habe niemand an Fenstern und Türen lauschen müssen, sondern meistens sei es nur darum gegangen, Anzeigen entgegenzunehmen, zu prüfen, dann die Übertreter zu verhaften und der 3.
Wächtergruppe zu überantworten: den Anklägern, auch Richtsanwälte genannt. Die hätten dann die Anklageschrift verfaßt und sie mit den
Angeklagten der 4. Gruppe vorgeführt: den Richtherren. Und die hätten dann das Urteil –
„Ohne Rechtsbeistand für die Angeklagten?“ entrüstete sich der Hirte.
Das sei nicht nötig, sei ihm versichert worden; denn niemand kenne das Recht besser als die Richtsanwälte und
Richtherren. Und nach deren Anweisungen sei dann das Urteil vollstreckt worden.
„Aber – aber dann haben jene Bürger ja in ständiger Angst leben müssen!“ folgerte der Schäfer.
Wenn sie nicht zu den Wächtern oder deren Familien gehört hätten, schränkte Freudlingen ein. Da habe es schon
eine gewisse Aufteilung gegeben: auf der einen Seite die, welche die Gebote erlassen und überwachen, nämlich die Wächter, auf der anderen Seite die, welche die Gebote auszuführen
hätten. Aber zwischen diesen beiden Seiten habe es auch Brücken aus Geld und Geschenken –
„Aber wer ist da noch glücklich und ehrlich –?“
Ehrlichkeit habe sich nie ausgezahlt, sondern sei im Gegenteil sogar noch als Verstocktheit ausgelegt worden und habe sich strafverschärfend –
„Und was hat das jetzt mit unserer Kirchengemeinde zu tun?“ konnte sich Donna Zagenmeister nicht länger
zurückhalten.
„Hat sie Wächter oder Hirten?“ stellte der Alte in den Raum. „Enge Gasen oder grüne Weide? Seufzen oder Singen? Freudlingen lernte jedenfalls bei dem Hirten das Leben kennen. Sie suchten für die
Schafe grüne Weide und frisches Wasser und führten die Tiere dorthin. Und wenn’s den Schafen gutging, dann hielten diese auch guten
Frieden und zusammen. Freilich – zuweilen verlor schon mal ein Schaf den Anschluß, verirrte und verstieg sich. Da war’s gut, daß der Hirte jedes Schaf mit Namen kannte und es ihm lieb und wert war. So fiel’s ihm bald auf, wenn eines fehlte, und er ging ihm nach und brachte es zurück mit
Freuden; notfalls sogar getragen. Und Freudlingen lernte, wie
wichtig es ist, mit den Schafen freundlich zu reden und ihnen treu zu bleiben in allen –“
Aber nun gewahrte der Alte, daß er mal wieder allein war und seine Besucherin nicht sein Schaf sein wollte.
© Stiftung Stückwerken, *21.10.2021, freigegeben am 13.6.2024
Qouz-Note: 3
***
MamM 1.139 In Philipp Viellieb
„Seid Ihr eigentlich schlau draus geworden“, fragte Donna Einefalt, „was unser Herr Pfarrer da am letzten Sonntag gepredigt hat?“
„Nö“, gestand der Alte von der Halbinsel freimütig. „War das denn seine Absicht?“
„Gelehrt klang’s schon“, gab die Besucherin zu, „aber sollen wir jetzt auch fremdes Vermögen veruntreuen und lügen und –“
„Niemand soll etwas“, rieb sich der Alte mal wieder an seinem Reizwort, aber lachend, „erst recht nicht über Lukas 16:1-9
predigen; denn das geht immer schief. Ich weiß auch nicht, was den geritten
hat, der dieses –“
„Früher hieß es das Gleichnis vom ungerechten Haushalter“, stellte Donna Einefalt ihr Wissen nicht unter den Scheffel,
obwohl es Grenzen hatte: „Heute heißt’s irgendwie anders.“
„Ja, ja“, tat der Alte altklug, „die môdernen Bibelübersetzungen: „ein tönend’ Erz und
eine scheppernde Schelle.“
„Und wie tätet Ihr dieses Gleichnis auslegen?“ hakte die Besucherin nach. „Schließlich geltet Ihr als –“
„– großer Ketzer, Unruhestifter, Kindskopf, Phantast“, zählte der Alte auf. „Gute Frau, ich tät’s überhaupt
nicht auslegen, denn ich weiß nicht, ob die Auslage hinterher durch den gedeckt wird, der’s übermittelt hat, und durch den, der’s gesagt hat. Und dann müßte doch inzwischen bekannt sein, daß ich Jesu Gleichnisse nicht für Bilderrätsel
halte. Nein, ich kann lediglich sagen, was es mir gibt; mehr wäre unwahr“,
und er begann zu erzählen:
Es wär’ einmal ein junger Mann, der hieß – der hieß Philipp. Der war sehr reich, denn er hatte gerade ein Erbe
angetreten. Da gelangte er zu der Ansicht, er habe in seinem Leben genug gearbeitet und könne es nun genießen. Deshalb stellte er einen Haushalter ein, der das Erbe vermehren und darüber jährlich Rechenschaft ablegen möge. Allein – bereits nach 3 Jahren fand sich’s: nichts! Das ganze Barvermögen war auf Nimmerwiedersehen ausgetan, und der Rest war derart belastet, daß er versteigert werden mußte, um die letzten
Schulden abzuzahlen. Und da sich der Haushalter rechtzeitig aus dem Staube gemacht hatte, konnte er für den Schaden nicht haftbar
gemacht werden.
Tscha, wenn du dein ganzes Vermögen verlierst, ist das nicht vorteilhaft für deinen Ruf. Deshalb bestieg unser
Philipp umgehend Schusters Braunen, gab auch noch sein Fersengeld dahin, und hast du nicht gesehen, war er bereits jenseits der Grenze.
Da er aber das Betteln nicht studiert hatte, mußte er sich wohl sein täglich’ Brot durch Arbeit verdienen. Zum Glück, so meinte er,
roch seine Kleidung noch immer nach Geld, so daß er sich ohne weiteres zu den Reichen halten konnte. Das tat er auch, sammelte
Empfehlungen, und schon nach 3 Tagen hatte er eine lukrative Anstellung gefunden, die ihn vor dem Darben bewahren konnte: Haushalter bei einem reichen
Kaufmann. Anfangs ging auch alles gut und glatt, aber die Gesetze des Reichtums haben so ihre Tücken; und schon bald bist du auf Abwegen und findest dich schließlich wieder, wo du gar nicht hingewollt hast.
Nimm nur das Gesetz: Wer hat, will mehr. Oder: Reiche Leute schenken nichts. Oder: Irgendeinen Nachbarn findest du immer, dessen Kuh mehr Milch gibt als deine.
Konkret für Philipp hieß das: Sein Herr war nie zufrieden; sein Herr sparte gerne an Lohn und Gehalt; und sein Herr war jener Nachbar, dem es täglich besser zu gehen schien als dem Haushalter. Und schon bald war alle Unschuld dahin und Philipp in die Rolle hineingewachsen, die einst sein eigener Haushalter gespielt hatte.
So etwas geht auf die Dauer nicht gut, und Philipp war’s, als säße er in einer Feldlore, die schneller und schneller zu Tal rase. Da half nur noch: Absprung vorbereiten und dann springen. Allein – das Vorbereiten
erschöpfte sich bei unserem Philipp darin, den Schuldnern seines Herrn allerhand Gefälligkeiten zu erweisen – auf dessen Kosten. Jedoch
– als Philipp sich aus dem Staube machte, erlebte er, daß du dir Freunde nicht kaufen kannst. Keiner der Schuldner wollte ihn
aufnehmen; denn das ist auch ein Gesetz des Reichtums: Nicht die Vergangenheit zählt, sondern die Zukunft. Und Zukunft hatte Philipp nicht zu bieten. Wieder mußte er heimlich eine Landesgrenze
hinter sich bringen, und drüben fing er nun mährsächlich an, zu darben.
Eines Abends fand er sich auf einem Totenacker wieder. Wasser hatte er noch aus einem Viehbrunnen trinken
können, aber der Magen knurrte, und die Füße wollten nicht mehr. Da fing Philipp an, die Toten zu beneiden, denn sie hätten hier ihre
Ruhe gefunden, und kein Hunger quäle sie. Lebensmüde sank der Wandersmann nieder, schloß die Augen und begehrte Einlaß ins
Totenreich.
Mit einem Mal wurde er unsanft wachgerüttelt, und eine besorgte Stimme mahnte ihn, aufzustehen, sonst könne er sich hier über Nacht noch den Tod holen!
Aber das wolle er doch gerade, antwortete unser Philipp benommen.
„Komm, richte dich auf“, verlangte die fremde Stimme, „und iß erst mal; dann wollen wir
weitersehen.“
Unser Wandersmann gehorchte, und allmählich blickten seine Augen wieder; und sie gewahrten ein Mädchen, das
ebenfalls auf der Wanderschaft zu sein schien. Nach und nach kamen sie ins Gespräch, und die warme Stimme des Mädchens war so
vertrauensvoll und vertrauenswürdig, daß der junge Mann seine Vergangenheit und sein ganzes Elend ihm entdeckte.
„Hast du denn überhaupt nichts mehr?“ fragte das Mädchen.
„Nein“, klagte unser Philipp, „noch nicht einmal meinen Namen; denn unter dem wird mich immer suchen, wer
durch mich zu Schaden gekommen ist.“
„Wer nicht hat, dem muß gegeben werden“, sprach das Mädchen; und ehe es sich der junge Mann versah, hatte er
einen Kuß erhalten und – einen neuen Namen: Viellieb. Und mährsächlich: In unserem Helden begann es sich zu regen, und ihm ward warm
ums –
„Held?“ konnte sich Donna Einefalt nicht mehr zurückhalten. „Was hat er denn bisher geleistet?“
„Gibt es nicht auch noch eine andere Art von Reichtum“, gab der Alte bejahend zu bedenken, „für die ebenfalls die Zukunft mehr zählt denn die Vergangenheit? Gleich am nächsten Morgen fing diese Zukunft an, als ein Toter zu Grabe getragen wurde. Viellieb und jenes Mädchen mischten sich unter die Trauergäste. Die Grabrede des
Herrn Pfarrers war nicht sehr tröstlich, sondern aus einem Sammelband abgelesen und somit Massenware. Der Geistliche merkte gar nicht,
daß unter denen, die er für seine Zuhörerinnen und Zuhörer hielt, Fragen und Antworten hin und her gingen. Aber kaum war die Lesung zu
Ende, stellte sich unser Viellieb vor die Trauergemeinde und baute Brücken über den Strom, der da heißt Vergänglichkeit. Und das war
fortan sein Beruf: aus dem Leben der Menschen alles zu sammeln, womit sich solche Brücken bauen ließen. Nicht erst am Grabe, aber auch
für solche, die schon längst am andern Ufer waren. Und wenn dann die ewigen Hütten bezogen werden, meinst du, es wäre kein Platz
–“
Aber da gewahrte der Alte mal wieder, daß ihm seine Zuhörerschaft abhanden gekommen war.
© Stiftung Stückwerken, *28.10.2021, freigegeben am 14.6.2024
Qouz-Note: 3+
***
MamM 1.140 Unser Nikoklaus
Es war einmal ein junger Mann, der hieß – der hieß Klaus. Ein König? Oder
wenigstens ein Königssohn? Kennst du irgendeinen König, der Klaus heißt?
Na, siehste! Oder jemanden, der Klaus der Große heißt? Nee, selbst unter
den kirchlichen Würdenträgern hat’s mit diesem Namen niemand bis ganz nach oben geschafft.
Nun war unser Klaus obendrein nicht von langer Gestalt, sondern konnte kaum jemandem über die Schulter oder gar über den Kopf gucken; es sei denn, Klaus kletterte auf einen Stuhl, Stein oder Baum oder der andere saß oder legte sich. Und nicht nur der, sondern auch die! Ach ja, es gab nicht sehr viele vom Geschlechte
der Schönen, die zu unserem Klaus hätten aufschauen können.
Nun hat aber eine kleine Gestalt nicht nur Nachteile. Ein kleiner Mensch kann sich leichter
verstecken. Ein kleiner Mensch stößt sich viel seltener den Kopf. Und wenn
er fällt, der kleine Mensch, steht er viel schneller wieder auf und unversehrter. Somit kannst du dir gewiß gut vorstellen, daß unser
Klaus kein Trauerkloß war, und überhaupt findest du unter den Kleinen viel mehr Fröhlichkeit denn unter den langen Hagestolzen. Ob’s
daran liegt, daß jene der Kindheit näher sind, den andern aber die Kinderschuhe nicht mehr passen?
Dennoch – irgend etwas muß auch ein kleiner Mensch werden; ja, werden! Unser Klaus schaute sich also auch um, was so im Laufe der Zeitgeschichte aus kleinen Menschen geworden war. Da gab’s sogar Kanzler, Kaiser und Tyrannen. Ja, sogar solche, die schon zu Lebzeiten
der Große genannt wurden. Aber ob sie auf ihrem Sterbelager dafür noch dankbar gewesen waren, ist fraglich. Sie hatten zwar große Eroberungen gemacht, aber für welchen Preis! Witwen und Waisen
verfluchten solchen Großen, und jenseits des Stromes erwartete ihn die Schar derer, die nicht verzeihen konnten. Nein, ein Großer
wollte unser Klaus nicht werden.
Und die Gelehrtenlaufbahn? Lehrjahre sind keine
Herrenjahre! Und das in mehrfacher Hinsicht! Willst du auf
diesem Wege ganz nach oben, dann mußt du zunächst wie ein Lemming rennen und zu manchem Irrtum zustimmend nicken. Doch das ist noch
nicht hinreichend, sondern irgendwie mußt du einem der Leittiere auffallen, damit dieses deinen weiteren Aufstieg fördert. Wer jedoch
klein ist, fällt nicht so leicht auf. Und das Leittier muß sich einen Vorteil davon versprechen, daß es dir den Weg bahnt. Und solange es lebt, fordert es von dir Dankbarkeit und Zustimmung. Und am
Ende? Wenn du ein bedeutender Gelehrter geworden bist? Dann wird vielleicht
eine Krankheit nach dir benannt. Oder eine Erkenntnis, die schon bald als überholt gilt. Oder ein Werkzeug oder Mittel, dessen schädliche Nebenwirkungen irgendwann offenbar werden oder das mißbraucht werden kann und wird. Nee, ein bedeutender Gelehrter wollte unser Klaus nicht werden.
Und der Olymp des Künstlers? Du stehst ganz oben, und alle Welt rühmt sich deiner Bilder, deiner Gedichte,
deiner Symphonien und Weisen. Doch nur die Götter können auf dem Olymp bleiben und gar in den Himmel aufsteigen; für Menschen geht’s vom Olymp nur noch abwärts. Und wie viele stürzen bereits beim
Aufstieg ab! Und wie viele beim Abstieg! Nee, das war’s unserem Klaus nicht
wert; außerdem hatte er bei sich bisher keine außergewöhnliche Begabung entdeckt; und die brauchst du ja für den Aufstieg. Oder du siehst hinreißend aus, und die
Menschen reißen sich um Bilder von dir. Oder du bist ein Investitionsobjekt; ein lukratives Investitionsobjekt! Ein schwieriges Wort; und in Märchen nicht üblich. Allein – es genügt, wenn du darin das Wörtchen Objekt
entdeckst. Ja, dann denkst du richtig: Ein Mensch wird zu einer Sache! Zu etwas, über das andere Menschen
verfügen können. Wäre das erstrebenswert?
Was machte aber unser Klaus, der keinen dieser 3 Wege beschreiten wollte? Tscha, eine gute Frage? Jedenfalls war es wieder Dezember geworden, und da gibt es ja im 1. Viertel einen ganz besonderen
Tag. Für alle, die noch Kind sind oder es geblieben. Da werden am Abend
ganz besonders die Schuhe geputzt, und ein Paar wird dann vor die Tür gestellt. Na ja, vielleicht hat auch schon mal ein gewitzter
Fritz 2 Paare oder noch mehr hinausgestellt. Und spätestens ab dem 5. Dezember, zumindest ab dem Abend, sind die Kinder ganz besonders brav. Und am Morgen sind die Schuhe, am
besten Stiefel, voller guter Gaben, und die Augen der Kinder leuchten, und das durchsonnt den ganzen Tag. Nur beim Fritz, da stecken
lauter Ruten in den Schuhen und Stiefeln. Aber zum Glück hat er eine kleine Schwester, und die teilt mit ihm ihre Gaben, und
Maria und Fritz haben darüber nicht weniger Freude, sondern mehr. Jedenfalls ahnst du vermutlich:
Es geht um den Nikolaustag.
Auch in diesem Jahr war er mal wieder ohne Schnee, dafür dunkel und grau; und ein feiner Nieselregen ließ die
Menschen niesen und husten. Wer da nichts in seinen Schuhen gefunden, ja, vielleicht gar keine Schuhe vor die Tür gestellt hat, weil er
die Hoffnung verloren hat, der oder die war arm dran. Und dieser 6. Dezember war ja nicht der
einzige trübe Tag, sondern es war zu befürchten, daß ihm noch viele ungemütliche Tage folgen täten. Ungemütliche, das war’s, was unserm
Klaus ins Gemüt fiel. Und aufging. Und reifte. Und fruchtete. Es brauchte jemanden, der denen Hoffnung gab, die sie nicht hatten, –
weil nie erhalten oder inzwischen verloren. Es brauchte jemanden, der denen Freude gab, die sie nicht hatten, – weil nie erhalten oder
inzwischen verloren. Und es brauchte jemanden, der den Herzen Wärme gab, die diese nicht hatten, – weil in Kälte aufgewachsen oder
inzwischen erkaltet. Und dieser jemand wollte unser Klaus sein, und so wurde aus unserem Klaus der Nikoklaus; denn Nikolaustag ist nur einmal im Jahr, Nikoklaustag 365mal; und alle 4
Jahre sogar –
© Stiftung Stückwerken, *4.12.2021, freigegeben am 14.6.2024
Qouz-Note: 2-
***
- MamM Titelverzeichnis
- MamM 0a bis 20
- MamM 301 bis 320
- MamM 321 bis 340
- MamM 341 bis 360
- MamM 361 bis 380
- MamM 401 bis 420
- MamM 441 bis 460
- MamM 481 bis 500
- MamM 601 bis 620
- MamM 621 bis 640
- MamM 641 bis 660
- MamM 681 bis 700
- MamM 801 bis 820
- MamM 821 bis 840
- MamM 841 bis 860
- MamM 861 bis 880
- MamM 881 bis 900
- MamM 1.001 bis 1.020
- MamM 1.021 bis 1.040
- MamM 1.041 bis 1.060
- MamM 1.061 bis 1.080
- MamM 1.081 bis 1.100
- MamM 1.101 bis 1.120
- MamM 1.121 bis 1.140
- MamM 1.141 bis 1.160
- MamM 1.161 bis 1.180
- MamM 1.181 bis 1.200
- MamM 1.201 bis 1.220
- MamM 1.221 bis 1.240
Jüngstes Update:
21.7.2025